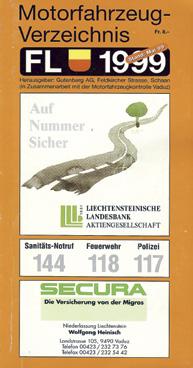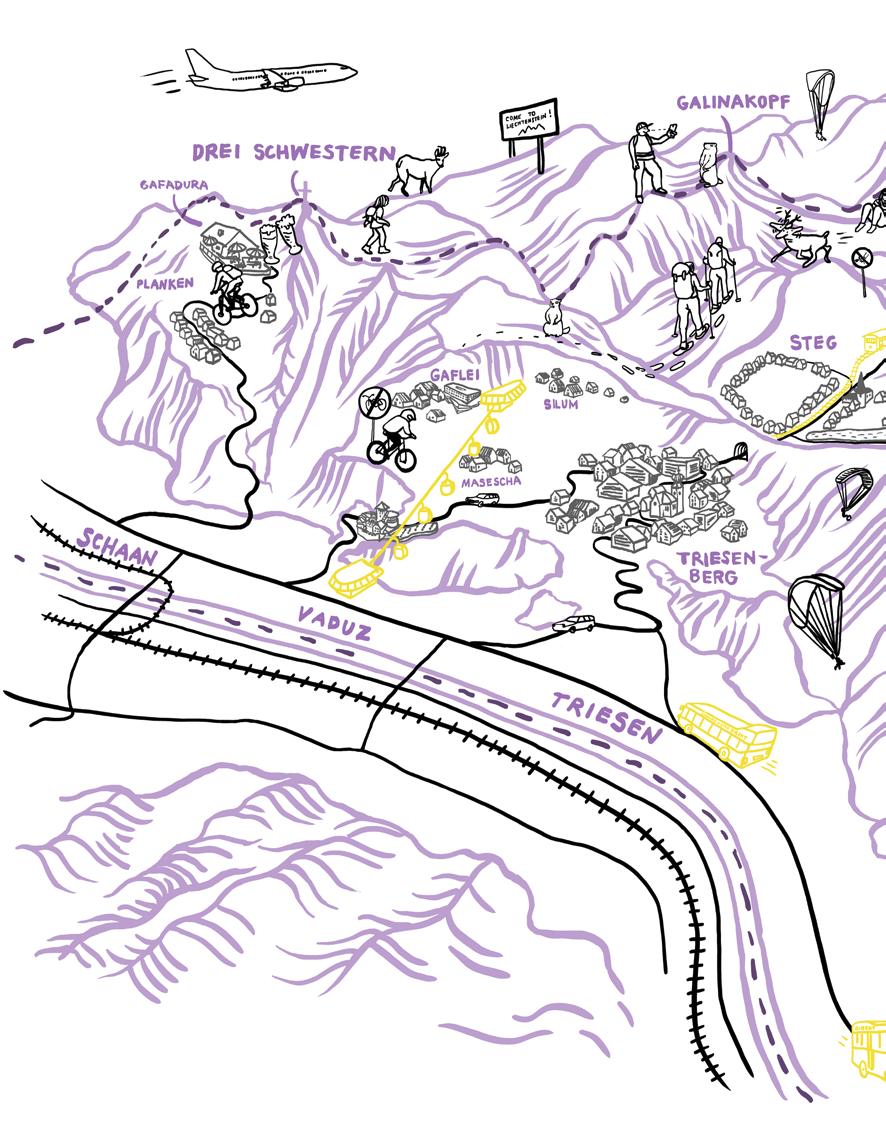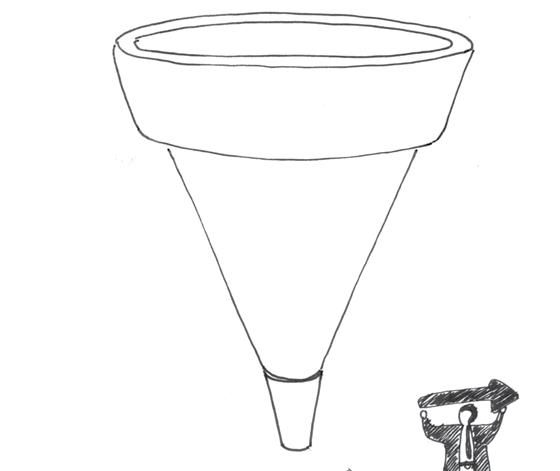Liechtenstein-Institut Universität Liechtenstein Private Universität im Fürstentum Liechtenstein

1602
4 HISTORISCHE DATEN UND ZEITRECHNUNG – vermeintliche Selbstverständlichkeiten
8 DATENFLUT UND EINZELHIRN Vom (Be-)Nutzen rechtsgeschichtlicher digitaler Datensammlungen
10 DATEN UND DEMOKRATIE: ein Spannungsverhältnis
12 AKUSTIK, LÄRM UND RECHT
14 SOZIALGESCHICHTE UND STATISTIK
17 THEORIEN AUF DEM EMPIRISCHEN PRÜFSTAND: Wie funktioniert eine «TÜV-Prüfung» in der Wissenschaft?
20 INTERNATIONALE IMPLIKATIONEN DES LIECHTENSTEINISCHEN DATENSCHUTZRECHTS
22 DATEN BILDEN DIE BASIS MODERNER VOLKSWIRTSCHAFTLICHER ANALYSE
25 Publikationen und Projekte des Liechtenstein-Instituts
Private Universität im Fürstentum Liechtenstein (UFL):
26 DIE BESTEUERUNG VON DOPPELANSÄSSIGEN STIFTUNGEN IN LIECHTENSTEIN UND IN DEUTSCHLAND
27 REGULIERTE FONDSBEZOGENE VERTRIEBSTÄTIGKEITEN Von der Fondsrechtsgeschichte zum Konzept
28 DIE LIECHTENSTEINISCHE BÜRGERGENOSSENSCHAFT: Verstoss gegen das Diskriminierungsverbot?
29 SCHEINBAR KEIN PROBLEM? Die Untersuchung der Scheinehe in Liechtenstein
30 RECHTSHILFERECHTLICHE EIGENARTEN IN LIECHTENSTEIN
31 DER MENSCH IN DATEN – Lösungen und Probleme in einer modernen Gesellschaft 36 RECHTSWISSENSCHAFT UND DATEN
38 WISSEN SCHAFFEN, WISSEN PFLEGEN – Blutgruppenforschung und Datenbankmanagement am Institut für Translationale Medizin der UFL
40 NEUES IM KAMPF GEGEN EINE DER HÄUFIGSTEN GESCHLECHTSKRANKHEITEN: Molekulare Resistenzprüfung bei Neisseria gonorrhoeae 42 BEOBACHTUNGSSTUDIE ZU BLUTHOCHDRUCK, COVID-19-FRÜHERKENNUNG, NEUEN BIOMARKERN UND WETTERFÜHLIGKEIT BEI FÖHN 44 SARS-COV-2-SEQUENZIERUNG IN LIECHTENSTEIN 46 PRÄVENTION VON HERZ-KREISLAUF-ERKRANKUNGEN: Aktuelle Forschungsergebnisse der UFL Universität Liechtenstein: 48 NEUE DATENTECHNOLOGIEN WIE BLOCKCHAINS VERÄNDERN DIE FINANZWELT RASANT 50 DIE URBANISIERUNG DES RÄTIKONS 55 DATEN UND IHRE BEDEUTUNG FÜR DIE PERSONALENTWICKLUNG 57 DER ENCROCHAT-FALL – das WhatsApp der Verbrecher 60 LEARNING FROM ALTERNATIVE DATA 62 PROCESS SCIENCE – wie wir Digital Trace Data nutzen können, um Veränderungen zu verstehen und zu gestalten 65 WENN KÜNSTLICHE INTELLIGENZ KREATIV WIRD – und was es für den Menschen bedeutet 69 Publikationen und digitale Projekte der Universität Liechtenstein 70 FORSCHUNG UND LEHRE AUF 160 QUADRAT-KILOMETERN
Liechtenstein-Institut:
Die nun bereits dritte Ausgabe des Wissenschaftsmagazins 160 2 widmet sich schwerpunktmässig dem Thema Daten. Daten können gleichermassen am Anfang als auch am Ende wissenschaftlicher Forschung stehen. So können durch Forschung neue Daten generiert werden. Wissenschaftliche Forschung kann sich aber auch auf die Analyse von Daten konzentrieren. Sie schafft damit die Grundlage für die korrekte Inter pretation von Daten. Gut möglich, dass dabei auch die Grenzen der Aussagekraft konkreter Daten aufgezeigt werden.
Der Zugang der Wissenschaft zu Daten ist also äusserst vielfältig. Genau dies soll in diesem Magazin dargestellt werden. Sind Jahresangaben in den Geschichtswissenschaften immer verlässlich? Ist eine datengestützte Politik immer auch eine demokratische Politik? Welche Rolle spielen Daten in der medizinischen Forschung? Und welche in den Rechtswissenschaften? Auch wird dargestellt, wie neue Datentechnologien wie Blockchain die Finanzwelt verändern und welche Bedeutung Daten im Personalmanagement haben. Neben den diversen Beit rägen zum Thema Daten werden aktuelle Forschungsprojekte vorgestellt.
Das Magazin 160 2 ist ein gemeinsames Magazin des Liechtenstein-Instituts, der Privaten Universität im Fürstentum Liechtenstein und der Universität Liechtenstein und damit der drei Institutionen des Hochschulstandorts Liechtenstein. Einmal im Jahr möchten wir auf diesem Wege interessierten Einwohnerinnen und Einwohnern einen Einblick in unsere vielfältige Tätigkeit geben. Es freut uns, wenn unser Magazin Ihr Interesse weckt und zum Weiterlesen und Nachfragen anregt.
Christian Frommelt, Liechtenstein-Institut

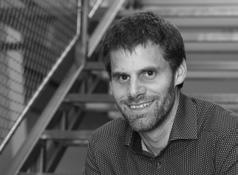
Barbara Gant, Private Universität im Fürstentum Liechtenstein (UFL)
Stefan Seidel, Universität Liechtenstein

Liebe
Leserinnen und Leser
HISTORISCHE DATEN UND ZEITRECHNUNG –
vermeintliche Selbstverständlichkeiten
Wir kennen es aus der Schule: 44 v. Chr. Ermordung Caesars, 1492 «Entdeckung» Amerikas, 1789 Französische Revolution, 1939–1945 Zweiter Weltkrieg, 1989 Fall der Berliner Mauer: Solche Daten sind für die Erfassung und Strukturierung historischer Vorgänge eine grundlegende Hilfe. Sie erlauben es, zeitliche Abläufe in einem kohärenten chronologischen Zusammenhang zu verstehen, der von der Vergangenheit über das Jetzt in die Zukunft führt. Historische Daten machen «Knotenpunkte der Geschichte» fassbar, in denen sich oft längere Entwicklungen verdichten und der Gang der Dinge in eine neue Richtung gelenkt wird.
Dennoch ist ein auf Tages- und Jahreszahlen und damit meist auf Ereignisse beschränktes Geschichtsverständnis in Schule und Wissenschaft seit Langem obsolet. Dies nicht allein, weil historische Daten und Ereignisse für sich genommen wenig aussagen und stets der Kontextualisierung bedürfen, also in einen Entwicklungszusammenhang eingebettet und auf ihre Ursachen und ihre Folgen hin befragt werden müssen. Auch vernachlässigt ein auf Einzeldaten konzentriertes Geschichtsbild ganze Bereiche historischer Erkenntnis, wie etwa die Bedeutung von Ideen, Mentalitäten, Strukturen usw., überhaupt die Entwicklungen von langer Dauer. Zudem hat die Vorstellung eines linearen Zeitstrahls von der Vergangenheit in die Zukunft eine teleologische Implikation, insofern der Geschichte eine bestimmte Zielrichtung unterstellt wird.
Begrifflich rühren die «Daten» von lateinisch datum für «gegeben» her. Dies bezog sich zunächst auf den Ausstellungszeitpunkt von Schriftstücken: Datum Stift Kempten den 23.ten Septembris 1706, datierte zum Beispiel der Vaduzer Administrator Rupert vom Bodman eine Instruktion für seine subdelegierten Kommissare, während etwa der Schellenberger Kaufvertrag mit der deutschen Entsprechung datiert wurde: So geben und geschehen, Hohen Embs den 18ten januarii 1699.
KONSTRUIERTHEIT VON DATEN
In einem umfassenderen Sinn bezeichnet der wissenschaftliche Datenbegriff allgemein Befunde oder Werte, die durch Beobachtung oder statistische Erhebung gewonnen werden. Die Geschichtswissenschaft ist dazu auf die Auswertung materieller und schriftlicher Überreste der Vergangenheit angewiesen oder auf mündliche Zeugnisse (Oral History). Neben den quantifizierbaren Grössen sind im Grunde alle systematisch aus den überlieferten Quellen gewonnenen Informationen «Daten» – «kleinstmögliche aufeinander bezogene Bestandteile des Wissens» (Tschiggerl/ Walach/Zahlmann).
Die grundlegende Problematik der Daten ist im Begriff selbst angelegt: Im lateinischen datum, dem Gegebenen, schwingt das Vorgegebene mit, das Axiomatische, das nicht hinterfragt werden kann oder muss und als voraussetzungslos gültig scheint. Dies aber trifft schon aus erkenntnistheoretischen Überlegungen auf wissenschaftliche Daten nicht zu: Eine völlig objektive, nicht konstruierende Wahrnehmung (Beobachtung) ist eine Schimäre. Denn das zu Erkennende wird erst im Erkenntnisprozess fassbar, der von kulturellen Faktoren wie Sprache und Logik und nicht zuletzt vom beobachtenden Subjekt beeinflusst wird. «Daten» existieren insofern nicht als etwas voraussetzungsfrei Gegebenes, sondern nur als «Produkt biologisch, kulturell und diskursiv determinierter Wahrnehmungsweisen» (Tschiggerl / Walach / Zahlmann).
Die Reflexion über das Zustandekommen von Daten ist somit zentral. Dies gilt gerade auch für die Geschichtswissenschaft, da die aus der Vergangenheit auf uns gekommenen Überreste in mannigfachen kulturellen Vorgängen gefiltert worden sind, sei es bei der Produktion (was wurde aufgeschrieben, was nicht?), bei der Speicherung (was wurde archiviert, was nicht?), bei der Überlieferung (was blieb erhalten, was nicht?) oder bei der Rezeption (was interessiert uns, was nicht?). Ein kultureller Vorgang ist schliesslich auch die Überführung von Daten in Wissen durch Kontextualisierung, Analyse und Interpretation: Durch die Entwicklung begründeter und plausibler Narrative leistet die Historie ihren Beitrag zur Weltdeutung und Sinnkonstruktion.
ZEIT ALS KULTURELLE UND SOZIALE GRÖSSE
Eine wesentliche Grundlage der historischen Weltaneignung ist die Zeit – womit wieder die historischen Daten im engeren Sinn angesprochen sind. Tages- und Jahreszahlen lassen sich als Punkte oder Abschnitte auf einer linearen Zeitachse verstehen und beruhen auf der Vorstellung der Quantifizierbarkeit und Messbarkeit von Zeit. Die dadurch
4 LIECHTENSTEIN-INSTITUT
erzeugte Zeitordnung ist ausser für die Chronologie auch für die Koordination des menschlichen Zusammenlebens von zentraler Bedeutung. Sie wirkt indes so selbstverständlich, dass ihr Charakter als kulturelle und soziale Grösse kaum wahrgenommen wird. Dabei war schon die Frage nach der Endlichkeit oder Unendlichkeit der Zeit ebenso Gegenstand jahrhundertelanger philosophischer Kontroversen wie die Frage, ob es eine absolute, unabhängig vom menschlichen Mass ablaufende Zeit gebe, oder ob Zeit nur in der Wahrnehmung eines Subjekts bestehe. Und während Platon sich Zeit nicht linear, sondern zyklisch vorstellte, gehen etwa die australischen Aborigines von der Synchronität unterschiedlicher Zeitebenen aus.

GRUNDLAGEN DER DATIERUNG: ZEITRECHNUNG
Die Wahrnehmung von Zeit wird wesentlich bestimmt durch die über Jahrtausende entwickelten Methoden der Zeitrechnung und der Zeitmessung. Während der Tag, der schon in Altbabylon verwendete Mondmonat und das bereits den alten Ägyptern bekannte Sonnenjahr durch astronomische Grundlagen eindeutig bestimmt sind, stützt sich die Einteilung des Monats in vier Wochen, der Woche in sieben Tage, des Tages in 24 Stunden, der Stunde in sechzig Minuten usw. auf menschliche Konvention, ebenso die Festlegung des Jahresbeginns. Dieser lag im antiken Rom bis zur Einführung des Julianischen Kalenders auf dem 1. März, was die Monatsnamen September, Oktober, November, Dezember (7., 8., 9., 10. Monat) erklärt.
Auf Konvention beruht auch die Jahreszählung ab Christi Geburt (n. Chr.). Diese «Inkarnationsära» war ein grosser Fortschritt, da sie auch die Rückwärtszählung (v. Chr.) erlaubte und damit die Notwendigkeit eines Anfangs beseitigte. Sie findet sich ab dem Jahr 525, verdrängte aber erst in der Frühen Neuzeit die Zählung ab Erschaffung der Welt, bei welcher die Berechnung des Schöpfungsdatums anhand der Bibel zu unterschiedlichsten und wenig zuverlässigen Resul-
taten führte. Die Römer hatten ihre Jahreszählung mit der sagenhaften Gründung der Stadt Rom im Jahr 753 v. Chr. beginnen lassen, während in der muslimischen Zeitrechnung der Nullpunkt auf das Jahr der Auswanderung des Propheten Mohammed von Mekka nach Medina gelegt wurde (622 n. Chr.). Im 16./17. Jahrhundert setzte sich zudem die Gliederung der Chronologie nach durchnummerierten Jahrhunderten durch, anstelle der hergebrachten Chronistik nach Päpsten und Kaisern.
Einen bedeutenden Rationalisierungsschub stellte auch die fortlaufende Tageszählung innerhalb der Monate dar. Noch bis ins Spätmittelalter hatte sich die Tageszählung an den Kirchen- und Heiligenfesten orientiert, welche jedoch von Bistum zu Bistum variierten. So wurde etwa der für das buchhalterische Rechnungsjahr wichtige Georgstag zumeist am 23. April gefeiert, in manchen Bistümern wie Salzburg, Augsburg und Prag am 24. April, im Bistum Chur aber erst am 25. April – nur im nördlichen Bistumsteil, dem Vorarlberger Oberland und wohl auch in Vaduz und Schellenberg, bereits am 23. April: Eine einheitliche und eindeutige Datierung war so nicht einmal innerhalb des Bistums gegeben.
KALENDERDIFFERENZEN

Grundlage der Zeitrechnung im christlichen Europa war der im Jahr 46 v. Chr. von Julius Caesar eingeführte Julianische Kalender, der das Sonnenjahr zu 365 Tagen mit zwölf Mondmonaten und einem Schalttag in jedem vierten Jahr kombinierte. Dieses Jahr war jedoch elf Minuten und vierzehn Sekunden zu lange, sodass das astronomische Sonnenjahr und das Kalenderjahr alle 128 Jahre um einen Tag auseinanderfielen. Dies machte die Berechnung des Ostertermins und der davon abhängigen Feiertage ungenau, weshalb Papst Gregor XIII. 1582 eine Kalenderreform anordnete: Um die vom Konzil von Nicäa (325 n. Chr.) beschlossene Berechnung des Ostertermins beibehalten zu können, wurden die seither überzähligen zehn Tage übersprungen: auf Mon-

Sollen wir Camporin* nun schon das erste Mal erwähnen?
Komm, lassen wir sie doch lieber noch ein bisschen zappeln ...
5 LIECHTENSTEIN-INSTITUT
* heute: Gamprin
tag den 4. Oktober folgte direkt Freitag der 15. Oktober 1582. Eine modifizierte Schaltjahresregelung verbesserte zudem die astronomische Genauigkeit.
Die meisten katholischen Länder übernahmen den Gregorianischen Kalender («neuer Stil») zwischen 1582 und 1584. Die evangelischen und orthodoxen Länder lehnten die päpstliche Reform jedoch ab und blieben beim «alten Stil». Diese Spaltung der Zeitrechnung, das Nebeneinander von «katholischer Zeit» und «evangelischer Zeit», führte im Alltag zu manchen Problemen, besonders in konfessionell gemischten Gebieten wie der Schweiz und dem Heiligen Römischen Reich, aber etwa auch im länderübergreifenden Handelsverkehr.
Erst 1699 beschlossen die evangelischen Stände des Alten Reichs die Annahme des «Verbesserten Kalenders»: Nun mussten bereits elf Tage übersprungen werden, sodass auf den 18. Februar unmittelbar der 1. März 1700 folgte. Dänemark, Norwegen, die Niederlande und einige evangelische Kantone der Schweiz übernahmen den «Verbesserten Kalender» bis 1701, andere erst später im 18. Jahrhundert. In Graubünden gingen Schiers und Grüsch erst 1812 als letzte Gemeinden in West- und Mitteleuropa zum neuen Kalender über. In England, Schottland und den britischen Kolonien in Nordamerika erfolgte die Datumsangleichung 1752. Als säkulare Zeitordnung setzte sich der Gregorianische Kalender erst im 19./20. Jahrhundert weltweit durch. So folgte z.B. Japan 1873, Russland 1918, die Türkei 1926, 1949 schliesslich das maoistische China.
SÄKULARISIERUNG UND RATIONALISIERUNG
DER ZEIT
Die Zeitrechnung als Ausdruck «quantifizierter Zeit» und als Grundlage historischer Daten ist also ausgeprägt ein kulturelles Phänomen. Lange stand sie in einem christlicheschatologischen Deutungszusammenhang, zumal es Versuche gab, neben dem Schöpfungstermin als dem Beginn der Heilsgeschichte auch das Ende der Welt, den Jüngsten Tag, als deren Abschluss zu berechnen. Erst in der Neuzeit, befördert durch den Buchdruck, die Aufklärung und die aufstrebenden Naturwissenschaften, kam es zu einer Säkularisierung und Rationalisierung der Zeit und auch der Geschichtsschreibung. Seit dem 18. Jahrhundert, so Reinhart Koselleck, dy-

namisierte sich der Zeitbegriff: An die Stelle des «auf die Bibel gegründeten geschichtlichen Datengerüsts» traten neue Konzepte «geschichtlicher Zeiten» (Gerhard Dohrn-van Rossum). Nach hinten erweiterte die Naturwissenschaft den Zeithorizont um Millionen von Jahren an Vergangenheit, nach vorne schloss sich eine lange, offene Zukunft an, in die hinein sich Natur und Geschichte entwickeln. Das neue Verständnis von Zeit und Geschichte als Prozess wurde zur Grundlage des Fortschrittsglaubens und des Modernisierungsoptimismus – die durch mannigfache Krisenerfahrungen immer wieder erschüttert werden.
Fazit: Historische Daten – sowohl im weiten Sinn der aus den Überresten der Vergangenheit extrahierten Wissensbestandteile als auch im engen Sinn der Datierung – sind nicht voraussetzungslos «gegeben», sondern das Resultat mannigfacher kultureller Vorgänge. Dies zeigt sich am Beispiel der Entwicklung der Zeitrechnung. Im Bewusstsein ihres konstruierten Charakters bilden sie dennoch eine wesentliche Grundlage für unser Verständnis der Welt.
lic. phil. Fabian Frommelt, Forschungsbeauftragter Geschichte am Liechtenstein-Institut
Literatur
– Enzyklopädie der Neuzeit (2005–2012), hg. von F. Jaeger, 16 Bände, Stuttgart/Weimar, Artikel «Chronologie», «Kalender», «Kalenderreform», «Zeit», «Zeitmessung», «Zeitordnung», «Zeitrechnung».
– Grotefend, H. (1982): Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit, 12. Auflage, Hannover: Hahnsche Buchhandlung.
– Kantonsschule Limmattal, Fachbereich Geschichte: Jahreszahlen in der Geschichte, online: https://www.kslzh.ch/index.php?pid=64&l=de&dpid= 354, abgerufen am 16.9.2022.
– Koselleck, R. (2022): «Zeit», in: Lexikon Geschichtswissenschaft. Hundert Grundbegriffe, hg. von Stefan Jordan, Stuttgart, S. 331–336.
– Tschaikner, M. (2018): Die Datierung des Georgstags im nördlichen Teil der Diözese Chur, in: Bludenzer Geschichtsblätter 119, S. 4–8.
– Tschiggerl, M., Walach, T., Zahlmann, S. (2019): Geschichtstheorie, Wiesbaden: Springer VS.
«Vaduz den 22. Aprilis / 2. May 1690»: Doppeldatierung aufgrund der Zeitdifferenz zwischen dem Julianischen Kalender (alter Stil) und dem Gregorianischen Kalender (neuer Stil) in einer Quittung des Exekutionskommissars des Schwäbischen Kreises für die Reichsgrafschaft Vaduz (ÖStA, HHStA, RHR, Jud., Den. Rec. 261/14, fol. 18r, Vaduz, 22.4./2.5.1690, Abschrift).

6 LIECHTENSTEIN-INSTITUT
Mehr als 12 500 Rechtsakte der Europäischen Union (EU) wurden von Liechtenstein und seinen EWR/EFTA-Partnern Island und Norwegen bisher in das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) übernommen. Das ist eine hohe Zahl. Doch wie ist diese Zahl einzuordnen? Hierfür sind zwei Perspektiven relevant. Die erste Perspektive vergleicht die Anzahl übernommener EU-Rechtsakte mit der Anzahl insgesamt erlassener EU-Rechtsakte. Sie beantwortet somit die Frage, wie viel Prozent des EU-Rechts durch den EWR abgedeckt sind. Der zweite Ansatz stellt die Frage, wie stark die Übernahme von EU-Recht die liechtensteinische Rechtsetzung bestimmt.
Betrachtet man den ganzen Zeitraum seit dem EWR-Beitritt 1994, so wurden lediglich 15 % aller EU-Verordnungen und -Richtlinien in das EWR-Abkommen übernommen. Schaut man aber nur auf das Jahr 2019, waren es über 54 % . Der Anteil der über nommenen Verordnungen liegt dabei mit 51 % deutlich tiefer als der Richtlinien mit 81 %. Nimmt man gar nur jene Richtlinien, welche vom EU-Rat und vom EU-Parlament verabschiedet wurden – und somit von besonderer Relevanz sind –, liegt der Anteil gar bei fast 90 %. Allerdings handelt es sich hierbei im Jahr 2019 auch nur um 34 Rechtsakte. Doch was bedeuten diese Zahlen nun? Wie stark sind die EWR/EFTAStaaten tatsächlich in die EU integriert? Trotz etlicher Kennzahlen lässt sich dies nicht sagen. Jede Kennzahl steht letztlich nur für sich selbst und ist damit von begrenzter Aussagekraft. Daten können eben nicht immer alles aussagen.
Und wie steht es mit der zweiten Perspektive? Im langjährigen Schnitt dienen etwa 45 % (!) der vom Landtag behandelten Gesetzesvorlagen der Umsetzung von EWR-Recht. Sprich: Fast die Hälfte der Gesetzesvorlagen ergeben sich aus der EWR-Mitgliedschaft. Auch hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Anteil nach Themenbereich stark variiert und auch der Umsetzungsspielraum Liechtensteins je nach Vorlage unterschiedlich gross ist. Daten bleiben also erklärungsbedürftig.
7 LIECHTENSTEIN-INSTITUT
Christian Frommelt
DATENFLUT UND EINZELHIRN Vom (Be-)Nutzen
rechtsgeschichtlicher digitaler Datensammlungen
Daten werden in Unmengen gesammelt, gesichert und gehortet, auch wenn unklar ist, inwiefern sie sich dereinst als relevant erweisen werden. Auch die rechtshistorische Forschung setzt inzwischen vermehrt auf eine solche Sammlung von (digitalisierten) Daten.
DATENFLUT UND EINZELHIRN
Ein Beispiel ist das Projekt «iurisprudentia» der Universität Zürich: Ganze Nachlässe etlicher berühmter Rechtswissenschaftler:innen sowie Materialien aus Gesetzgebungsprozessen wichtiger Kodifikationen werden, möglichst bis auf den letzten Notizzettel, gescannt, computergestützt automatisch transkribiert und online kostenlos zugänglich gemacht. Das Projekt akkumuliert (und sichert) rechtsgeschichtliche Daten in einer noch nie so dagewesenen Fülle und Verfügbarkeit für die gegenwärtige (und künftige) Forschergemeinschaft.
Aber: kein Nutzen ohne Benutzen. Solange nicht Forschende sich dieser rechtsgeschichtlichen Daten annehmen und daraus mit einem bestimmten Ziel unter Anwendung einer konkreten Methode das Relevante heraussuchen und zu Erkenntnissen verarbeiten, bleiben die Daten stumm. Oder vielmehr: Sie bleiben lärmend und schreiend, weil das überwiegende Störrauschen der Datenflut es unmöglich macht, das, was man wirklich hören möchte, herauszufiltern.
Zum Qualitätsmerkmal einer jeden rechtsgeschichtlichen Datensammlung wird deshalb nicht nur, dass sie sorgfältig angelegt ist, sondern auch, dass sie übersichtlich erschlossen und verlässlich durchsuchbar ist. Denn nur auf dieser Grundlage kann das erforderliche (hermeneutisch gesehen) «vertrauliche Zwiegespräch» stattfinden zwischen Einzelhirn und (ausnahmsweise sei hier ein Singular erlaubt) dem einzelnen «Datum».
DATUM FÜR DATUM
Eine Urform der persönlichen Datensammlung ist das Tagebuch. Ein Tagebuch in Form von Briefen an seine verstorbene Frau führte Eugen Huber (1849–1923), der Schöpfer des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB), in den Jahren 1910 bis 1917. Es wird derzeit vom Institut für Rechtsgeschichte der Universität Bern in transkribierter Form online frei zugänglich herausgegeben.
Für sich genommen enthalten die Bände dieses Tagebuchs eine Unmenge verschiedenster Angaben, die in ihrer chaotischen Fülle anfangs eher abschreckend wirken. Ihr Wert im Einzelnen zeigt sich erst bei genauer Lektüre, wobei jeder das Tagebuch anders liest und darin Unterschiedliches bemerkt. Dabei navigiert uns das Einzelhirn durch die Datenflut: Darin findet sich Rechtsgeschichtliches (wie die Gedanken Hubers zum Inkrafttreten des ZGB am 1.1.1912); Ereignisgeschichtliches (wie Hubers Wahrnehmung des Flugzeugabsturzes von Hans Schmid am 14.10.1911); Sozialgeschichtliches (wie Hubers Bedenken, ob vornehme Damen
«Velociped» fahren sollten, u.a. vom 26.9.1912); ganz Persönliches (Hubers erstaunliche Bemerkung vom 9.2.1912: «wie wenig ich innerlich Jurist bin») und vieles mehr. All diese Facetten eröffnen sich einem aber nur – wie gesagt – in einem vertraulichen Gespräch bei individueller Lektüre.
Ein vergleichbares Projekt für Liechtenstein wäre die (wünschenswerte) Herausgabe der nachgelassenen und nicht weniger facettenreichen Briefesammlung von Wilhelm Beck.
ÜBERFLUTUNG
Wie demgegenüber das Einzelhin in der Datenflut versinkt, zeigt Jorge Luis Borges (1899–1986) in seiner Erzählung «Das unerbittliche Gedächtnis»: Der junge Mann Ireneo Funes ist nach einem Reitunfall gelähmt; aber sein Gehirn nimmt die gesamte Umgebung bis in die feinsten Einzel heiten hinein wahr und speichert alles genauestens in seiner Erinnerung ab. Funes, Gehirn wird zum unermesslichen Speicher von einzelnen (Sinnes-)Daten. Doch er kann sie nicht sinnvoll (be-)nutzen, weil sein Einzelhirn sich in der Datenflut nicht mehr zurechtfindet: «Nicht nur machte es ihm Mühe zu verstehen, dass der Allgemeinbegriff Hund so viele Geschöpfe verschiedener Grösse und verschiedener Gestalt umfassen soll; es störte ihn auch, dass der Hund von 3 Uhr 14 (im Profil gesehen) denselben Namen führen sollte wie der Hund von 3 Uhr 15 (gesehen von vorn).»
Dr. Emanuel Schädler, LL.M., Forschungsbeauftragter Recht am Liechtenstein-Institut
Quellen – Projekt «iurisprudentia»: https://rwi.app/iurisprudentia/de – Eugen Huber: Briefe an die tote Frau, https://books.unibe.ch/index.php/ BB/catalog/series/EHB – Borges, J. L. (2010): Das unerbittliche Gedächtnis, in: Jorge Luis Borges. Die unendliche Bibliothek. Erzählungen, Essays, Gedichte. Frankfurt am Main: S. Fischer, S. 161–174.

8 LIECHTENSTEIN-INSTITUT
Lieber Gustav
Entschuldige wenn ich Dir auf Deine soeben erhaltenen Zeilen, die mich übrigens gefreut haben, Einiges erwidere.
1. Ganz begreiflich ist es mir, wenn Du schreibst, es schicke sich Dir nicht, jetzt «Politik» zu treiben, Du meinst damit wohl aktiv-offene Stel lungnahme zu unsern bekannten Postu laten. Nun, das verlange ich selbstverständlich auch nicht, denn es würde in gar mancher Hinsicht nicht Deiner Zukunft dienlich sein. – Soviel einerseits.
– Andererseits muß man auch von Dir wie übrigens von Jedem die Wahrung Deiner Interessen fordern. Wie nun aber noch irgendwie Deine Interessen zu wahren sein werden, das will ich Dir nicht mehr weiß [sic] machen. Andere Lehrer tun es auch!
2. Du schreibst mir, daß wir den sog. Büchlern [Bächlern?] nicht trauen sollen. Klugerweise muß man sich ja in Obacht nehmen, denn es gibt nun einmal Leute, deren ehrliche Beschäftigung darin besteht, alles zu «hinterbringen». Ich nehme die Sache nun einmal kühl, und habe dazu in meinem Berufe die beste Gelegenheit; nicht Alles regt mich mehr auf. Auf das Ziel lossteuern, manchmal die unglaubliche Wahrheit ins Gesicht sagen, manchmal den schlichten Bürger spielen, dann geht’s schon vorwärts.
Es besteht leider bei uns eine krankhafte Veranlagung jedes den Ehrgeiz oder sonst was nur anscheinend verletzende Wort als ein Symptom der Abneigung, der Hinter- und Niederträchtigkeit aufzufassen. Das ist nicht notwendig. Wir streiten uns nicht um den Mann ohne hohen Namen.
3. Es scheinen sich m. E. auch die Stimmen zu mehren, die für eine andere Zusammensetzung unseres Landtages am Wahltage sorgen werden. Was Du nicht vergessen magst!
Soviel zu Deiner Aufklärung, mehr später. Tue auch Deine Pflicht im Stillen.
Mit bestem Gruß Wilhelm
Selbstverständlich werden wir einander über die [...] etc. der Personen Liechtensteins stets aufklären. Das muß nun ein besonderes Ziel für uns sein.
Wilhelm Beck war ein fleissiger Briefeschreiber. Rund 300 seiner Briefe haben sich in Kopie erhalten in drei «Copie de lettres»-Bänden. Beck war bis 1914 in der Anwaltskanzlei von Nationalrat Emil Grünenfelder in Flums tätig, danach gründete er eine eigene Kanzlei in Vaduz. Die Briefe aus den Jahren 1912 bis 1919 sind inhaltlich breit gefächert. Ein Teil der Briefe sind privater Natur («Liebe Mama»). Andere legen Zeugnis ab von seinen Kontakten zu politischen Persönlichkeiten und Weggefährten. Er schreibt von den Schwierigkeiten, in Vaduz eine Kanzlei zu eröffnen. Aus anderen Briefen wird ersichtlich, dass er Triesenberger Bürgern juristisch zur Seite steht, indem er zum Beispiel Bittschriften an den Fürsten verfasst. Becks politische Ideen und Absichten kommen zum Vorschein, Politisches wird oft konspirativ abgehandelt. Es geht um Landtagswahlen, Zeitungsgründung, Parteigründung. Im Wissen um sein späteres Wirken lässt sich Becks zukünftiger Weg schon deutlich erkennen.
 ler vom 11. Juli 1913. In: Copie de Lettres, Band l, S. 50/51 (Privatarchiv Rupert Quaderer)
ler vom 11. Juli 1913. In: Copie de Lettres, Band l, S. 50/51 (Privatarchiv Rupert Quaderer)
9 LIECHTENSTEIN-INSTITUT
Spannungsverhältnis
In Zeiten grosser Unsicherheiten wie der Corona- oder der Klimakrise steigt die Nachfrage nach wissenschaftlicher Expertise.
Die Rufe nach einer «evidenzbasierten Politik» gehen jedoch häufig zu weit. Weder gibt es die eine Wissenschaft, auf die sich die Politik abstützen kann, noch lässt sich der Prozess der demokratischen Entscheidungsfindung durch den Rekurs auf wissenschaftliche Fakten umgehen.
«What matters is what works.» Diese dem ehemaligen britischen Premierminister Tony Blair zugeschriebene Losung drückte in den 1990er-Jahren die Hoffnung auf eine neue Ära der rationalen Politikgestaltung aus (Frey & Ledermann 2010). Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und dem Ende totalitärer Regime in Europa schien die Zeit reif für eine Politik, die auf der Grundlage solider Fakten fusst und nicht mehr von politischen Ideologien in Beschlag genommen wird. An die Stelle normativer Vorurteile sollten objektive Daten treten. Politische Streitfragen sollten sich gemäss der wissenschaftlichen Wahr/ Falsch-Logik vermessen lassen (Bogner 2021). Information sollte über Ideologie und Ignoranz triumphieren (Hirschi 2018).
Dieses Credo der ideologiefreien und faktenbasierten Politik fällt auch in Krisenzeiten auf fruchtbaren Boden. Daraus abgeleitete Forderungen nach einer evidenzbasierten Politik schiessen aber oftmals über das Ziel hinaus. Im Kern gehen sie nämlich davon aus, dass es für jede politische Herausforderung eine objektiv richtige, auf Zahlen, Daten und Fakten beruhende Antwort gibt. Gute Regierungsführung reduziert sich dementsprechend auf einen mechanischen Prozess zur Realisierung ebendieser objektiv richtigen Lösung (Bogner 2021). Dabei wird aber oft übersehen, dass sich Politik und Wissenschaft in zwei getrennten Sphären bewegen. Nur wenn die jeweiligen Funktionen und Grenzen von datenbasierter Wissenschaft und (demokratischer) Politik berücksichtigt werden und nicht das Eine durch das Andere okkupiert wird, gelingt ein lebendiges Miteinander, von dem die Gesellschaft bestmöglich profitiert.
DATEN SPRECHEN NICHT FÜR SICH SELBST
Empirische Evidenz wird durch die Anwendung wissenschaftlicher Methoden gewonnen. Ausgehend von Theorien und Annahmen werden Hypothesen abgeleitet, die sodann mit Daten empirisch untersucht werden. Die aus der Analyse
gewonnenen Resultate werden wiederum durch die Brille der jeweiligen Theorie interpretiert und die Theorie weiterentwickelt.
Theorien schaffen also ein gemeinsames Verständnis der analysierten Konzepte, liefern mögliche Erklärungen für Zusammenhänge, legen die zugrunde liegenden Annahmen offen und garantieren die Anknüpfung an den aktuellen Forschungsstand. Damit gewährleisten die Forschenden die Nachvollziehbarkeit ihrer Argumentation und öffnen den Raum für Kritik von Fachkolleginnen und Fachkollegen, die ihrerseits ein zentraler Motor des wissenschaftlichen Fortschritts ist.
Theorien sind jedoch immer nur ein Abbild (Modell) der gesamten, komplexen Realität, von der sie nur einen spezifischen Ausschnitt betrachten. Sie sind selektiv, bewegen sich zumeist innerhalb einer spezifischen Fachdisziplin und schliessen selbst innerhalb dieser Fachdisziplin andere legitime Perspektiven aus (Framing). Es gibt denn auch nicht «die eine» Wissenschaft, die mit einer Stimme spricht.
Unter «Framing» versteht man einen meist bewusst gesteuerten Prozess, ausgewählte Daten und Fakten so zu präsentieren, dass sie in einen vordefinierten Deutungsrahmen passen. Framing ist eine notwendige Voraussetzung für Kommunikation, kann aber auch missbraucht werden, um eine manipulierende Wirkung zu erzeugen. Ein alter, aber gleichwohl populärer Witz verdeutlicht dies: Nach einem verlorenen Wettkampf zwischen der UdSSR und den USA lobte eine sowjetische Zeitung den ehrenvollen zweiten Platz ihrer Mannschaft und spottete über die amerikanische Equipe. Schliesslich wurde diese bloss vorletzte.
DATEN UND DEMOKRATIE: ein
Neu gewonnene Evidenz ist jeweils nur so lange gültig, bis sie durch neue Studien und neue Daten falsifiziert wird.
10 LIECHTENSTEIN-INSTITUT
Die demokratische Politik eines freien Landes kann sich folglich nicht auf die automatische Umsetzung einer spezialisierten wissenschaftlichen Evidenz beschränken. Bezogen sich Politik und Medien zu Beginn der Coronapandemie beispielsweise stark auf die Subdisziplinen der Virologie und Epidemiologie, meldeten sich im Laufe der Pandemie zusehends auch Vertreterinnen und Vertreter anderer Wissenschaften, etwa der Rechtswissenschaften, Psychologie oder Volkswirtschaftslehre, zu Wort und brachten ihre wiederum fachspezifisch und theoretisch gerahmten Erkenntnisse ein. Und bezeichnenderweise berufen sich Kritikerinnen und Kritiker der Klima- oder Coronapolitik nicht selten selber auf Erkenntnisse und Methoden wissenschaftlicher Expertinnen und Experten.
WISSENSCHAFTLICHE ERKENNTNIS IST VORLÄUFIG
Wissenschaftliche Erkenntnis wird gerne als der «aktuelle Stand des Irrtums» bezeichnet. Neu gewonnene Evidenz ist jeweils nur so lange gültig, bis sie durch neue Studien und neue Daten falsifiziert wird. Damit nicht genug, führen neue Erkenntnisse zu fortschreitenden Differenzierungen und Komplexitätssteigerungen.
Neben der Gefahr, dass sie nur noch von einem kleinen Personenkreis verstanden werden, drohen Friktionen zwischen der eigenen unmittelbaren Erfahrung und der abstrakten, statistischen Evidenz, die den Einzelfall kaum noch berücksichtigt und häufig auf Mittelwerte ausgerichtet ist.
Das in der Demokratie gelebte, regelgeleitete Aushandeln von mehrheitsfähigen Kompromissen kann deshalb nicht mit Verweis auf «die Fakten» abgekürzt werden. Gerade wenn es um kausale Handlungsanweisungen für die Zukunft geht («Wenn ihr A macht, dann wird B eintreffen») sind die Unsicherheiten naturgemäss gross.
WELCHES SIND DIE «RICHTIGEN» ZAHLEN?
Meist gibt es mehrere gleichberechtigte Möglichkeiten, wie man etwas messen kann. Das im Zuge der Coronapandemie prominent diskutierte Konzept der Übersterblichkeit illustriert dies. Obwohl verschiedene Forscherinnen und Forscher vom gleichen Konzept («Übersterblichkeit») ausgehen, dieses grundsätzlich gleich operationalisieren (tatsächliche Todesfälle minus zu erwartende Todesfälle) und ihre Berechnung auf dieselbe Datenbasis stützen (Todesfälle des betrachteten und der vorangehenden Jahre), kommen sie aufgrund unterschiedlicher Modellrechnungen zu teils stark divergierenden Ergebnissen. Für die Pandemiejahre 2020 und 2021 weist die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in der Schweiz beispielsweise eine Übersterblichkeit von rund 8200 Personen aus, die Universität Washington kommt auf den um fast 90 Prozent höheren Wert von 15 500 Personen und die Zeitschrift The Economist auf rund 13 300 Personen (Stand 13. Juni 2022).
Welches sind denn nun die «richtigen» Zahlen und Interpretationen, auf die sich eine automatische politische Umsetzung wissenschaftlicher Evidenz stützen sollte? Das lässt sich nicht pauschal sagen und ist oft auch eine Vertrauensfrage. Öffentlich ausgetragener Streit um die «richtigen» Zahlen
und ihre Interpretation verdeckt deshalb häufig den Kern demokratischer Politik, nämlich die normative, wertebasierte und zuweilen emotionale Diskussion darüber, wie wir unser gemeinschaftliches Zusammenleben regeln wollen und welche Risiken wir bereit sind dafür einzugehen.
ES GIBT KEINE ALTERNATIVLOSE DEMOKRATIE
Der Slogan «what matters is what works» wird einer lebendigen Demokratie nicht gerecht. Selbst wenn es in einer Sache einen unbestrittenen interdisziplinären Konsens gäbe, darf die demokratische Politikgestaltung nicht zu einer technokratischen «Umsetzungsmaschinerie» (Merkel 2021: 8) verkommen. Im Zentrum der gelebten Demokratie stehen eben nicht rationale Wissensfragen, sondern das lebensweltliche Auffinden mehrheitsfähiger Kompromisse durch die freie Deliberation verschiedener Ansichten, Werte, Weltbilder und Normen. Daten und Fakten sind kein Ersatz für das Aushandeln und Aushalten von Interessenkonflikten auf der Suche nach tragfähigen, gemeinschaftlichen Entscheidungen.
Fakten
Damit soll keineswegs gesagt werden, dass wissenschaftliche Expertisen, Zahlen und Fakten für die Politik entbehrlich sind. Im Gegenteil sind Daten mit ihren wissenschaftlichen Interpretationen eine sehr wichtige Hilfestellung. Ob und wenn ja welche Massnahmen daraus abgeleitet werden, muss aber eine politische Entscheidung sein.
Dr. Philippe Rochat, Forschungsbeauftragter Politik am Liechtenstein-Institut
Quellen
–
Bogner, A. (2021): Die Epistemisierung des Politischen. Wie die Macht des Wissens die Demokratie gefährdet. Stuttgart: Reclam. – Frey, K.; Ledermann, S. (2010): Evidence-Based Policy: A Concept in Geographical and Substantive Expansion. German Policy Studies, Vol. 6(2), S. 1–15. – Hirschi, C. (2018): Skandalexperten, Expertenskandale. Zur Geschichte eines Gegenwartsproblems. Berlin: Matthes & Seitz. – Merkel, W. (2021): Neue Krisen. Wissenschaft, Moralisierung und die Demokratie im 21. Jahrhundert. Aus Politik und Zeitgeschichte APuZ, 26-27/2021, S. 4–11.

–
Daten WHO: https://www.who.int/data/sets/global-excess-deathsassociated-with-covid-19-modelled-estimates –
Daten IHME der Universität Washington: https://ghdx.healthdata.org/record/ihme-data/covid_19_excess_mortality –
Daten The Economist: https://github.com/TheEconomist/covid-19excess-deaths-tracker
11 LIECHTENSTEIN-INSTITUT
Daten und
sind kein Ersatz für das Aushandeln und Aushalten von Interessenkonflikten auf der Suche nach tragfähigen, gemeinschaftlichen Entscheidungen.
Schall ist objektiv messbar, nicht aber der subjektiv wahrgenommene Wohlklang oder Lärm. Wie also wird festgelegt, was Lärm ist? Wie laut ist Lärm?
Und auf welche Weise soll uns das umweltrechtliche Immissionsschutzrecht
≥ 75 70–74.9 65–69.9 60–64.9 55–59.9 50–54.9 45–49.9 < 45 Quelle http://geodaten.llv.li/geoportal/laerm.html

AKUSTIK, LÄRM UND RECHT
Die Karte zeigt, welcher Lärmbelastung die Bevölkerung durch den Strassenverkehr tagsüber ausgesetzt ist (2015). Der Immis sionsgrenzwert für die Empfindlichkeitsstufe II, z.B. reine Wohnzonen, liegt bei 60 dB(A). 12 LIECHTENSTEIN-INSTITUT
SCHALL UND LÄRM
Als Akustik wird die Lehre vom Schall, seiner Entstehung, Ausbreitung und Beeinflussung bezeichnet. Schall wiederum sind mechanische Schwingungen eines elastischen Mediums, die sich als Schallwellen ausbreiten. Schall kann verschiedenartig gemessen werden, insbesondere als Frequenz der Schallwellen in Hertz (Hz), was zu objektiven Daten führt. Erst durch eine subjektive Wertung des Schalls als erwünscht oder unerwünscht jedoch ergibt sich die Quali fikation als Wohlklang oder als Lärm. Ein erwünschter Wohlklang kann Musik, Kirchengeläut oder der Klang von Kuhglocken sein. Rechtlich betrachtet ist Lärm dagegen also «unerwünschter oder schädlicher Schall», zum Beispiel verursacht durch den Strassenverkehr. Vereinfacht dargestellt führt eine höhere Schallintensität nicht zu einer linearen, sondern zu einer logarithmischen Erhöhung des Schallpegels (in Dezibel, dB) und wird vom menschlichen Ohr auf eigentümliche Weise wahrgenommen:
Zunahme Schallintensität
Erhöhung um … Faktor 2 = plus 3 Dezibel
seits musste sich aber auch nicht eine Mehrheit der Probanden stark belästigt fühlen. Die Immissionsgrenzwerte wurden schliesslich bei einer Lärmbelastung festgelegt, bei der die Schwelle zu einer starken Belästigung für 15 bis 25 % der Probanden überschritten war.
BEISPIEL STRASSENVERKEHRSLÄRM
Trotz der Grenzwerte ist gemäss dem Strassenlärmkataster (Stand: 2015) für rund 6300 Personen (17 % der Bevölkerung) in Liechtenstein tagsüber der Immissionsgrenzwert überschritten. In der Nacht betrifft die Grenzwertüberschreitung rund 4100 Personen (11 % der Bevölkerung). Warum ist das so? Der subjektive Charakter des Lärms führt dazu, dass die Verminderung der Lärmbelastung nur mit grossen Anstrengungen möglich ist. So müsste zum Beispiel für eine Halbierung (minus 10 dB) der wahrgenommenen Lärmbelastung an einem bestimmten Standort in Strassennähe die Reduktion der Anzahl an Fahrzeugen in der massgeblichen
Wahrnehmung durch menschliches Gehör
Erhöhung ist … wahrnehmbar
Faktor 3 = plus 5 Dezibel deutlich wahrnehmbar Faktor 10 = plus 10 Dezibel als Verdoppelung wahrnehmbar
→ Erhöhung logarithmisch
IMMISSIONSSCHUTZRECHT
Das Umweltrecht umfasst alle Rechtsvorschriften, die nachteiligen Einwirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen entgegenwirken sollen. Ein wichtiger Aspekt des Umweltrechts ist dabei die Bewahrung des einzelnen Menschen vor schädlichen oder lästigen Immissionen, wie zum Beispiel Luftverunreinigungen und Lärm. Dieses sogenannte Immissionsschutzrecht setzt auf einer ersten Stufe bei Massnahmen an der Quelle, den Emissionen, an. Auf einer zweiten Stufe werden die Emissionsbegrenzungen verschärft, sobald die per Verordnung festgelegten sogenannten Immissionsgrenzwerte überschritten sind oder dies erwartet werden kann. Im Bereich des Lärmschutzes sind Emissionsbegrenzungen zum Beispiel verkehrslenkende, -beschränkende und -beruhigende Massnahmen an Strassen. Die Immissionsgrenzwerte stellen die Schwelle zum «Schädlichen oder Lästigen» dar, sodass im Bereich des Lärmschutzes gemäss dem Umweltschutzgesetz Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung «in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören».
FESTLEGUNG DER GRENZWERTE
Wie werden die Grenzwerte für den Lärmschutz festgelegt, wenn Lärm doch sehr subjektiv ist? Die liechtensteinische Umweltgesetzgebung wurde zwar vom Europarecht geprägt, stellt jedoch weitgehend über den Zollvertrag und in Eigenregie rezipiertes schweizerisches Recht dar. Die Belastungsgrenzwerte der Lärmschutzverordnung entsprechen deshalb den Werten in der Schweiz. Aufgrund der subjektiven menschlichen Wahrnehmung und der unterschiedlichen Lärmarten (zum Beispiel Kreischen) wurden die Immissionsgrenzwerte in der Schweiz auf der Grundlage von soziopsychologischen Erhebungen festgelegt. Probanden wurden dabei verschiedenen Lärmbelastungen ausgesetzt, die sie auf einer Skala von 1 bis 10 (gar nicht, schwach, mässig, stark, sehr stark) bewerten mussten. Wegen der umweltschutzgesetzlichen Vorgabe der erheblichen Störung des Wohlbefindens einerseits durften sich nicht nur einzelne Probanden stark belästigt fühlen. Aufgrund der rechtlichen Vorgabe der Rücksichtnahme auf empfindlichere Personen, wie etwa Kinder, kranke Menschen und ältere Menschen, anderer-
→ Wahrnehmung subjektiv
Zeiteinheit 90 % betragen. Auch die immer beliebter werdenden Elektrofahrzeuge sind bei Geschwindigkeiten von gegen 50 km/h wegen der Eigenschaften des Schalls und unserer Wahrnehmung kaum noch leiser als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren. Zudem lässt das Umweltschutzgesetz bei überwiegenden öffentlichen Interessen bei bestehenden und auch bei neuen Strassen massive Überschreitungen der Grenzwerte zu. Diese Rechtslage wurde schon sarkastisch kommentiert: «Das Umweltschutzgesetz schützt den (Verkehrs-)Lärm und nicht die Menschen» (Peter Ettler, Lärmliga Schweiz). Mit einem ausgeprägten Verzicht auf den motorisierten Strassenverkehr ist auch in Zukunft nicht zu rechnen, weil eben das öffentliche Interesse daran überwiegend ist. Zumindest schreibt das Umweltschutzgesetz aber im Fall der überschrittenen Grenzwerte für betroffene Gebäude das Anbringen von Schallschutzfenstern oder ähnliche bauliche Massnahmen vor.
Dr. iur. Cyrus Beck, Forschungsbeauftragter Recht am Liechtenstein-Institut
Quellen
– Griffel, A. (2019): Umweltrecht. In a nutshell, 2. Aufl., Zürich/ St. Gallen: Dike. – Lerch, R. et al. (2009): Technische Akustik. Grundlagen und Anwendungen, Berlin: Springer. – Raschauer, B.; Ennöckl, D. (2019) Umweltrecht Allgemeiner Teil, in: D. Ennöckl et al. (Hg.), Handbuch Umweltrecht, 3. Aufl., Wien: Facultas, S. 19 ff. – VGH 2009/143, abrufbar unter: https://www.gerichtsentscheidungen.li – Websites: http://geodaten.llv.li; https://www.gesetze.li; https://www.laermliga.ch; https://www.llv.li/inhalt/12185/amtsstellen/ strassenlarmkataster; https://www.statistikportal.li

13 LIECHTENSTEIN-INSTITUT
Quantitative Ansätze in der Geschichtswissenschaft basieren insbesondere auf statistischen Daten. Indes sind auch diese numerischen Daten keineswegs gegeben, bilden nicht einfach Wirklichkeit ab, sondern sind Ausdruck von Wissensordnungen, durch die auf die Wirklichkeit geblickt wird: Statistik bezeichnet nicht nur das Datenmaterial, sondern immer auch Methoden zur Herstellung von Datenmaterial. Der Beitrag blickt auf die Geschichte und die Bedeutung von Statistiken für die historische Forschung am Beispiel der Sozialgeschichte.
1971 pries François Furet einflussreich die Vorzüge der quantitativen beziehungsweise seriellen Geschichte. Zu den Vorzügen zählte er den Umstand, dass diese Art der Wissensgenerierung einen besseren Zugang zum Kerngegenstand geschichtswissenschaftlicher Forschung biete: der Zeit, genauer der «diachronen Dimension der Erscheinungen». Das Jahrzehnt der maximalen Annäherung der Geschichtswissenschaft an die Sozialwissenschaften mit ihren Methoden und Theoriebildungsansprüchen war angebrochen. Die Quellen dieser Art von Geschichtsschreibung waren wesentlich statistischer Natur.
STATISTIK IN DER GESCHICHTSWISSENSCHAFT
In der Geschichtswissenschaft sind sich in der Regel selbst vehemente Verfechter der quantitativen Geschichte der Grenzen statistischer Zugänge zum Verständnis der Vergangenheit bewusst gewesen. So konzedierte Furet einen «unbehebbaren» Mangel an entsprechenden Daten, der es verunmöglichte, wichtige Teile der Vergangenheit zu analysieren. Und er stellte «eine grundsätzliche Unreduzierbarkeit der qualitativen Natur» vieler untersuchter historischer Phänomene nicht in Abrede. Umgekehrt haben auch dezidierte Kritiker umfassender Bestrebungen, mittels statistischer Daten historische Prozesse zu erklären, selten den Nutzen dieser Quellen grundsätzlich negiert. Über hundert Jahre vor Furet hatte etwa Johann Gustav Droysen nach einer ausführlichen kritischen Besprechung des Versuchs eines englischen Kollegen, auf der Basis von Statistiken Gesetzmässigkeiten historischer Prozesse zu formulieren, gleichwohl den «grossen Wert» einer «statistische[n] Betrachtungsweise der menschlichen Dinge» bekräftigt: «aber man muss nicht vergessen, was sie leisten kann und leisten will.»
Zwar teilten die moderne Geschichtsschreibung und die moderne Statistik ihren entscheidenden Entstehungszusammenhang im Aufkommen des Nationalstaates im 19. Jahrhundert, entwickelten sich aber gleichwohl auseinander. Näher
kamen sie sich erst wieder in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Aber auch dann haben Historiker und Historikerinnen selbst numerische Daten selten einfach als das «Gegebene» (datum) verstanden und nach dem Zustandekommen statistischer Angaben gefragt. Im Zuge der kulturhistorischen Überformung und Erweiterung der Sozialgeschichte ab den 1980er- und 1990er-Jahren ist dann das Wissen um die – auch von Historikern wie Furet betonte – Konstruiertheit dieser Datensammlungen zur landläufigen Einsicht vertieft und verbreitert worden, dass Statistiken zuvorderst als Ausdruck bestimmter Wissensordnungen zu behandeln sind, von denen aus Wirklichkeit betrachtet wird.
Die Geschichtswissenschaft hat sich immer wieder auf historische Statistiken als Quellen gestützt. Die eigene Anwendung statistischer Methoden zur Analyse historischer Daten spielt demgegenüber bis heute, trotz der unterdessen vorhandenen technischen Möglichkeiten, für Historikerinnen und Historiker nur eine untergeordnete Rolle. Am namhaftesten auf statistisches Datenmaterial gestützt hat man sich in den disziplinären Teilbereichen der Wirtschafts- und der Sozialgeschichte. Auch wenn die enge Beziehung von wirtschaftshistorischen Erkenntnisinteressen und quantifizierenden Zugängen zur Geschichte selbstverständlicher erscheinen mag, liegen die Ursprünge der Statistik auf dem Zuständigkeitsgebiet der Sozialgeschichte.
STATISTIK (SOZIAL)HISTORISCH
Es war die zahlenmässige Erfassung der Bevölkerung, die die erste Kernaufgabe der Statistik bildete. Die Volkszählung war gleichsam die Grundform statistischer gesellschaftlicher Selbstbetrachtung beziehungsweise umfassender staatlicher Generierung quantitativer Daten über die Bevölkerung zu deren effizienteren Verwaltung. Volkszählungen reichen weit vor die Moderne zurück und machen dabei – etwa am chinesischen, japanischen oder osmanischen Beispiel – deutlich, dass die Vorstellung einer europäischen
SOZIALGESCHICHTE UND
STATISTIK
14 LIECHTENSTEIN-INSTITUT
Vorreiterschaft in statistischen Belangen mindestens zu differenzieren ist. Indes lässt sich diskutieren, inwiefern die reine listenförmige Registrierung der Bevölkerung für einen derart spezifischen Zweck wie die Steuererhebung im engeren Sinn als Statistik zu verstehen ist. Wenn es bei der Statistik darum geht, Daten zu produzieren, die mathematisch auswertbar in verschiedene Beziehungen gesetzt werden können und ein quantitatives Bild wesentlicher Teilbereiche des gesellschaftlichen Lebens ergeben sollen, so begann sie sich in diesem modernen Sinn erst im späten 18. Jahrhundert zu entwickeln. Statistik war ihrer ursprünglichen Wortbedeutung nach Staatsbeschreibung.
Die Selbstbeobachtung des Staates beziehungsweise die Beobachtung der Gesellschaft durch den zunächst noch im Werden begriffenen Nationalstaat stand indessen nicht in jedem Fall an den Wurzeln der Statistik. Auch im Kontext der europäischen Entwicklungen gab es Staaten, für die der statistische Blick auf sich selber lange Zeit kaum Bedeutung besass. So begann man in Liechtenstein die eigene Bevölkerung erst auf äussere Nachfrage zu zählen: Bis das Fürstentum als Teil des Rheinbundes ab 1806 und des Deutschen Bundes ab 1815 Zahlen zur Grösse der eigenen Bevölkerung vorlegen musste, damit der Umfang des liechtensteinischen Militärkontingents berechnet werden konnte, hatte die Obrigkeit keine genauen Volkszählungen durchführen lassen.
Das liechtensteinische Beispiel zeigt auch in der Folge, dass es – bisher wenig beachtete – markante Abweichungen von der allgemeinen Entwicklung des Statistikwesens in Europa gab. Gesetzliche Grundlagen für Volkszählungen existierten in Liechtenstein lange Zeit nicht oder wurden ignoriert. Erst ab 1891 wurde im regelmässigen Abstand von zehn Jahren eine Zählung durchgeführt. Zu dieser Zeit besassen die allermeisten europäischen Länder bereits ihre statistischen Ämter, teilweise schon seit Jahrzehnten. Eine solche Institutionalisierung der statistischen Datenproduktion und -auswertung vollzog sich in Liechtenstein demgegenüber erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Ob nun der notorisch geltend gemachte Ressourcenmangel oder doch eher die ausserordentliche Überschaubarkeit der Verhältnisse im Kleinststaat für den Sonderfall verantwortlich war: Statistisches Quellenmaterial zur Beantwortung quantitativer sozialhistorischer Fragen ist selbst zur modernen Geschichte Liechtensteins noch deutlich spärlicher ist als in anderen Kontexten. Insbesondere im 19. Jahrhundert waren die Schwierigkeiten für Staaten, ihre Bevölkerung annähernd verlässlich zu zählen, erheblich. Besonders gefordert waren grosse Staaten, allen voran die Vielvölkerreiche. Fehlerquellen brauchten jedoch nicht unbedingt organisatorischer oder methodischer Natur zu sein, sie konnten auch unmittelbare politische Ursachen besitzen: So korrigierte etwa die fürstliche Hofkanzlei Bevölkerungszahlen im frühen 19. Jahrhundert nach unten, um das liechtensteinische Militärkontingent möglichst klein zu halten. Überall wird die Verwertbarkeit von historischen Zensusdaten vom Umstand eingeschränkt, dass die Volkszählungen über die Zeit mit wechselnden Kriterien durchgeführt wurden – in Liechtenstein wurde etwa bis in die 1860er-Jahre einfach die Wohnbevölkerung erfasst, nicht die Staatsangehörigen, wie es danach der Fall war.
DAS BEISPIEL DER KRIMINALSTATISTIKEN
Weil sie mit dem Versprechen einer effizienten Steuerung gesellschaftlicher Prozesse verbunden war, weitete sich die statistische Erfassung von Daten in verschiedenen europäischen Ländern schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf ganz unterschiedliche Bereiche aus. Die Methoden einer sich dynamisch entwickelnden Mathematik nährten zudem die Idee, über die statistische Vermessung der Gesell-
August Friedrich Wilhelm Crome: Geographisch-statistische Darstellung der Staatskräfte, von den sämmtlichen, zum deutschen Staatenbunde gehörigen, Ländern, Leipzig 1828. Der Artikel zu Liechtenstein (S. 285–294) enthält eine der ersten statistischen Darstellungen zu Liechtenstein überhaupt. Hierin findet sich auch die von der Hofkanzlei nachweislich zu tief angesetzte Bevölkerungszahl für Liechtenstein. (Titelseite: Liechtensteinisches Landesarchiv, LI LA MX 234).

schaft Gesetzmässigkeiten im sozialen Leben erkennen und so auf diese Einfluss ausüben zu können. Delinquenz gehörte stets zu den zentralen gesellschaftlichen Problemfeldern und wurde entsprechend früh von statistischen Anstrengungen erfasst.
Die modernen Anfänge der Kriminalstatistik fallen mit der Transformation des Gefängnisses zum zentralen Instrument des Strafens im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert zusammen. Diese Anfänge waren rudimentär und bestanden im Wesentlichen im systematischen Aufnehmen der Personalien der Inhaftierten beim Eintritt in die Strafanstalten. Auf diese Weise konnten wenigstens gewisse Wiederholungstäter und -täterinnen identifiziert werden, was ein zentrales Anliegen von Kriminologen und Pönologen war und geblieben ist. Die statistischen Verfahren wurden mit der Zeit immer elaborierter. Gleichwohl muss man nicht zu den Kriminalstatistiken des 19. Jahrhunderts zurückgehen und es bedurfte auch nicht des Blicks kulturhistorisch informierter Sozialhistorikerinnen und -historiker, um die Aussagekraft der statistischen Daten zur Kriminalität kritisch zu hinterfragen. Das taten vielfach bereits Zeitgenossen.
15 LIECHTENSTEIN-INSTITUT
So zeigte in der Mitte des 20. Jahrhunderts Leon Radzinowicz, der vielleicht eminenteste Kriminologe seiner Zeit, anhand des englischen Beispiels im Detail die Probleme der Kriminalstatistiken auf: Bei Weitem nicht alle Verbrechen wurden den Behörden gemeldet und es war zudem davon auszugehen, dass sich die Anteile der nicht registrierten Delikte über die Zeit veränderten. Die Erhebungsmethoden variierten nicht nur über die Zeit, sondern auch zwischen verschiedenen Orten, selbst innerhalb des Landes. Es bestand eine erhebliche Differenz zwischen dem, was von einem rechtsdogmatischen und entsprechend statistisch relevanten Gesichtspunkt aus als Kriminalität galt, und dem, was von einem gesellschaftlichen Standpunkt aus als solche angesehen wurde. Zudem mussten Delikte nicht nur registriert, sondern auch klassifiziert werden, um statistisch nützliche Daten zu produzieren. Dies musste neben den zwangsläufigen uneindeutigen Fällen gerade auch aufgrund sich wandelnder Kategorien und Kriterien die Aussagekraft der Statistiken noch einmal massgeblich mindern. Radzinowicz meldete erhebliche Vorbehalte gegenüber der Akkuratheit der zeitgenössischen Kriminalstatistiken an – was auch die serielle Verwertbarkeit der Daten betreffen musste, «making the comparison of the data of criminal statistics extremely difficult, often practically impossible».

Die kulturhistorische Erweiterung der Sozialgeschichte hat die Bedeutung statistischer Daten für die Geschichtswissenschaft weniger zurückgedrängt als verändert. Während die Wirtschaftsgeschichte nach wie vor prominent mit seriellen Daten arbeitet, sind quantifizierende Zugänge in der Sozialgeschichte keineswegs obsolet geworden, in ihren Versprechen für den historischen Erkenntnisgewinn aber redimensioniert worden. Gleichzeitig haben Statistiken für andere Fragestellungen an Relevanz gewonnen. So ist man heute beispielsweise zurückhaltender, auf der Grundlage archivierter Statistiken Aussagen über Rückfallquoten von bestraften Kriminellen in der Vergangenheit zu machen. Dafür stellt man sich eher Fragen wie die, welche Rolle solche Statistiken in den Diskussionen über Gefängnisreformen gespielt haben. Somit hat Droysens Empfehlung aus dem 19. Jahrhundert für den Umgang der Geschichtswissenschaft mit statistischen Daten nichts an Angemessenheit eingebüsst, lässt sich aber unterdessen ergänzen. Es ist gut darauf zu achten, was Statistiken konnten und was sie wollten – das Bewusstsein dafür, dass dies nicht dasselbe gewesen ist, ist unter Historikerinnen und Historikern seit Droysens Zeiten sicher noch gewachsen. Von erheblichem sozialhistorischem Interesse sind aber auch die Fragen, wie Statistiken verwendet worden sind und, verbunden damit, welche Wissensordnungen sich in ihnen manifestierten. Diese Fragen werden schon seit rund drei Jahrzehnten immer mehr gestellt. Dennoch bergen sie nach wie vor ein grosses sozialhistorisches Erkenntnispotenzial.
Entwicklung der Statistik in Liechtenstein
Die ältesten Bevölkerungszahlen Liechtensteins datieren vom Jahr 1584 . Es werden Feuerstätten (für Haushalte) und Leibeigene sowie Untertanen (für Einwohner) ausgewiesen. Im Total werden 2656 Einwohner gezählt, Triesenberg hat am meisten Einwohner. Es ist unklar, ob die gesamte Bevölkerung erfasst war oder nur die Fronpflichtigen.
Gezielte statistische Erhebungen erfolgen ab 1784 in Form von Volkszählungen. 1806 wird Liechtenstein in den Rheinbund aufgenommen. Es ist fortan verpflichtet, seine Bevölkerungszahl auszuweisen. Diese bildet die Grundlage für die Berechnung des Militärkontingents, welches Liechtenstein dem Rheinbund und später dem Deutschen Bund stellen muss. Die Zahlen sind tendenziell zu tief.
Die längste Zeitreihe in der Landwirtschaftsstatistik reicht bis ins Jahr 1812 zurück. Damals gab es in Liechtenstein 4377 Stück Vieh bei 5797 Einwohnern. Heute kommen auf über 39 000 Einwohner knapp 6000 Stück Vieh.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts erfolgt die Erstellung von Statistiken zu Gewerbe und Industrie, Handel, Forstwesen, Post- und Telegrafenwesen, Fremdenverkehr, Feuerversicherung, Stickerei, Holzausfuhr, Vieheinfuhr und -ausfuhr und Rheinkiesentnahme.
Seit 1930 werden die Volkszählungen im Zehnjahresrhythmus nach dem Schweizer System vorgenommen. Die Datenqualität erhöhte sich damit stark. Neben Geschlecht, Alter und Zivilstand werden auch weitere Angaben wie Religion, Beruf und Staatsangehörigkeit erfasst.
Mitte des 20. Jahrhunderts wird die Statistik in Liechtenstein institutionalisiert. So werden 1943 bei der Regierungskanzlei statistische Arbeiten für die Familienzu lagen, später auch für die Alters- und Hinterlassenenrenten aufgenommen. 1950 wird das Amt für Kinderhilfe und Statistik errichtet, das 1956 in Amt für Statistik umbenannt wird. Nachdem das Amt zwischenzeitlich ins Amt für Volkswirtschaft eingegliedert war, ist es seit 2009 wieder als eigenständiges Amt organisiert.
2021 veröffentlicht das Amt für Statistik 79 statistische Publikationen. Es kommen immer wieder neue Themen hinzu, beispielsweise die Indikatoren der nachhaltigen Entwicklung oder die Gleichstellung von Mann und Frau.
Auch das Liechtenstein-Institut erhebt regelmässig statistische Daten – meist auf der Basis von Umfragen. So wird z. B. seit 2019 regelmässig die Lebenszufriedenheit der liechtensteinischen Bevölkerung auf einer Skala von 0 (voll und ganz unzufrieden) bis 10 (voll und ganz zufrieden) erfasst. Die jüngste Erhebung von Juni 2022 zeigt, dass die durchschnittliche Lebenszufriedenheit in Liechtenstein – wohl aufgrund der Eindrücke des Kriegs in der Ukraine und diverser anderer Krisen – im Vergleich zu 2020 von 7.7 auf 6.6 relativ stark zurückgegangen ist.
Christian Frommelt
Quellen
– Droysen, J. G. (1863): Die Erhebung der Geschichte in den Rang einer Wissenschaft, in: Historische Zeitschrift, 9, S. 1–22.
– Furet, F. (1971): Quantitative History, in: Daedalus, 100, S. 151–167.
– Radzinowicz, L. (1945): English Criminal Statistics. A Critical Analysis, in: L. Radzinowicz / J. W. C. Turner (Hg.): The Modern Approach to Criminal Law. London: Macmillan, S. 174–194.
Quellen
Historisches Lexikon des Fürstentums Liechtenstein online (eHLFL) Statistikportal.li Lie-Barometer 2022
PD Dr. Stephan Scheuzger, Forschungsbeauftragter Geschichte am Liechtenstein-Institut
16 LIECHTENSTEIN-INSTITUT
THEORIEN AUF DEM EMPIRISCHEN PRÜFSTAND: Wie funktioniert eine «TÜV-Prüfung» in
der Wissenschaft?
Empirische Wissenschaften, also Erfahrungswissenschaften, zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Aussagen aus der Erfahrung gewonnen werden. Das unterscheidet Erfahrungswissenschaften von reinen Vernunftwissenschaften wie der Mathematik oder der Logik, deren Lehrsätze nicht aus der Erfahrung gewonnen und überprüft werden, sondern auf dem «reinen Denken» beruhen. Aber wie erfolgt dieser empirische Erkenntnisgewinn konkret und wie überprüft man theoretische Aussagen empirisch?



WAS IST EIGENTLICH EINE THEORIE?
Am Anfang einer Theorie steht stets irgendeine Erfahrung, beispielsweise eine Beobachtung. Es heisst, dass Isaac Newton beobachtete, wie ein Apfel von einem Baumstamm fiel, und er daraus das Gravitationsgesetz entwickelte. Ob wahr oder nicht, der Punkt dabei ist, dass eine Erfahrung (im Sinne einer Beobachtung der Natur) einer Theorie (meist) vorausgeht. Theorien werden sodann entwickelt, um gewisse empirische Phänomene zu beschreiben und zu erklären. The orien sind Aussagensysteme, die mindestens aus zwei vonei nander ableitbaren Aussagen – beispielsweise Hypothesen –bestehen. Meist jedoch sind es deutlich mehr als bloss zwei Aussagen. Die ökonomische Theorie der Politik beispielswei se ist ein theoretisches Rahmenwerk, welches im Kern ein bestimmtes, stark verallgemeinertes Menschenbild enthält (den homo oeconomicus, also den rationalen, egoisti schen Nutzenmaximierer), daneben aber auch weitere Prämissen und Axiome (zum Beispiel: Menschen wollen zunächst ihren Nutzen maximieren, sind aber nie vollständig informiert). Ergänzt werden diese Axiome durch theoretische Konzepte, an denen Definitionen hängen. So liesse sich bei spielsweise die Nutzenoptimierung dadurch definieren, dass das Individuum jene Hand lungsoption favorisiert, die zuoberst auf sei ner Präferenzordnung steht. Auch enthalten Theorien immer auch Hypothesen, die ei nen empirisch überprüfbaren Zusammen hang postulieren. Eine berühmte Hypothe se von Anthony Downs, dessen «An Economic Theory of Democracy» das wahrscheinlich am häufigs ten zitierte Werk in den Politikwissenschaften überhaupt ist, besagt, dass sich Parteien in einem Zweiparteien system programmatisch den politischen Überzeu gungen des Medianwählers annähern, weil dort das
grösste Stimmenpotenzial ist. Eine solche Hypothese ergibt sich logischerweise aus den Axiomen der ökonomischen Theorie. Und just diese Hypothesen sind es auch, die sodann empirisch überprüft werden. Damit sei nicht gesagt, dass sich die abstrakteren Axiome einer Theorie (z. B. das Menschenbild) empirisch prinzipiell nicht überprüfen liessen. Aber meist braucht es eine Konkretisierung dieser abstrakten Aussagen, um sie überprüfen zu können. Darauf werden in der Regel Hypothesen, die sich an der Peripherie eines Theoriegebäudes (und nicht im Kern) befinden, überprüft. Im Prinzip sind Hypothesen empirische Erwartungsaussagen, also Aussagen darüber, was man in der empirischen «Realität» erwarten darf, wenn die Theorie zutreffen sollte. Im Idealfall würden wir diese Aussagen vor der Erhebung oder Beobachtung selbst formulieren. Natürlich liessen sich auch empirische
17 LIECHTENSTEIN-INSTITUT
Erwartungen formulieren, die – sollte die Theorie zutreffen –nicht eintreten sollten. Das ist in den (Sozial-)Wissenschaften (leider) selten – zu gross ist wahrscheinlich die Gefahr, dass just dieses, in der Theorie nicht für möglich gehaltene Szenario am Ende eben doch eintritt.
REALITÄT UND REALITÄTSBEHAUPTUNGEN
Aber selbst die empirische Überprüfung von konkreten empirischen Erwartungen ist ein komplexes Unterfangen. Denn wir können die Theorie nicht unmittelbar mit der Realität konfrontieren, sondern bloss mit Aussagen über die Realität, die aber ihrerseits Verzerrungen aufweisen könnten. Die Wissenschaft hat sich hier mit einer konventionalistischen Lösung beholfen: Die Protokollierung der Realität soll möglichst präzise und transparent erfolgen, sodass eine wiederholte Überprüfung (mit neuen Daten) stets möglich ist.
EIN BEISPIEL: DIE ABSTIMMUNG ÜBER DIE FRANCHISE-BEFREIUNG VOM 26. JUNI 2022
Spielen wir doch diesen Überprüfungsprozess an einem einfachen Beispiel durch: die Abstimmung über die DpL-Initiative zur Franchise-Befreiung von Rentnerinnen und Rentnern, die am 26. Juni 2022 stattfand. Die ökonomische Theorie der Politik geht vom Menschenbild des egoistischen Nutzenoptimierers aus. Nun ist es bei einer Sachabstimmung aber nicht immer so einfach zu sagen, worin der «Nutzen» für das einzelne Individuum genau liegt (mal abgesehen davon, dass es womöglich einen Unterschied zwischen der «objektiven» Wahrnehmung des Wissenschaftlers oder der Wissenschaftlerin und der subjektiven Wahrnehmung der Stimmberechtigten gibt). Im Falle der DpL-Initiative könnte man den Nutzen indessen als «kurz- oder mittelfristigen finanziellen Nutzen» definieren. Also: Wer profitiert von der Annahme der Initiative und wer nicht? Bereits diese Definition ist nicht unumstritten. Wird der «Nutzen» einer Abstimmung tatsächlich immer nur kurz- oder mittelfristig bemessen? Und bezieht er sich tatsächlich stets auf die eigene finanzielle Situation? Aus der ökonomischen Theorie der Politik geht dies beispielsweise nicht klar hervor. Konkret auf den Abstimmungsfall bezogen: Grosseltern oder Eltern sehen möglicherweise den Nutzen bei einer Abstimmung darin, im Sinne ihrer Enkel oder Kinder abzustimmen. Diese
Überlegungen demonstrieren primär, dass Theorien keine exakte Abbildungen der Realität sind, sondern – ähnlich wie beispielsweise ein Flugzeugmodell – die zentralen Merkmale eines empirischen Phänomens in reduzierter Form abbilden wollen. Anders formuliert: Man soll von Erklärungen bzw. Theorien auch nicht zu viel erwarten.
WELCHES STIMMVERHALTEN IST BEI DER FRANCHISE-ABSTIMMUNG VOM HOMO OECONOMICUS ZU ERWARTEN?
Zur Abstimmung vom 26. Juni 2022: Die Initiative verlangte, dass die in Liechtenstein wohnhaften Menschen im ordentlichen Rentenalter von der Franchisenzahlung befreit werden. Wenn die Axiome der ökonomischen Theorie der Politik zutreffen, dann dürften wir Folgendes erwarten:
1. Rentner und Rentnerinnen nehmen die DpL-Initiative viel eher an als solche, die noch nicht im ordentlichen Rentenalter sind. Wir könnten hier gar einen Schritt weitergehen und aufgrund der obigen Überlegungen postulieren, dass kinderlose Rentner und Rentnerinnen die DpL-Initiative eher annehmen als solche mit Kindern und Enkeln. Allerdings wurde in der Nachbefragung nicht nach der Anzahl Kinder gefragt.
2. Die Zustimmung steigt, je näher man am ordentlichen Rentenalter ist. Ein Individuum, welches kurz vor der Pensionierung steht, dürfte einen deutlich grösseren finanziellen Anreiz haben, der Initiative zuzustimmen, als jemand, der noch jung ist.
3. Einkommensschwache sollten der Initiative ebenfalls stärker zustimmen als Vermögende, sofern die ökonomischen Prämissen zutreffen.
Nochmals: Ob der Mensch ein rationaler Nutzenmaximierer ist, lässt sich nur schwerlich überprüfen, weil die in dieser Behauptung formulierten Begriffe noch wenig konkret sind. Aber die obigen drei Hypothesen lassen sich empirisch leicht überprüfen. Trivial ist diese Überprüfung indessen auch nicht. Man muss ja zunächst eine Messung vornehmen, das heisst, das Abstimmungsverhalten, das Alter, die Anzahl Kinder (und Enkel) und das Einkommen messen. Dabei sind Fehler durchaus möglich: Vielleicht erinnert sich
THEORETISCHE ANSÄTZE ZUR ERKLÄRUNG DES WAHL- UND ABSTIMMUNGSVERHALTENS
Soziologischer Ansatz
Dieser Ansatz gilt als der älteste Ansatz. Er postuliert eine soziostrukturelle Prägung des menschlichen Handelns im Allgemeinen (und des politischen Verhaltens im Speziellen). Geschichte wird demnach nicht von einzelnen Menschen gemacht, sie wird vielmehr von Strukturen bestimmt und die Wahlentscheidung lässt sich mit Merkmalen wie Lebensalter, Geschlecht oder dem sozialen Kontext erklären.
Sozialpsychologischer Ansatz
Der zweite grosse Ansatz ist eine Weiterentwicklung des soziologischen Ansatzes. Der wesentliche Unterschied zum soziologischen Modell besteht darin, dass in diesem Ansatz nicht mehr von einer direkten Verknüpfung zwischen Sozialstruktur und politischem Verhalten ausgegangen wird, sondern ein intermediärer psychologischer Variablenkomplex angenommen wird. Bürgerinnen und Bürger wählen jene Partei, mit der sie sich am stärksten identifizieren – unge achtet dessen, ob man bei allen Sachfragen mit der Position dieser Partei einverstanden ist.
Weitere Ansätze
Der dritte grosse Ansatz ist die oben bereits vorgestellte ökonomische Theorie der Politik. Daneben existiert indessen noch eine Vielzahl weiterer Modelle, die bestimmte Aspekte des politischen Verhaltens beleuchten. Beispielsweise kognitionspsychologische Modelle, die auf den individuellen Meinungsbildungsprozess fokussieren. Ihr Ziel besteht darin, aufzuzeigen, welche Informationen aufgenommen werden, wie sie verarbeitet und in ein bestehendes Überzeugungssystem integriert werden und wie daraus eine individuelle Haltung gebildet wird.
18 LIECHTENSTEIN-INSTITUT
jemand nicht mehr so genau, wie sie/er abgestimmt hat. Vielleicht wird das Haushaltseinkommen absichtlich zu knapp angegeben. Möglicherweise hat jemand ein geringes Haushaltseinkommen, ist aber – aus welchen Gründen auch immer – gleichwohl vermögend. Das «Haushaltseinkommen», also das, was wir in Umfragen messen, wäre dann eine «schlechte» Messung dessen, was wir eigentlich – auf theoretischer Ebene – messen wollen: die finanzielle Situation des Individuums. Aber: Wo eine Messung vorgenommen wird, werden immer auch Messfehler begangen. Wissenschaft weist deshalb inhärent immer auch eine Unsicherheit auf. Dies gilt es bei der Interpretation stets zu berücksichtigen.
WAS HEISST «PROBABILISTISCH»?
Wenn wir die Resultate der Umfrage zur Franchisen-Initiative betrachten, so stellen wir fest, dass sich alle Erwartungen erfüllen. Natürlich nicht deterministisch, das heisst: Nicht alle Rentnerinnen und Rentner haben das Begehren gutgeheissen. Aber probabilistisch ist die oben genannte Erwartung erfüllt worden. Rentner und Rentnerinnen haben die Initiative deutlich häufiger angenommen als Stimmberechtigte im Erwerbsalter. Was heisst das? Sind die Stimmberechtigten Liechtensteins rationale, egoistische Nutzenmaximierer? Ist dies ein für alle Mal «bewiesen»? Nein, die Zustimmung oder Ablehnung der Vorlage kann auch aus anderen Gründen erfolgen – einmal ganz abgesehen davon, dass ja längst nicht alle Rentnerinnen und Rentner zugestimmt und längst nicht alle Erwerbstätigen Nein gesagt haben. Denkbar wäre, dass Junge der Empfehlung der Grossparteien gefolgt sind, weil sie zum Beispiel nur schlecht informiert waren über den Vorlageninhalt. Es gibt noch eine Vielzahl weiterer Abstimmungsgründe, die nicht egoistischer Natur sind. Es sei hier angemerkt, dass die Parolenbefolgung zumindest ein rationales, unter Umständen gar egoistisches Motiv sein könnte. Schliesslich gibt es noch weitere Theorien, die andere Aspekte des Stimmverhaltens unter Umständen besser erklären können. Aber wir können immerhin sagen, dass das Abstimmungsverhalten den Annahmen der ökonomischen Theorie der Politik nicht widerspricht. Der Liechtensteiner und die Liechtensteinerin stimmen an der Urne – wie alle anderen Menschen – auch rational ab und denken
dabei zwar nicht nur, aber auch an ihre Vorteile. Nutzenmaximierung klingt zwar wenig schmeichelhaft, ist aber völlig normal – es gibt in der Natur kein Lebewesen, der sich selbst absichtlich schaden möchte.
WAS KÖNNEN THEORIEN LEISTEN UND WAS NICHT?
Die Hypothesen wurden demnach zwar nicht verifiziert, aber sie haben den Falsifikationstest überstanden. Die Theorie ist also weiterhin «im Spiel» und (noch) nicht an der Wirklichkeit gescheitert. Dieses Verständnis oder dieses Prinzip nennt Karl Popper das «Falsifikationsprogramm» der Wissenschaft. Wir können Hypothesen nicht verifizieren – das geht alleine logisch nicht. Aber Hypothesen können scheitern. Wenn Hypothesen auf dem empirischen Prüfstand durchfallen, ist eine Revision der Theorie erforderlich. Wenn sie indessen nicht scheitern, so dürfen wir dies als Indiz auffassen, dass an der Theorie etwas dran ist. Weitere, schärfere empirische Überprüfungen können dann dazu führen, dass sich die Theorie «bewährt». Wissenschaft ist also – bis zu einem gewissen Grad – stets unsicher und unterliegt einem ständigen Überprüfungsprozess. Aber dieser Prozess gewährleistet, dass sich die wissenschaftliche Erkenntnis prozesshaft mehrt.
Dr. Thomas Milic, Forschungsbeauftragter Politik am Liechtenstein-Institut
Quellen
– Milic, T.; Rochat, P. (2022): Volksabstimmung «Franchise-Befreiung» vom 26. Juni 2022. Ergebnisse einer Online-Umfrage. Liechtenstein-Institut. Gamprin-Bendern (LI Aktuell 1/2022). – Downs, A. (1957): An Economic Theory of Democracy, New York: Harper & Brothers.

50–53J. 46–49J. 42–45J. 38–41J. 34–37J. 30–33J. 26–29J. 22–25J. 18–21J. 54–57J. 58–61J. 62–65J. 66–69J. 70–73J. 74–77J. 78–81J. >81J. 24 50 % 35 26 42 52 48 44 46 54 63 76 74 82 76 65 91 90 ABSTIMMUNG FRANCHISE-BEFREIUNG VOM 26. JUNI 2022: JA-STIMMEN-ANTEIL NACH ALTER IN % 19 LIECHTENSTEIN-INSTITUT
INTERNATIONALE IMPLIKATIONEN DES LIECHTENSTEINISCHEN DATENSCHUTZRECHTS
Datenschutz, also der Schutz personenbezogener Daten, ist ein Grundrecht. Viele stellen sich darunter den Schutz vor Überwachung durch Kameras oder den Schutz besonders sensibler Daten wie z. B. Gesundheitsdaten vor. Viele Daten werden aber auch im Ausland verarbeitet oder gespeichert. Wie steht es also um den grenzüberschreitenden Schutz unserer Daten? Sind wir ausländischen Medienunternehmen und Plattformen einfach schutzlos ausgeliefert?
Der Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten ist ein Grundrecht, das insbesondere in der Europäischen Menschenrechtskonvention und in einem Übereinkommen des Europarats verankert ist. Dieses Recht garantiert im Wesentlichen, dass personenbezogene Daten nur – und immer – rechtmässig, nach Treu und Glauben und auf transparente Weise erhoben, verarbeitet und gespeichert werden dürfen.
Gleichzeitig steigen mit der Digitalisierung und Integration der europäischen Gesellschaften sowohl die Nachfrage nach der Verarbeitung personenbezogener Daten als auch das Volumen des grenzüberschreitenden Datenverkehrs. Gesellschaftliche Herausforderungen, z. B. im Bereich der öffentlichen Gesundheit, und neue Technologien wie die künstliche Intelligenz beeinflussen auch die Entwicklungen im Bereich des Datenschutzes. In diesem Zusammenhang trägt die Regelung des Schutzes personenbezogener Daten auf EWREbene zur Verwirklichung eines echten Binnenmarktes bei und gewährleistet gleichzeitig, dass die Grundrechte des Einzelnen gewahrt bleiben.
LIECHTENSTEINISCHE DATENSCHUTZGESETZGEBUNG
Liechtenstein hat, nach langwierigen Vorarbeiten, erst 2002 ein erstes Datenschutzgesetz erlassen. Dieses diente im Wesentlichen der Umsetzung der EU-Datenschutzrichtlinie. Den vorstehend erwähnten rasanten Entwicklungen genügte diese jedoch bald nicht mehr. Unternehmen oder Betroffene konnten immer weniger rechtssicher feststellen, wer als Verantwortlicher dafür sorgen muss, dass Daten rechtmässig verarbeitet werden. Auch die Regeln über die Voraussetzungen, unter denen Daten grenzüberschreitend verarbeitet
werden dürfen, waren ungenügend. Die nationale Fragmentierung des Datenschutzrechts erschwerte dabei die effektive Rechtsdurchsetzung durch Betroffene. Wurden beispielsweise Daten grenzüberschreitend in einer Cloud verarbeitet, unterlagen diese Prozesse oft nicht dem bekannten Recht ihrer Heimatstaaten.
Mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wurde das europäische Datenschutzrecht einer grundsätzlichen Revision unterzogen. Durch die DSGVO wurde ein neuer Rechtsrahmen geschaffen, welcher in den EWR-Staaten grundsätzlich unmittelbar anwendbar ist. Allerdings lässt die DSGVO den Mitgliedstaaten trotz aller Harmonisierungsbestrebungen aber Raum für eigene Wertentscheidungen und sieht dafür sogenannte Öffnungsklauseln in Form von Wahlrechten vor. Diese geben den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, mit nationalen Regeln die Vorgaben aus der DSGVO zu konkretisieren bzw. auszugestalten. Am 1. Januar 2019 trat in Liechtenstein ein neues Datenschutzgesetz in Kraft, welches den Anforderungen des neuen europäischen Rechtsrahmens entsprach.
GRENZÜBERSCHREITENDER DATENSCHUTZ
In dem hier interessierenden Zusammenhang besonders bedeutsam ist die Bestimmung, welche die Europäische Kommission befugt, zu bestimmen, ob ein Land ausserhalb des EWR ein angemessenes Datenschutzniveau aufweist.
Ein solcher Äquivalenzentscheid hat zur Folge, dass personenbezogene Daten aus der EU und den drei EWR/ EFTA-Staaten in das betreffende Drittland übermittelt werden können, ohne dass weitere Schutzmassnahmen erforderlich sind. Länder, welche hinsichtlich ihres Datenschutzniveaus als gleichwertig angesehen werden, sind derzeit Andorra, Argen-
AUSGEWÄHLTE MEILENSTEINE IN DER ENTWICKLUNG DES DATENSCHUTZES
1970 1978 1995
Das deutsche Bundesland Hessen erlässt das erste Datenschutzgesetz der Welt.
Datenschutz wird erstmals in der liechtensteinischen Rechtsordnung erwähnt, in einem Staatsvertrag mit der Schweiz zu Telekommunikation. Auch taucht die Aufgabe Datenschutzrecht erstmals im Ressortplan der Regierung auf.
Die Europäische Union (EU) erlässt ihre erste Datenschutzrichtlinie. Diese ist auch für die EWR-Staaten und damit Liechtenstein relevant.
20 LIECHTENSTEIN-INSTITUT
tinien, Kanada, die Färöer-Inseln, Guernsey, Israel, die Insel Man, Japan, Jersey, Neuseeland, die Republik Korea, die Schweiz, das Vereinigte Königreich sowie Uruguay.
USA: (UN-)GENÜGENDER DATENSCHUTZ?
Eine besondere Herausforderung stellt die Datenübermittlung in die USA dar. Bereits unter dem alten Recht trachtete die EU-Kommission danach, den Datenverkehr zwischen den USA und dem Europäischen Wirtschaftsraum nicht zum Erliegen zu bringen. Sie entschied, dass US-Unternehmen immer dann ein ausreichendes Datenschutzniveau aufweisen, wenn diese die sogenannten «Safe Harbour»-Prinzipien anerkennen. Dabei handelt es sich um Rahmenbedingungen zum Schutz der Betroffenen vor unberechtigter Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten. Unter anderem sollte durch diese Prinzipien sichergestellt werden, dass Betroffene Auskunft zu den über sie verarbeiteten personenbezogenen Daten erhalten können und die verarbeiteten Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnahmen gesichert werden. US-Unternehmen sollten durch den freiwilligen Beitritt zu «Safe Harbour» ein mit dem Europäischen Wirtschaftsraum vergleichbares Datenschutzniveau herstellen können. Damit hätten Übermittlungen von Daten aus dem Europäischen Wirtschaftsraum zu US-Unternehmen möglich werden sollen.
Allerdings erklärte der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) die Äquivalenzentscheidung für ungültig. Daraufhin vereinbarten die EU und die USA den sogenannten «EU-US Privacy Shield». Dieser umfasste informelle Absprachen auf dem Gebiet des Datenschutzrechts, namentlich Zusicherungen der US-amerikanischen Bundesregierung und eine neue Äquivalenzentscheidung der EU-Kommission, mit welcher diese beschloss, dass die Vorgaben des «EU-US Privacy Shield» dem Datenschutzniveau der Europäischen Union entsprechen. Aber auch diese Äquivalenzentscheidung wurde, gestützt auf eine Klage gegen die Verarbeitung von Daten europäischer Kunden durch Facebook in den USA, vom EuGH für ungültig erklärt.
1999
Ein bekanntes Beispiel für den Datenschutz in Liechtenstein ist die Abschaffung des Autonummernbüchleins, welches 1999 zum letzten Mal erschien. Heute stellen sich dem Datenschutz ganz andere Herausforderungen. Bereits 1996 konnte bei der Motorfahrzeugkontrolle ein Antrag auf Nichtveröffentlichung im Motorfahrzeugverzeichnis gestellt werden.
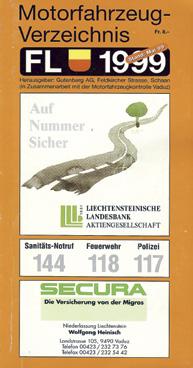
2022 wurde angekündigt, dass ein «Privacy Shield 2.0 (Trans-Atlantic Data Privacy Framework)» vereinbart werden soll. Bis dahin können Datenschutzverantwortliche aber lediglich auf Standardvertragsklauseln, welche die EU-Kommission formuliert hat, setzen. Diese Klauseln können zwar weiter für Datenübertragungen genutzt werden, der blosse Vertragsschluss reicht hierfür aber nicht aus. Das Gleiche gilt übrigens für verbindliche interne Datenschutzvorschriften. Bei einer Übermittlung von personenbezogenen Daten mittels Standardvertragsklauseln muss der Datenexporteur zukünftig bewerten, ob für die von Transfer betroffenen Daten ein angemessenes Datenschutzniveau im Empfängerland gewährleistet ist. Dabei muss nicht das allgemeine Datenschutzniveau im Empfängerland bewertet werden, sondern das konkrete Schutzniveau für die zu übertragenden Daten. All dies bedeutet, zumindest einstweilen, erheblichen Aufwand und Unsicherheit für Unternehmen – vor allem in Industrie und Finanzdienstleistungen –, welche mit den USA Daten austauschen.
UND DIE SCHWEIZ?
Für Liechtenstein noch in viel grösserem Masse von Interesse ist die Frage, wie der Austausch von Daten mit der Schweiz funktioniert. Hier sind nicht nur Betriebe mit transatlantischen Aktivitäten betroffen. Man denke daran, dass Versicherungen, Krankenkassen und weitere Dienstleister zumeist ihren Hauptsitz in der Schweiz haben und mit diesen auf täglicher Basis zum Teil besonders schützenswerte Daten, wie Gesundheitsdaten, ausgetauscht werden. Derzeit besteht eine Äquivalenzentscheidung der EU-Kommission, welche noch unter der alten Datenschutzrichtlinie erlassen wurde. Das Schweizer Datenschutzgesetz wurde 2020 revidiert, die Novelle soll 2023 in Kraft treten. Es ist zu erwarten, dass die EU-Kommission das neue Schweizer Datenschutzgesetz auf seine Äquivalenz mit der DSGVO überprüfen wird. Selbst wenn die Äquivalenz grundsätzlich gegeben sein sollte, ist nicht auszuschliessen, dass diese aus Gründen der derzeit schwierigen Gesamtbeziehung zwischen der Schweiz und der EU verweigert werden könnte. Dies wäre für Liechtenstein eine sehr grosse Herausforderung. Fortsetzung folgt …
Dr. Georges Baur, Forschungsbeauftragter Recht am Liechtenstein-Institut

Quellen – Datenschutzgesetz (DSG) vom 4. Oktober 2018, LGBl. 2018 Nr. 272. – Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG, ABI. Nr. L 119 vom 04.05.2016.
2002 2016 2018
Liechtenstein führt ein eigenes Datenschutzgesetz ein. Es wird die Stelle eines Datenschutzbeauftragten für Liechtenstein geschaffen.
Die europäische Datenschutzgrundverordnung wird verabschiedet.
Liechtenstein erlässt ein neues Datenschutzgesetz. In diesem Zusammenhang müssen 123 weitere Gesetze angepasst werden.
21 LIECHTENSTEIN-INSTITUT
DATEN BILDEN DIE BASIS MODERNER VOLKSWIRTSCHAFTLICHER ANALYSE
Um volkswirtschaftliche Entwicklungen zu bewerten und damit informierte wirtschaftspolitische Entscheidungen getroffen werden können, braucht es Daten. In Liechtenstein ist die Datengrundlage aus verschiedenen Gründen nach wie vor limitiert. Einige Lücken konnten allerdings in den letzten Jahren geschlossen werden, und es steigt auch hierzulande das Bewusstsein für die Sinnhaftigkeit daten- und evidenzgestützter Entscheidungen.
DIE ROLLE VON DATEN IN DER MODERNEN VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE
Die Volkswirtschaftslehre hat sich in den letzten Jahrzehnten als Disziplin stark gewandelt. Sie ist wesentlich datenzentrierter geworden und empirische Analysen stehen im Mittelpunkt der angewandten und akademischen Forschung. Für diese Entwicklung steht auch die Verleihung des Wirtschaftsnobelpreises 2021 an David Card, Joshua Angrist und Guido Imbens, die einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet haben.
Voraussetzung für diese Entwicklung war und ist der stetige Ausbau der Datengrundlage. International werden immer mehr Daten erhoben und zur Verfügung gestellt. Eine besondere Rolle spielen dabei anonymisierte administrative Daten, die nicht zuletzt auf Druck der Wissenschaft in einem immer grösseren Ausmass zugänglich gemacht werden. Administrative Daten sind Informationen, die für behördliche Zwecke und Verwaltungsaufgaben erfasst werden. Sie werden also nicht für die statistische Analyse und zur Messung wirtschaftlicher Entwicklungen erhoben, können aber durchaus aussagekräftig sein und wertvolle Information liefern.
Darüber hinaus spielt der rasante Ausbau der Informationstechnologie eine wesentliche Rolle für diese Entwicklung. Statistische Analysen sind sehr rechenintensiv, vor allem wenn sie auf grosse Datenmengen zurückgreifen. Die in der modernen Volkswirtschaftslehre verwendeten Methoden, Modelle und Technologien zur Verarbeitung und Auswertung von Daten entwickeln sich mit den Fortschritten in den angrenzenden Wissenschaften – insbesondere der Statistik, der Informatik und der Physik – ständig weiter.
Auf Basis der Datenverfügbarkeit und der entsprechenden Technologien zur Verarbeitung der Daten liegt die grösste Eigenleistung der Volkswirtschaftslehre in der Identifikation und Isolierung von Zusammenhängen in Daten. Konkret liegt der Fokus der empirischen Ökonomie auf Kausalitätsanalysen. Kausalität bedeutet, dass eine klare Ursache-WirkungBeziehung hergestellt wird. In den Rohdaten kann eine solche oft nicht direkt abgeleitet werden. Wirtschaftsdaten sind zu jedem Zeitpunkt einer Vielzahl von Einflüssen ausgesetzt. Betrachtet man beispielsweise die Konsumentenpreisinflation, so ist diese neben anderen Faktoren vom Zinsniveau, von der allgemeinen Nachfrage und der Konsumstimmung sowie von Rohstoffpreisen abhängig. Eine für Notenbanken, die für die Preisstabilität zuständig sind, relevante Frage ist dabei, wie Leitzinsänderungen das Preisniveau beeinflussen. Um
diese Frage zu beantworten, reicht es nicht aus, sich den Zusammenhang zwischen Inflation und Zinsen in Form einer Korrelation anzuschauen. Stattdessen muss der Effekt von Zinsänderungen isoliert und von anderen makroökonomischen Faktoren statistisch bereinigt werden.
Das Bestreben, kausale Beziehungen in Daten zu identifizieren, zieht sich mittlerweile durch alle Teilbereiche der Volkswirtschaftslehre. In diesem Zusammenhang wird häufig auch von der sogenannten «Glaubwürdigkeitsrevolution in der Ökonomie» gesprochen, das Credo des Wirtschaftsnobelpreises 2021.
DIE BEDEUTUNG VON DATEN WÄHREND DER CORONA-REZESSION
Wie wichtig Daten für die volkswirtschaftliche Analyse sind, welche Informationen aus Daten abgeleitet werden können, aber auch welche Limitationen Daten und Datenanalyse haben, wurde im Kontext der Corona-Krise deutlich.
Die Dynamik, mit welcher die von der Pandemie ausgelöste Rezession die Weltwirtschaft erfasste, war beispiellos. Traditionelle Prognosemodelle, die auf klassischen Wirtschaftsindikatoren beruhen, welche üblicherweise nur mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung verfügbar sind, waren mit dieser Situation überfordert. Deshalb wurde auf hochfrequente Daten (beispielsweise zu Mobilität, Transaktionen, Internetnutzung, Strom, Verwaltung etc.) zurückgegriffen, die zwar nicht für die Messung des Konjunkturverlaufs erhoben werden, für diesen aber indikativ sind. So konnte für viele Volkswirtschaften mit täglicher oder zumindest wöchentlicher Frequenz die wirtschaftliche Aktivität approximativ ermittelt werden.
Diese Informationen über die Wirtschaftskrise stellten eine wichtige Voraussetzung für die Gestaltung der wirtschaftspolitischen Massnahmen zur Stützung der Wirtschaft dar. Nur mit qualitativ hochwertigen und aktuellen Daten kann die wirtschaftliche Lage zutreffend beurteilt werden, auf welche die Politik dann reagieren kann. Darüber hinaus braucht es Daten, um die Effektivität und Effizienz der jeweiligen Massnahmen auch laufend evaluieren zu können. Dies wurde im Kontext der Corona-Rezession besonders evident. Die Corona-Pandemie machte dabei auch wieder deutlich, wie wenig Daten zur Verfügung stehen, die über die liechtensteinische Volkswirtschaft Auskunft geben. Vor dem Hintergrund der Kleinstaatlichkeit und begrenzter Ressourcen ist es klar, dass weniger Daten als in grösseren Ländern
22 LIECHTENSTEIN-INSTITUT
Konjunkturindex KonSens: Wie man in Liechtenstein trotz begrenzter Verfügbarkeit klassischer, unterjähriger Wirtschaftsdaten gegenwärtige Konjunkturentwicklungen abbilden und analysieren kann, kann am Beispiel des Konjunkturindex KonSens veranschaulicht werden. Der KonSens ist ein Sammelindikator, der vierteljährlich 16 liechtensteinische Einzelindikatoren mit statistischen Methoden zu einem gleichlaufenden Signal zusammenfasst und zeitnah verschiedene – mitunter widersprüchliche – konjunkturelle Impulse zu
einem einheitlichen Bild verbindet. Er generiert für jedes Quartal einen indexierten Datenpunkt in Form eines von saisonalen Einflüssen und langfristigem Wachstumstrend bereinigten Indexwertes und zeigt an, ob das volkswirtschaftliche reale Quartalswachstum über oder unter dem historischen Durchschnitt liegt. Neben anderen vierteljährlichen Indikatoren gehen der liechtensteinische Stromverbrauch, Arbeitsmarkt-
Aussenhandelszahlen
und
KonSens ein. 5 2.5 0 – 2.5 – 5 2000 2002 2004 2008 1998 2006 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 ENTWICKLUNG DES KONJUNKTURINDEX KONSENS 1998–2022 Anmerkung: Wachstumsrate/Indexwert von 16 Einzelindikatoren und KonSens (real, saisonbereinigt, standardisiert) FOKUS 2. QUARTAL 2022: KONSENS UND SEINE EINZELINDIKATOREN MIT GEWICHTUNG 3 2 1 0 –1 –2 –3 –4 Zupendelnde Stromverbrauch Rentabilität PKW-Erstzulassungen Offene Stellen KonSens Logiernächte Konsumstimmung CH/ AT Güterexporte Auftragslage Arbeitslose Aktienwerte Allgemeine Lage Beschäftigung Güterimporte Konsumpreise CH Anlagenauslastung 23 LIECHTENSTEIN-INSTITUT
Umfragedaten und
in die Berechnung des
erfasst werden können. Und obwohl eine positive Tendenz hinsichtlich der Verfügbarkeit von Daten und Information zur liechtensteinischen Volkswirtschaft verortet werden kann, wären mehr und bessere Daten hilfreich gewesen, um die wirtschaftliche Aktivität – besonders im Zuge der rasanten Entwicklungen im Kontext der Corona-Rezession – besser erfassen zu können.
VERFÜGBARKEIT UND VERWENDUNG VON DATEN IM KLEINSTAAT LIECHTENSTEIN
Die Kleinstaatlichkeit bringt hinsichtlich volkswirtschaftlicher Datenanalyse Herausforderungen und Limitationen mit sich. So ist in Liechtenstein beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nur jährlich und mit einer Verzögerung von rund 18 Monaten verfügbar. Die heimische Berechnungsweise der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR), die vor allem auf Daten der Steuerverwaltung beruht, stellt eine adäquate, auf Liechtenstein zugeschnittene Lösung dar, um den Erhebungs- und Berechnungsaufwand für die Verwaltung klein zu halten und auch die Unternehmen mit keinen zusätzlichen Erhebungen zu belasten. Sie hat aber den Nachteil, dass damit einige Aspekte der VGR nicht erfasst werden, die Erhebungsweise zu einer langen Publikationsverzögerung führt und so auch keine unterjährige (quartalsweise) Berechnung möglich ist.
Wann sind in Liechtenstein BIP-Zahlen zum Jahr 2022 verfügbar?
– März 2023: BIP-Schätzung des Liechtenstein-Instituts
– März 2024: Schätzrechnung BIP des Amts für Statistik (AfS)
– November 2024: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung des AfS (provisorisch, nicht-revidiert)
– November 2025: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung des AfS (final, revidiert)
In Folge der limitierten Verfügbarkeit von (v.a. unterjährigen) Wirtschaftsdaten kann die konjunkturelle Entwicklung nicht wie in anderen, grösseren Ländern erfasst werden. Zum Beispiel, weil keine Preisindizes für Liechtenstein existieren und das BIP nicht nach der Verwendungsseite erhoben wird, oder weil Liechtenstein in die Zahlungsbilanz der Schweiz integriert ist und diesbezüglich keine liechtensteinspezifischen Zahlen öffentlich zugänglich sind. Aus diesem Grund muss auf Informationen aus Referenzländern zurückgegriffen oder es müssen Schätzungen für Liechtenstein vorgenommen werden. Darüber hinaus werden zur zeitnahen Abbildung der konjunkturellen Entwicklung schon bereits seit einigen Jahren auch Daten als Indikatoren verwendet, die zwar zum Teil für andere Zwecke erfasst werden, aber konjunkturelle Muster abbilden. Beispiele dafür sind der Stromverbrauch oder Unternehmensbefragungen. Diese und ähnliche Daten werden im Konjunkturindex KonSens zusammengefasst, der in den Abbildungen näher dargestellt wird. Der KonSens ist eines von fünf Modulen der von der Regierung geförderten «Angewandten Wirtschaftsanalyse», in der das Liechtenstein-Institut die volkswirtschaftliche Entwicklung in Liechtenstein erfasst und bewertet.
Obwohl die limitierte Datenverfügbarkeit liechtensteinspezifische Analysen erschwert, sind Letztere notwendig. Das zeigt insbesondere auch die liechtensteinische Konjunktur: Sie kann weder als kleine Version der Schweiz begriffen werden noch als gewichteter Durchschnitt der Nachbarländer. Liechtenstein weist beispielsweise gegenüber der Schweiz einen zeitlichen Vorlauf bezüglich konjunktureller Wendepunkte auf und unterliegt höheren Schwankungen. Wie stark Liechtenstein auf globale Wirtschaftskrisen reagiert, hängt
dabei von der Art der Rezession ab. Um dies schon am Anfang der neuartigen Corona-Rezession einschätzen zu können, war ein frühes Konjunkturmonitoring, wie beispielsweise mit dem KonSens, essenziell.
Daten sind jedoch nicht nur für die kurzfristige Konjunktur- oder die langfristige Wachstumsanalyse wichtig, sondern auch aus anderen volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Blickwinkeln. Entsprechende regelmässige Analysen sowie die Fundierung von Politikentscheidungen beginnen dabei mit der Verfügbarkeit von Daten. Im Vergleich mit anderen Staaten steht Liechtenstein jedoch erst am Anfang. Politik, Verwaltung und Wissenschaft stehen diesbezüglich gleichermassen in der Verantwortung, die Informationsgrundlage zu verbreitern und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Die kleine Bevölkerungsgrösse und begrenzte Ressourcen lassen eine Erhöhung der Anzahl von Erhebungen und Befragungen jedoch nur begrenzt zu. Die Kleinheit, das Fehlen einer subnationalen Zwischenebene (wie Kantone) und die breite Abstützung auf administrative Daten bietet für die Forschung aber auch Chancen. Liechtensteinische Zusammenhänge besser zu verstehen, ist dabei nicht nur für die hiesige Forschung wichtig, sondern kann auch für die internationale Forschung ein interessanter Untersuchungsgegenstand sein.
Dr. Andreas Brunhart, Forschungsleiter Volkswirtschaft am Liechtenstein-Institut


Dr. Martin Geiger, Forschungsbeauftragter Volkswirtschaft am Liechtenstein-Institut
Quellen – Brunhart, A. (2019): Der neue Konjunkturindex «KonSens»: Ein gleichlaufender, vierteljährlicher Sammelindikator für Liechtenstein. Bendern (Arbeitspapiere Liechtenstein-Institut, 62).
– Konjunkturindex KonSens: https://www.liechtenstein-institut.li/konsens
24 LIECHTENSTEIN-INSTITUT
Publikationen und Projekte des Liechtenstein-Instituts

Forschungsschwerpunkt Verfassungsrecht
Das liechtensteinische Verfassungsrecht ist seit jeher ein Forschungsschwerpunkt des Liechtenstein-Instituts. Davon zeugen zahlreiche Publikationen sowie der frei zugängliche Onlinekommentar zur liechtensteinischen Verfassung verfassung.li. In den vergangenen Monaten erfolgten zahlreiche Publikationen, welche sich mit konkreten Fragen des liechtensteinischen Verfassungsrechts auseinandersetzen. So verortet beispielsweise Patricia Schiess Liechtenstein im europäischen Verfassungsverbund oder analysiert das Sezessionsrecht der liechtensteinischen Gemeinden. Ende 2021 erschienen zudem zwei Sammelbände mit fast zwanzig Fachbeiträgen von nationalen und internationalen Expert:innen.
Von der Regierung zur Verwaltung
Das Projekt «Von der Regierung zur Verwaltung» untersucht die strukturelle Entwicklung der liechtensteinischen Behördenorganisation vom Erlass der Verfassung im Jahre 1921 bis heute. Es zeichnet anhand von graphischen Darstellungen die einzelnen Entwicklungsschritte von damals, als sämtliche Verwaltungsaufgaben allein vom Regierungschef wahrgenommen wurden, bis heute hin zu einer weitläufigen Regierungs- und Verwaltungsorganisation mit Ministerien, Ämtern usw. schrittweise nach. Ergänzend wird den (gemeinhin vernachlässigten) gescheiterten Reformen und ihren Umständen nachgespürt, die eine Verbesserung der Behördenorganisation anstrebten, letztlich aber nicht umgesetzt werden konnten.
Mehr Information auf https://www.liechtenstein-institut.li/ regierung_zur_verwaltung/projekt

Wahlen auf Gemeindeebene in Liechtenstein seit 1862
Hoch /Neier /Schiess Rütimann (Hg.): 100 Jahre liechtensteinische Verfassung. Funktionen, Entwicklung und Verhältnis zu Europa. Gamprin-Bendern: Verlag der Liechtensteinischen Akademischen Gesellschaft (Liechtenstein Politische Schriften, 62).


Zeitschrift für öffentliches Recht (ZöR), 76 (2021), Heft 4.
Neutralität und Aussenpolitik Liechtensteins im Fokus
Ist Liechtenstein als Staat neutral und will es das überhaupt sein? Diesen Fragen gehen zwei aktuelle Publikationen des Liechtenstein-Institut nach. In einem Arbeitspapier beleuchtet Lukas Ospelt den neutralitätsrechtlichen Status des Fürstentums Liechtenstein aus rechtsgeschichtlicher und rechtsvergleichender Perspektive. Zwei Fragen sind dabei von besonderem Interesse: Ist Liechtenstein ein neutraler Staat im völkerrechtlichen oder staatsrechtlichen Sinne? Und worin bestehen die Besonderheiten einer etwaigen «faktischen Neutralität» des Landes? Es wird aber auch das Verhältnis zur Schweiz betrachtet und das Neutralitätsverständnis im Zusammenhang mit der Sanktionspolitik Liechtensteins gegenüber russischen Staatsangehörigen. Das Neutralitätsverständnis Liechtensteins und der Krieg in der Ukraine spielt auch im LI Focus von Christian Frommelt eine wichtige Rolle. Der Kurzbeitrag geht der Frage nach, welche Rolle Werte in der liechtensteinischen Aussenpolitik spielen und wie Liechtenstein als Klein(st)staat zur Sicherheit in Europa beitragen kann.
Ospelt, Lukas (2022): Der neutralitätsrechtliche Status des Fürstentums Liechtenstein. Eine rechtsgeschichtliche und rechtsvergleichende Studie. Arbeitspapiere Liechtenstein-Institut, 75. Download unter www.liechtenstein-institut.li
Frommelt, Christian (2022): Liechtenstein als internationaler Akteur. LI Focus 2/2022. Liechtenstein-Institut, GamprinBendern. Download unter www.liechtenstein-institut.li
In seinem Beitrag geht Wilfried Marxer umfassend auf Wahlen auf Gemeindeebene in Liechtenstein ein. Dabei betrachtet er nicht nur die Wahl von Vorsteher:innen und weiteren Mitgliedern des Gemeinderates, sondern auch weiterer Organe, die in der Vergangenheit und bis in die Gegenwart von den Wahlberechtigten zu bestimmen waren oder sind. Dazu gehören etwa Säckelmeister, Vermittler oder Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission. Der Blick geht dabei zurück bis ins Jahr 1862, wobei die Wahlen seit 1975 vertieft betrachtet werden, da erst seitdem zweifelsfrei feststeht, welcher Partei die Kandierenden zuzuordnen sind. Im Fokus stehen nicht nur die Wahlergebnisse, sondern auch die wechselnden rechtlichen Bestimmungen zur Wahlberechtigung, zur Organisation und Durchführung von Wahlen, zur Mandatszuteilung und anderen Faktoren, die die Wahlen prägen.
Marxer, Wilfried (2022): Wahlen auf Gemeindeebene in Liechtenstein seit 1862 mit besonderer Berücksichtigung der Wahlen von 1975 bis 2019. Gamprin-Bendern (Beiträge Liechtenstein-Institut, 51). Download unter www.liechtenstein-institut.li
25 LIECHTENSTEIN-INSTITUT
DIE BESTEUERUNG VON DOPPELANSÄSSIGEN STIFTUNGEN IN
LIECHTENSTEIN UND IN DEUTSCHLAND
Stiftungen erfreuen sich einer grossen Beliebtheit im deutschsprachigen Raum. Aufgrund der unterschiedlichen Besteuerung in Liechtenstein und in Deutschland stellen sich gerade für Familienstiftungen vielfältige Gestaltungsfragen.
Stiftungen erfreuen sich einer grossen Beliebtheit im deutschsprachigen Raum. Im Fürstentum Liechtenstein gibt es derzeit insgesamt 9975 Stiftungen1, davon sind ca. 8000 Familienstiftungen. In der Bundesrepublik Deutschland gibt es 24 650 rechtsfähige Stiftungen.2 Knapp 10 % der Stiftungen in Deutschland verfolgen privatnützige Zwecke 3 und sind als Familienstiftungen anzusehen.
Da die Besteuerung in Liechtenstein und in Deutschland unterschiedlich ist, stellen sich gerade für Familienstiftungen vielfältige Gestaltungsfragen. Die Besteuerung einer Familienstiftung richtet sich wie für alle Steuersubjekte nach der Ansässigkeit. Für eine Stiftung ergibt sich die Ansässigkeit grundsätzlich aus dem statuarischen Sitz, also dem in den Statuten geregelten Satzungssitz, der in der Regel mit dem Ort der Geschäftsleitung, also dem Verwaltungssitz, zusammenfällt. Im Wege der grenzüberschreitenden Stiftungsmobilität kann es aber auch soweit kommen, dass der Satzungssitz und der Verwaltungssitz auseinanderfallen. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn der Ort der Geschäftsleitung in ein anderes Land verlegt wird. Als Folge wird die Stiftung dann doppelansässig, da sie in einem Land ihren statuarischen Sitz und in dem anderen Land den Ort der Geschäftsleitung hat.

In meiner Dissertation wird zunächst herausgearbeitet, ob eine solche Sitzverlegung zivilrechtlich überhaupt zulässig ist, da das internationale Stiftungskollisionsrecht, zumindest in Deutschland, gesetzlich nicht geregelt ist. Die Möglichkeit einer Sitzverlegung einer Stiftung über die Grenze hinweg ist in der Literatur höchst umstritten und auch von der Rechtsprechung noch nicht abschliessend geklärt. Es wird daher geprüft, ob eine liechtensteinische Stiftung ihren Ort der Geschäftsleitung nach Deutschland verlegen kann. Umgekehrt stellt sich die Frage, ob eine deutsche Stiftung ihren Ort der Geschäftsleitung nach Liechtenstein verlegen kann.
Wie aus meiner Arbeit hervorgeht, ist es aufgrund der europäischen Niederlassungsfreiheit möglich, dass eine liechtensteinische Familienstiftung ihren Ort der Geschäftsleitung nach Deutschland verlegt, da der Zuzug von Gesellschaften durch die Grundfreiheiten geschützt wird. Umgekehrt ist es jedoch zivilrechtlich nicht möglich, dass eine deutsche Familienstiftung nach Liechtenstein wegzieht, da der Wegzug nach der Rechtsprechung des EuGH gerade nicht von der Niederlassungsfreiheit geschützt ist. Zivilrechtlich kann es also nur eine doppelansässige liechtensteinische Familienstiftung geben, nicht aber eine doppelansässige deutsche Familienstiftung.
Im Folgenden wird die Besteuerung der Familienstiftung in Liechtenstein der Besteuerung in Deutschland gegenübergestellt. Es werden jeweils die Phasen der Errichtung, der laufenden Besteuerung, der Besteuerung bei Ausschüttungen an die Destinatäre und die Besteuerung bei der Beendigung beleuchtet. Darauf aufbauend werden die Besonderheiten der Besteuerung der doppelansässigen liechtensteinischen Familienstiftungen mit Ort der Geschäftsleitung in Deutschland untersucht. Grundsätzlich führt die Doppelansässigkeit dazu, dass die Familienstiftung sowohl in Liechtenstein als auch in Deutschland mit ihrem Welteinkommen unbeschränkt steuerpflichtig ist. Dies könnte bedeuten, dass die doppelansässige Familienstiftung sowohl in Liechtenstein als auch in Deutschland als inländische Stiftung gilt. Daher stellt sich die Frage, ob in Deutschland das Steuerklasseprivileg des § 15 Abs. 2 ErbStG für inländische Stiftungen anwendbar ist, wenn die Stiftung schon als doppelansässige Stiftung errichtet wird. Des Weiteren wird zu klären sein, ob auf eine doppelansässige liechtensteinische Familienstiftung die Wegzugsteuer gem. § 6 AStG anwendbar ist. Dies ist nur dann der Fall, wenn die Familienstiftung als ausländische zu behandeln ist. Parallel hierzu stellt sich die Frage, wie mit der Hinzurechnungsbesteuerung gem. § 15 AStG umzugehen ist.
1
https://www.stifa.li/zahlen-fakten; Rechenschaftsbericht der Regierung 2021, 389; Stand 08.08.2022.
2 https://www.stiftungen.org/fileadmin/stiftungen_org/Stiftungen/ Zahlen-Daten/2021/Stiftungsbestand-2001-2021.pdf. Stand 08.08.2022.
3 https://www.stiftungen.org/fileadmin/stiftungen_org/Stiftungen/ Zahlen-Daten/2021/Stiftungszwecke-2021.pdf.Stand 08.08.2022.
Daniela Falkenhagen, Rechtsanwältin, Doktorandin an der Privaten Universität im Fürstentum Liechtenstein (UFL)
PRIVATE UNIVERSITÄT IM FÜRSTENTUM LIECHTE NSTEIN 26
REGULIERTE FONDSBEZOGENE VERTRIEBSTÄTIGKEITEN.
Von der Fondsrechtsgeschichte
zum Konzept
Die Regulierung fondsbezogener Vertriebstätigkeiten zählt seit jeher zu den anspruchsvollen Gebieten im Finanzmarktrecht. In der Praxis ist oft unklar, ob eine bestimmte fondsbezogene Vertriebstätigkeit als reguliert gilt. Dem kann mit einem Prüfschema entgegengewirkt werden, das eine strukturierte und umfassende rechtliche Qualifikation erlaubt.
In der Schweiz wurden die ersten Anlagefonds in den 1930er-Jahren gegründet. Geprägt vom angelsächsischen Raum kam die Idee auf, dem Kleinsparer 1 die Möglichkeit zu geben, das angesparte Vermögen professionell verwalten zu lassen. Bereits vor der ersten Regulierung in den 1960er-Jahren wurde erkannt, dass die positive Entwicklung dieser für die damalige Zeit neuen Investitionsform eng mit Vertriebstätigkeiten im Zusammenhang stand. Fondsbezogenen Vertriebstätigkeiten wurden seit dem Aufkommen der Fondsbewegung in der Schweiz grosse Bedeutung beigemessen.2
Obwohl das Schweizer Fondsrecht seit rund 60 Jahren existiert, ist bis heute oftmals unklar, in welchen Fällen eine regulierte fondsbezogene Vertriebstätigkeit vorliegt. Die Regulierung fondsbezogener Vertriebstätigkeit in der Schweiz gilt als komplex und unübersichtlich. Das Ziel meiner Untersuchung bestand darin, das Schweizer Fondsrecht mit Fokus auf den fondsbezogenen Vertriebsbereich von den Anfängen bis in die Gegenwart zu untersuchen und simplifiziert darzustellen, um einem breiten Kreis von Lesern den Einstieg in dieses anspruchsvolle Rechtsgebiet zu erleichtern und Erkenntnisse aus der Vergangenheit auf die aktuelle Regulierung systematisch anzuwenden.
Aus der systematischen Erfassung der Rechtsmaterialien liess sich ableiten, dass sich das Schweizer Fondsrecht im Wesentlichen in fünf wegweisende Fondsrechtsetappen unterteilen lässt. Die erste Etappe des Schweizer Fondsrechts begann mit der Inkraftsetzung des Anlagefondsgesetzes von 1966. Anzuknüpfen war auf Vertriebsebene primär an die öffentliche Werbung als Rechtsbegriff. In einer zweiten Fondsrechtsetappe wurde das Anlagefondsgesetz durch das revidierte Anlagefondsgesetz von 1994 ersetzt. Der Begriff der «öffentlichen Werbung» als Anknüpfungspunkt blieb erhalten. Eine dritte Etappe im Schweizer Fondsrecht folgte mit der Einführung des Kollektivanlagegesetzes von 2006. Für die rechtliche Qualifikation fondsbezogener Vertriebstätigkeiten knüpfte man weiterhin an die öffentliche Werbung an. In einer vierten Etappe des Schweizer Fondsrechts trat das revidierte Kollektivanlagegesetz von 2013 in Kraft. In dieser Etappe wurde der Begriff des «Vertriebs» eingeführt. Ob eine fondsbezogene Vertriebstätigkeit vorlag, stand und fiel mit der Anknüpfung an den Rechtsbegriff des Vertriebs. Ausserdem wurden regulatorische Ausnahmetatbestände zum Vertrieb rechtlich verankert. Gegenwärtig – in der fünften Etappe des Schweizer Fondsrechts – gilt das Kollektivanlagegesetz von 2013 in überarbeiteter Version primär nur auf Produktebene. Fondsbezogene Vertriebstätigkeiten werden
neu durch das Finanzdienstleistungsgesetz von 2020 geregelt. Auf Institutsebene kommt das Finanzinstitutsgesetz von 2020 zur Anwendung. Aktuell ist im fondsbezogenen Vertriebsbereich zwischen der Finanzdienstleistung, dem Angebot und der Werbung zu unterscheiden. Der Begriff des Vertriebs gilt in der fünften Etappe des Schweizer Fondsrechts rechtlich nicht mehr als Anknüpfungspunkt.
Nach Unterteilung des Schweizer Fondsrechts in fünf Etappen wurde die Untersuchung weiter ausgeführt. Es wurden insbesondere die Kriterien, welche eine rechtliche Qualifikation regulierter fondsbezogener Vertriebstätigkeiten erlauben, für jede einzelne Fondsrechtsetappe dargelegt. Aus den anwendbaren Kriterien für die rechtliche Qualifikation regulierter fondsbezogener Vertriebstätigkeiten liess sich ein Prüfschema entwickeln. Das Prüfschema stellt im Wesentlichen auf (i) den respektive die in der jeweiligen Fondsrechtsetappe anwendbaren Rechtsbegriff(-e) auf Vertriebsebene als Anknüpfungspunkt, (ii) den Bezug zu einem Fondsprodukt und (iii) das Abzielen auf die Zeichnung von Anteilsscheinen ab, wobei (iv) die Form der ausgeübten Vertriebstätigkeiten sowie (v) die Vermittler im Fondsbereich nicht massgebend für rechtliche Qualifikation fondsbezogener Vertriebstätigkeiten sind. In einem letzten Schritt gilt es zu prüfen, ob (vi) eine regulatorische Ausnahmeregelung auf Vertriebsebene vorliegt. Dieses Prüfschema trägt dazu bei, regulierte fondsbezogene Vertriebstätigkeiten nach gegenwärtigem Recht zutreffend qualifizieren zu können.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Untersuchung mit einer systematischen Analyse der Schweizer Fondsrechtsgeschichte startete und zu einem Prüfkonzept führte, welches heute zweckmässig bei der rechtlichen Qualifikation fondsbezogener Vertriebstätigkeiten eingesetzt werden kann.
Mercedes Nieto, Head of Legal, Petiole Asset Management, Doktorandin an der Privaten Universität im Fürstentum Liechtenstein (UFL)

1 Der besseren Leserbarkeit halber wird vorliegend das generische Maskulinum verwendet.
2 Vgl. zum Ganzen: Botschaft des Bundesrates zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Anlagefonds vom 23. November 1965, BBI 1965, 264 ff.
27 PRIVATE UNIVERSITÄT IM FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN
SCHAFT: Verstoss gegen das Diskriminierungsverbot?
Es gibt in den Gemeinden Balzers, Triesen, Vaduz, Eschen und Mauren je eine Bürgergenossenschaft. Man kann von ihnen Brennholz aus dem Genossenschaftswald beziehen. Zudem haben sie Baugrundstücke, landwirtschaftlich nutzbare Böden und Wohnungen. Die Mitglieder haben die Möglichkeit, eine Wohnung der Bürgergenossenschaft zu mieten, auf einem Baugrundstück im Baurecht ein Eigenheim zu errichten oder einen Landwirtschaftsboden zu pachten.
Da dieses Bürgervermögen nur beschränkt vorhanden ist, darf der Mitgliederkreis der Bürgergenossenschaft nicht zu gross sein, damit das einzelne Nutzungsrecht werthaltig ist. Der Mitgliederkreis darf aber auch nicht zu klein sein, damit die mit dem Bürgervermögen zusammenhängenden Lasten, wie beispielsweise die Baumpflege oder die Reparatur von Zäunen und der anderweitige Unterhalt, getragen werden können. Die Bürgergenossenschaften müssen sich somit überlegen, wie gross ihr Mitgliederkreis sein kann und sein muss. Zur Steuerung des Mitgliederkreises sieht das Gesetz zwei Differenzierungsmechanismen vor.
Stammt man von einem Mitglied ab oder ist man mit einem Mitglied verheiratet, kann man einen Antrag auf Aufnahme in die Bürgergenossenschaft stellen. Weist man diese familiären Beziehungen nicht auf, kann man sich gemäss Gesetz um die Mitgliedschaft bewerben. Dabei wird nicht verkannt, dass die Bürgergenossenschaften Balzers, Triesen, Vaduz und Mauren diese letzte Möglichkeit in ihren Statuten nicht vorsehen. Wie sich aus den Protokollen zur Ausarbeitung der Statuten der Bürgergenossenschaft Triesen im Jahr 2000 ergibt, gingen die Bürgergenossenschaften davon aus, dass sie selbst festlegen können, ob sich Personen, die nicht von einem Mitglied abstammen oder mit einem solchen verheiratet sind, um die Aufnahme bewerben können oder nicht. Ein derartiges Ermessen besteht jedoch nicht, wenn man sich die Geschichte der Bürgergenossenschaften anschaut. Öffentlich-rechtliche Personalkörperschaften, denen das Bürgervermögen zusteht, gab es bereits nach den Gemeindegesetzen 1842, 1864 und 1959. Die Differenzierung zwischen Landesangehörigen mit und ohne Mitgliedschaftsrecht wurde unter den alten Gemeindegesetzen jeweils unterschiedlich vorgenommen. Aus einer Herleitung der tragenden Überlegungen unter der Geltung dieser alten Gemeindegesetze ergibt sich, dass das Mitgliedschaftsrecht zwingend auch eigenständig erworben werden können muss.
Der erste Differenzierungsmechanismus besteht nun darin, dass nur ein Landesbürger Mitglied einer Bürgergenossenschaft sein kann, jedoch nicht jeder Landesbürger Mitglied sein muss. Personen, welche die familiären Beziehungen aufweisen, werden nur Mitglieder, wenn sie einen Antrag stellen. Bei einer Bewerbung obliegt der Bürgerge-
nossenschaft die Entscheidung über die Aufnahme des Bewerbers. Es gibt folglich Landesangehörige mit und ohne ein Mitgliedschaftsrecht.
Der zweite Differenzierungsmechanismus besteht darin, dass die Ausübung des Stimm- und Nutzungsrechts am Bürgervermögen von einem inländischen Wohnsitz abhängt. Es sind nur die im Land wohnhaften Mitglieder stimm- und nutzungsberechtigt. Dieser Differenzierungsmechanismus kann von den Bürgergenossenschaften verstärkt werden, indem das Stimm- und Nutzungsrecht an den Wohnsitz in der Gemeinde geknüpft wird.
Das Gesetz sieht somit eine unmittelbare und eine mittelbare Differenzierung zwischen Landesangehörigen und Ausländern vor. Jeder Landesangehörige hat die Möglichkeit, ein Mitgliedschaftsrecht zu erlangen; diese Möglichkeit haben Ausländer nicht. Zum anderen können nur Mitglieder mit Wohnsitz im Inland das Mitgliedschaftsrecht ausüben. Weil Liechtenstein Mitglied im EWR ist, stellt sich die Frage nach der Anwendbarkeit des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWRA).
Der Rechtsdienst der Regierung erstellte zwei Gutachten und kam in beiden zum Schluss, die Bürgergenossenschaft sei nicht als Einrichtung des Staates zu qualifizieren. Abgesehen davon, dass die Bürgergenossenschaften Einrichtungen des Staates sind, ist durch das Gesetz über die Bürgergenossenschaften auch die Personenfreizügigkeit (Arbeitnehmerfreizügigkeit und Niederlassungsfreiheit) betroffen. Zu denken ist etwa an die deutsche Arbeitnehmerin, die in Liechtenstein arbeiten und wohnen darf und nun eine Wohnung sucht oder an den österreichischen Landwirt, der im Inland wohnt und auf Pachtboden angewiesen ist. Somit muss das nationale Gesetz mit den Diskriminierungsverboten des EWRA in Einklang stehen. Diese verbieten die Ungleichbehandlung von Landesangehörigen und EWR-Ausländern aufgrund der Staatsangehörigkeit. Indem das Gesetz zwischen Landesangehörigen einerseits und EWR-Ausländern andererseits unterscheidet und diese Unterscheidung an die Staatsangehörigkeit anknüpft, verstösst es gegen die Diskriminierungsverbote des EWRA.
Martin Vogt, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Verwaltungsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein. Doktorand an der Privaten Universität im Fürstentum Liechtenstein (UFL)
Portraitfoto: Nils Vollmar, Balzers

DIE LIECHTENSTEINISCHE BÜRGERGENOSSEN-
Der Zugang zu den Bürgergenossenschaften steht nur Landesangehörigen offen. Ist dies vereinbar mit den Verpflichtungen, die sich für Liechtenstein aus dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum ergeben?
28 PRIVATE UNIVERSITÄT IM FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN
SCHEINBAR KEIN PROBLEM? Die Untersuchung der Scheinehe in Liechtenstein
Ein aktuelles rechtswissenschaftliches Dissertationsprojekt an der UFL befasst sich mit der Scheinehe.
Wenn Themen mangels auffälliger Zahlen oder regelmässiger Datensammlungen nicht sichtbar werden, liegt oft die Vermutung nahe, dass gar kein Problem vorliegt. Auf den ersten Blick liesse sich dieser Eindruck auch für die Scheinehe im liechtensteinischen Recht gewinnen. Dass Fälle von Scheinehen trotzdem vorkommen, die Behörden und Gerichte beschäftigen und rechtlich komplexe Fragestellungen vorliegen, wird anhand meines Dissertationsprojekts zum Thema «Die Scheinehe im liechtensteinischen Recht» herausgearbeitet.
Obwohl die rechtswissenschaftliche Dissertation ihren Fokus auf die Analyse der geltenden einschlägigen Bestimmungen des Ehe-, des Ausländer- sowie des Bürgerrechts und damit auf die dazugehörige Literatur und Rechtsprechung legt, sind auch Daten ein wichtiger Bestandteil, um ein umfassendes Bild über die Problemstellung zu erhalten.
liechtensteinischen Bürgerrechts eine Rolle spielen können. Die Aufnahme ins Landesbürgerrecht kann in einem ordentlichen oder einem erleichterten Verfahren erfolgen. Wesentlich häufiger sind Einbürgerungen im Rahmen des erleichterten Verfahrens. Beispielhaft dafür wurden im Jahr 2021 von insgesamt 161 Einbürgerungen lediglich 19 im ordentlichen Verfahren abgewickelt.5 Nach der Einbürgerung sog. «alteingesessener» Personen infolge dreissigjährigem Wohnsitz (115 Personen), nimmt die Aufnahme von Personen aufgrund von Eheschliessung (27 Personen) eine prominente Rolle ein. Zusätzlich finden sich auch Strafbestimmungen für Fälle, in denen das Vorliegen einer Scheinehe festgestellt wird. Im Rahmen der Dissertation wird nach der Definition der Scheinehe zuerst analysiert, wo und aus welchen Gründen Scheinehen im liechtensteinischen Recht überhaupt eine Rolle spielen können und anschliessend, wie sich die einzelnen Bestimmungen zur Verhinderung oder Sanktionierung von Scheinehen zueinander verhalten. Der Fokus liegt dabei klar auf dem liechtensteinischen Migrationsrecht. Die einschlägigen Gesetzesmaterialien zeigen, dass der Gesetzgeber die Gefahr von Scheinehen als hoch beurteilt und diverse rechtliche Bestimmungen geschaffen hat, um sie bzw. die Ableitung von Rechten daraus zu verhindern. Dabei ist eine Regelungsdichte entstanden, die einer eingehenden Prüfung bedarf. In der Dissertation wird jeweils der im Migrationsrecht wichtige Einfluss des Schweizer sowie des EWR-Rechts herausgearbeitet. Zudem widmet sie sich der Frage, wie die zuständigen Behörden, vorwiegend das Zivilstandsamt (ZSA) und das Ausländer- und Passamt (APA), das Vorliegen einer Scheinehe prüfen und feststellen können und wo die rechtlichen Schranken für die behördlichen Ermittlungen liegen. Die Dissertation trägt somit dazu bei, das Thema der Scheinehe in Liechtenstein auch ohne grosse Fallzahlen sichtbar zu machen.
Alle Aufenthalte von Ausländerinnen und Ausländern in Liechtenstein, die länger als drei Monate dauern oder bei denen eine Erwerbstätigkeit der Person vorliegt, unterliegen der Bewilligungspflicht. So wurde im Jahr 2021 – wie auch in den Jahren zuvor – der grösste Teil der Aufenthaltsbewilligungen in Liechtenstein, in Zahlen 453 von 616, gestützt auf die Bestimmungen zum Familiennachzug erteilt.1 Zu den wichtigsten Anspruchsberechtigten im Bereich des Familiennachzugs gelten neben Kindern die Ehegatten von liechtensteinischen Staatsangehörigen oder in Liechtenstein aufenthaltsberechtigten Personen. Gerade in den ausländerrechtlichen Spezialgesetzen, dem Personenfreizügigkeitsgesetz (PFZG)2 und dem Ausländergesetz (AuG)3 ist eine Vielzahl an Ansprüchen an den Eheschluss oder den Bestand einer aufrechten Ehe geknüpft. Daneben verbinden die beiden Gesetze Ansprüche und Rechtsfolgen mit der Dauer einer aufrechten Ehe, wie das Daueraufenthaltsrecht in Liechtenstein oder das sog. Verbleiberecht im Falle einer Ehescheidung. Aus diesem Grund hat sich der liechtensteinische Gesetzgeber bei der Schaffung der genannten Gesetze für die Einführung von Bestimmungen zur Verhinderung von rechtsmissbräuchlichen Ehen entschieden, um sogenannte Scheinehen, bei denen keine Lebensgemeinschaft zwischen den Partnern begründet wird, sondern die ausländerrechtlichen Bestimmungen umgangen werden sollen, zu verhindern.
Derartige Bestimmungen finden sich jedoch nicht nur im Bereich des Ausländerrechts im engeren Sinn, sondern auch im Ehegesetz (EheG)4, wo der Zivilstandsbeamte die Verkündung des Eheversprechens zu verweigern hat, wenn Braut oder Bräutigam offensichtlich keine Lebensgemeinschaft begründen, sondern die Bestimmungen über Zulassung und Aufenthalt von Ausländern umgehen wollen. Daneben ist eine Ehe gemäss EheG ungültig, wenn ein Ehegatte nicht eine Lebensgemeinschaft begründen, sondern dadurch entweder die Bestimmungen des Ausländerrechts oder des Bürgerrechts umgehen wollte. Damit wird klar, dass Scheinehen auch beim Erwerb des
Julia Walch, Leiterin Abteilung Asyl, Ausländerund Passamt (APA) des Fürstentums Liechtenstein. Doktorandin an der Privaten Universität im Fürstentum Liechtenstein (UFL)

1 Regierung, Rechenschaftsbericht 2021, S. 326.
2 Gesetz vom 20. November 2009 über die Freizügigkeit für EWR- und Schweizer Staatsangehörige (Personenfreizügigkeitsgesetz; PFZG), LGBl. 2009 Nr. 348.
3 Gesetz vom 17. September 2008 über die Ausländer (Ausländergesetz; AuG), LGBl. 2008 Nr. 311.
4 Ehegesetz (EheG) vom 13. Dezember 1973, LGBl. 1974 Nr. 20.
5 Regierung, Rechenschaftsbericht 2021, S. 254.
29 PRIVATE UNIVERSITÄT IM FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN
RECHTSHILFERECHTLICHE EIGENARTEN IN LIECHTENSTEIN
Bei der sogenannten «kleinen Rechtshilfe in Strafsachen» handelt es sich um einen in Strafverfahren mit grenzüberschreitendem Erhebungsbedarf angewandten Mechanismus. Bezogen auf die für Liechtenstein besonders relevante Übermittlung von Bankunterlagen wird untersucht, ob und inwieweit es «Liechtenstein’sche Eigenarten» gibt, ob diese fortbestehen und wenn ja, ob es einer Korrektur bedarf.
Einem Staat ist es grundsätzlich verwehrt, auf fremden Territorien hoheitliche Verfolgungshandlungen zur Aufklärung eines in seine Zuständigkeit fallenden Strafdeliktes zu setzen. Folglich kann dieser dort auch keine Beweise erheben und ist deshalb darauf angewiesen, dass der andere Staat Hilfe leistet und notwendige Verfolgungshandlungen vor- bzw. übernimmt. Während Strafverfahren mit Auslandsbezug früher eher die Ausnahme bildeten, hat die fortschreitende Technologisierung und Globalisierung die Lebensrealitäten derart geändert, dass heute kaum noch Strafverfahren ohne grenzüberschreitenden Erhebungsbedarf vorkommen. Um die Strafverfolgung nicht vor souveränitätskausalen Verfolgungsdefiziten kapitulieren zu lassen, bedarf es eines institutionalisierten Mechanismus grenzüberschreitender Hilfeleistung bei der Sammlung von Beweisen. Diesen Mechanismus nennt man die «kleine Rechtshilfe in Strafsachen». Nur wenn sich die Staaten gegenseitig unterstützen, können Verbrechen wirksam bekämpft werden, womit eine effektive Rechtshilfe zur Vorbedingung einer funktionierenden Strafverfolgung und der damit verfolgten Präventionsziele insgesamt wird.
Rechtshilfefeindliche Jurisdiktionen sind somit «kriminellenfreundliche» Jurisdiktionen, die nicht nur der Strafverfolgung insgesamt schaden, sondern auch ihrer eigenen Reputation. Der Staatsgerichtshof hat in diesem Sinne bereits mehrfach festgehalten, dass gerade ein Kleinstaat wie Liechtenstein darauf angewiesen sei, «von der Völkergemeinschaft als kooperativer und solidarischer Partner akzeptiert zu werden»1, und erkennt auch die Regierung ein «unbestritten staatspolitisches Interesse»2 an einer schnellen und effektiven Rechtshilfe an. Solche Bekenntnisse verkommen aber dort zum sprichwörtlichen Feigenblatt, wo sie keine Entsprechung im nationalen Rechtsbestand finden, das inländische Rechtshilferegime also gerade keine schnelle und effektive Unterstützung gewährleistet. Dieser Kritik sah sich Liechtenstein in der Vergangenheit u.a. im Zusammenhang mit Rechtshilfeersuchen ausgesetzt, die in oder im Konnex mit österreichischen Wirtschaftsstrafverfahren gestellt wurden. So bezeichnete z.B. 2013 die ehemalige Vorsitzende des Korruptions-Untersuchungsausschusses, Gabriela Moser, die Rechtshilfeleistung in der BUWOG-Causa als «Schlag ins Gesicht der österreichischen Justiz» 3 und setzte fort, dass «die Glaubwürdigkeit des österreichischen Rechtsstaats […] nicht […] von Liechtenstein’schen Eigenarten ruiniert werden»4 dürfe.
Ausgehend von dieser Kritik wird im Rahmen meines an der UFL im September 2022 abgeschlossenen Dissertationsprojekts bezogen auf die für Liechtenstein besonders relevante Übermittlung von Bankunterlagen untersucht,
von welchen «Liechtenstein’schen Eigenarten» des kleinen Rechtshilfeverkehrs gesprochen wurde, ob diese fortbestehen und wenn ja, ob sie von solcher Qualität sind, dass sie einer Korrektur bedürfen.
In diesem Sinne werden in einem ersten Kapitel die grundlegenden Fragestellungen zur kleinen Rechtshilfe beantwortet, insbesondere wird auch auf die Rechtsnatur des Instituts eingegangen und dieses von anderen Mechanismen behördlicher Zusammenarbeit abgegrenzt. In einem zweiten Kapitel wird die historische Entwicklung des liechtensteinischen Rechtshilferechtes dargestellt, um einerseits ein ausreichendes Fundament für die inhaltliche Befassung mit der Thematik im Hauptteil zu geben, andererseits um das Verständnis für allenfalls später auszumachende Eigenheiten zu schärfen. Im Hauptteil wird die Übermittlung von Bankunterlagen integral untersucht, wozu die Erörterung der Struktur des Rechtshilferechts, die Beschreibung der Rechtsquellen und deren Verhältnis zueinander, die Systematisierung der Bankunterlage als Objekt des Beweistransfers und die Darstellung der materiellen Voraussetzung der Rechtshilfeleistung samt der dieser entgegenstehenden Rechtshilfehindernisse ebenso gehören, wie jene der Verfahrensgrundsätze, des Verfahrensablaufes und der dem Betroffenen zur Verfügung stehenden Rechtsschutzmöglichkeiten. Um dem Anspruch einer möglichst vollständigen Bearbeitung gerecht zu werden, werden dabei über 750 inländische, teils unveröffentlichte Gerichtsentscheidungen eingearbeitet.
Als Resümee der Untersuchung lässt sich festhalten, dass sich das liechtensteinische Rechtshilferecht seit 2013 erheblich verändert hat, allerdings nach wie vor bestimmte Eigenheiten auszumachen sind, die den inländischen Rechtsbestand von verwandten Rechtsordnungen abhebt. Wesentlich ist dabei nicht zuletzt die Erkenntnis, dass sich diese Eigenheiten nicht ausschliesslich aus dem Rechtshilferecht selbst ergeben, wie z.B. der Rechtszug an den Staatsgerichtshof zeigt.
Gregor Hirn, Staatsanwalt bei der Liechtensteinischen Staatsanwaltschaft in Vaduz, Doktorand an der Privaten Universität im Fürstentum Liechtenstein (UFL)
1 Statt vieler: StGH 2000/28 Erw 3.2 LES 2003, 243.
2 BuA 55/2000, 2.
3 APA, Der Kurier, Grasser-Akten «extrem» geschwärzt, www.kurier.at/ politik/inland/causa-buwog-grasser-akten-aus-liechtenstein-extremgeschwaerzt/2.619.927, Onlineabfrage (14.08.2022).
4 Ebd.
30 PRIVATE UNIVERSITÄT IM FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN
DER MENSCH IN DATEN – Lösungen und Probleme in einer modernen Gesellschaft
Grosse Datenmengen stellen eine fortschreitend grösser werdende Herausforderung für Wissenschaftler:innen und Politiker:innen dar. Was machen diese Daten mit uns als Gemeinschaft und wie sollen wir mit ihnen umgehen? Um Antworten für diese Fragen zu finden, benötigen wir einen interdisziplinären Ansatz der Betrachtung.
1989 ging als Schicksalsjahr in die Geschichte ein. Der Fall der Berliner Mauer kündigte das Ende des Kalten Krieges an. Fast zeitgleich wurde am CERN die Grundlage des World Wide Web gelegt. Die folgenden Jahrzehnte sollten zu einem Zeitalter des Aufschwungs, des Liberalismus und des wirtschaftlichen Wachstums werden. Ein Zeitalter, das durch die neuen Mengen an Daten unterstützt werden sollte.
Doch noch strauchelt dieses Zeitalter. Die Zufriedenheit in der Bevölkerung stagniert und neue Probleme treten auf, welche die moderne Gesellschaft auf die Probe stellen. In diesem Artikel sollen mögliche Ursachen für diese Problematik aufgezeigt werden − und welche Lösungsmöglichkeiten in der Arbeit mit Daten liegen.
Die Erwartungen, die mit der rasanten technologischen Entwicklung der letzten Jahrzehnte einhergingen, waren hoch. Doch obwohl durch die beispiellose Art der Datenverfügbarkeit und Datenverarbeitung unzweifelhaft weitreichende Fortschritte in sämtlichen wissenschaftlichen Disziplinen erreicht wurden, blieb das von Francis Fukuyama vorausgesagte Ende der Geschichte aus. Statt eines Zustands
von andauerndem hohen Wohlstand, Frieden und gesellschaftlichem Aufschwung sehen sich moderne Gesellschaften fortschreitend mit gespaltenen Bevölkerungsgruppen, Finanzkrisen und der Zerstörung der Natur konfrontiert.
Die Realität einer Welt, die in nahezu allen Bereichen in Daten erfasst wird, hat viele Gesichter. GPS-Daten können sowohl für eine effektive Landwirtschaft als auch für Militärschläge verwendet werden. In einigen Ländern finden Menschen durch in Dating-Apps gespeicherte Daten ihre grosse Liebe, in anderen Ländern können neu entstandene Autokratien dieselben Daten nutzen, um sexuelle Minderheiten zu verfolgen. Daten der sozialen Netze werden für demokratische Proteste und demagogische Beeinflussung von Wahlen genutzt.
Daten selbst sind dabei keine Erfindung der Moderne. Nicht ohne guten Grund befinden sich unter den ältesten archäologischen Ausgrabungen Fundstücke, auf denen Inventarlisten niedergeschrieben sind. Diese Daten ermöglichen eine effektive Verwaltung und sind somit eine der zentralen Grundlagen von menschlichen Gesellschaften und haben
Die Zufriedenheit mit der eigenen Arbeit in Deutschland. Obwohl es in den meisten Berufen zu einer Erhöhung der Arbeitsqualität und Produktivität durch neue Technologien kam, stagniert die Zufriedenheit in den letzten dreissig Jahren. Iglauer et al. 2021, S. 411
ZUFRIEDENHEIT MIT DER EIGENEN ARBEIT 8 7 6 5 4 1992 1994 1996 2000 2004 2008 2012 2014 2016 2018 1990 1998 2002 2006 2010
31 PRIVATE UNIVERSITÄT IM FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN
Westdeutschland Ostdeutschland
sich mit ihnen entwickelt. Dennoch ist es wichtig, in einer Zeit, in der die Nutzung von grossen Datenbanken aus wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Perspektive zum fundamentalen Grundstein wird, neben den Fortschritten auch auf die gesellschaftlichen Gefahren hinzuweisen.
In welcher Gesellschaft möchten wir leben? Und welchen Platz räumen wir den Datenbanken in ihr ein? Obwohl die moderne Gesellschaft mehr Möglichkeiten bietet als alle Vorgänger, bleiben einige Probleme bestehen und intensivieren sich. So stagniert z.B. die Zufriedenheit mit der eigenen Arbeit in den letzten 30 Jahren trotz grosser Entwicklungen am Arbeitsplatz durch datenbasierte Technologie. Profite und Reichtum sind so hoch wie nie zuvor und trotzdem steigt die Anzahl der Menschen, die selbst kaum Besitz haben.
Damit sich die moderne Gesellschaft weiterentwickeln kann, ist es unentbehrlich, Aufklärungsarbeit über die Arbeit mit grossen Datenmengen und die damit verbundenen gesellschaftlichen Folgen zu betreiben. Dies trifft im demokratischen Verständnis auf die Bürgerinnen und Bürger zu, die in Wahlen darüber entscheiden, welche Repräsentanten dafür zuständig sind, die datengestützten Programme und Vorschläge umzusetzen. Ebenso ist es wichtig, dass sich Experten, die selbst mit Daten arbeiten, kritisch damit auseinandersetzen, wie uns der Umgang mit Daten beeinflusst.
MAXWELLS DÄMON IN COLEMANS BADEWANNE
Im Jahr 1871 erstellte der Physiker James Clerk Maxwell ein Gedankenexperiment, in dem er sich theoretisch mit der Möglichkeit eines Perpetuum Mobiles beschäftigte: Ein Dämon sitzt auf einem Behälter mit einer Trennwand in der Mitte, in den beiden Unterbehältern befindet sich eine Mischung aus schnellen und langsamen Molekülen. Dieser Dämon kann in der Theorie diese Moleküle sehen und mit keinem bzw. geringstem Energieaufwand jeweils die Moleküle durch eine Tür so sortieren, dass in der einen Hälfte nur schnelle bzw. langsame Moleküle vorhanden sind. Danach öffnet er die Tür ganz und lässt die Moleküle wieder durcheinandermischen.
Die Schlussfolgerung dieses theoretischen Konstrukts ist, dass man eine unbegrenzte Energiequelle durch den Anschluss des Behälters an eine Wärmekraftmaschine erstellen könnte, da diese durch den Temperaturwechsel, hervorgehoben durch das Austauschen der Moleküle, mehr Energie produziert, als der Dämon verbraucht, um die Moleküle zu sortieren.
Dieses und ähnliche Beispiele erschufen eine grosse Sehnsucht nach der Möglichkeit eines Perpetuum Mobiles. Die Erfindung eines solchen Dämons könnte viele Probleme lösen, neue Fortschritte ermöglichen und Reichtum erwirtschaften. Insbesondere in einer Zeit, in der in den europäischen Staaten über einen langen Zeitraum Wohlstand und Wachstum vorherrschte, macht es Angst, dass dieser Zustand endlich sein kann. Der theoretische Griff nach einem unbegrenzten Wachstum oder einem immerwährenden Zustand ist damit verbunden.
Das grosse Problem an einem Perpetuum Mobile ist dabei jedoch, dass es nicht funktioniert. Viele Vorschläge für ein physikalisches Perpetuum Mobile erscheinen vom ersten Ansatz her schlüssig, jedoch scheitern alle diese Projekte früher oder später daran, dass eine physikalische Grundregel nicht beachtet wird und in der Folge das gesamte Projekt nicht funktioniert. Dies spiegelt sich in ökonomischen oder gesellschaftlichen Ideen mit einem ähnlichen Charakter wider. Auf dem Papier kann ein immerwährender Prozess entwickelt werden, wenn sich ein System z.B. in einem geschlossenen Raum befindet. In der Realität existieren jedoch keine perfekt geschlossenen Räume, wodurch derartige Theorien früher oder später auf soziale Regeln stossen. Dort, wo phy-
sikalische Projekte scheitern, weil sie physikalische Regeln übersehen, scheitern gesellschaftliche oder wirtschaftliche Projekte, weil sie soziale Regeln übersehen.
Eine zentrale Regel ist dabei die sogenannte Colemansche Badewanne. Diese besagt kurz zusammengefasst, dass jedes Handeln auf der individuellen bzw. korporativen Ebene einen Einfluss auf die Gesamtgesellschaft ausübt und umgekehrt. Wenn angenommen wird, dass ein permanenter Zustand geschaffen werden kann, ohne Rücksicht auf andere Ebenen wie die der Natur oder der Gesellschaft zu nehmen, so wird die soziale Regel übergangen.
Inwiefern spielen die neu verfügbaren grossen Datenmengen in diesem Zusammenhang eine Rolle? Der amerikanische Wirtschaftsjournalist Nicholas Carr verglich handgeschriebene Texte mit am Computer geschriebenen Texten derselben Personen und zeigte auf, dass in Stil und Ausdruck grosse Unterschiede vorliegen, wenn unterschiedliche Technologien zum Verfassen von Texten genutzt werden. Technologien sind damit nicht einfach nur ein Werkzeug, sie beeinflussen massgeblich, wie wir die Welt sehen und wie wir arbeiten. Dies ist bei der Datenarbeit nicht anders. Ob wir mit einem Menschen direkt reden, eine Mitschrift des Gesprächs lesen oder ihn nur als Prozentsatz angegeben haben, hat konkrete Auswirkungen darauf, wie wir Menschen wahrnehmen und wie wir mit ihnen umgehen.
Zwei daraus resultierende Effekte (die Entmenschlichung und die kurzfristige Sicht) werden im Folgenden vorgestellt. Dabei ist es wichtig, Menschen nicht allgemein zu verurteilen, die mit Daten arbeiten. Die genannten Effekte treten aus der Art der Technologienutzung heraus auf und sind somit oft nicht persönlicher Natur. Umso wichtiger ist es, auf die Effekte hinzuweisen, damit jeder, der sich mit Daten befasst, sich selbst überprüfen kann, ob er oder sie auf eine andere Weise handelt, als es eigentlich gewünscht war.
DIE ENTMENSCHLICHUNG DES MENSCHEN Dehumanisierung oder Entmenschlichung ist der Prozess, in dem einer Person oder einer Personengruppe abgesprochen wird, menschlich zu sein. Dieser Begriff erinnert an die Zeit der Kolonisation und des radikalen Nationalismus in Europa, jedoch ist er in seiner Grundfunktion bis heute erhalten. Ist ein Mensch oder eine Gruppe dehumanisiert, so fällt es dem Entscheider leichter, über diese Gruppe zu entscheiden, negative Folgen für die Gruppe in Kauf zu nehmen oder sie vollständig zu ignorieren. Tatsächlich findet auch in der heutigen Zeit eine schleichende Dehumanisierung statt. Begründet ist sie teilweise in der immer grösser werdenden Abhängigkeit von Daten und den damit verbundenen Eigenheiten.
Auf den ersten Blick mag man an Kriegsszenarien denken, in denen der Feind als Tier bezeichnet wird, damit es leichter fällt, diesen zu töten. Jedoch ist dieser Begriff neben dem Schlachtfeld auch in wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Kreisen durchaus im Gespräch. Mit dem Blick auf eine Bürokratie oder Verwaltung gestützt auf Big Data wurde bereits in einigen Kreisen der sogenannte Sieg des Rationalismus ausgerufen. Ein Sieg dadurch, fortschreitend in Entscheidungsprozessen oder Modellbildung den Einfluss von Emotionen oder Empathie auf ein Minimum zu reduzieren. Ein Beispiel hierfür ist der Versandhandel, über den bereits angemerkt wurde, dass die Mitarbeiter genauso effizient wie die Waren in den Lagern verwaltet werden können.
Der israelische Wirtschaftswissenschaftler Ariel Rubinstein führte zur Untersuchung dieses Trends eine Studie unter Studierenden unterschiedlicher Fachrichtungen durch. Er fand einen klaren Bruch zwischen den Studierenden, die Menschen vorrangig mit Statistiken und mathematischen Modellen untersuchen, wie Wirtschaftswissenschaftler, und
32 PRIVATE UNIVERSITÄT IM FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN
den Studierenden, die Menschen vorrangig auf individueller Ebene betrachten, wie Philosophen und Psychologen. Im Falle eines Konflikts zwischen einer Maximierung von Profiten und dem Wohlergehen der Menschen neigten Studierende, die in mathematischen Herangehensweisen an Menschen geschult sind, stark dazu, dem Wohlergehen eine niedrigere Bedeutung zuzuteilen.
Dieser Befund mag zunächst erschreckend wirken, doch ist er aufgrund der theoretischen Entwicklung der Datennutzung auch nachvollziehbar. Der Nutzung von grossen Datenmengen und Modellen liegt häufig ein utilitaristischer Ansatz zu Grunde. Utilitarismus ist eine Form der zweckorientierten Ethik, in der eine Handlung dann richtig sein kann, wenn sie den Gesamtnutzen maximiert. Dies kann eine valide ethische Einstellung sein; die Problematik in der Verwendung von Daten besteht jedoch darin, dass Daten nicht die Gesamtheit des Menschen darstellen können.
Innerhalb der Welt der Daten dominiert Geld als ein zentraler Faktor. Dies bezieht sich auf den Umstand, dass Geld eine Eigenschaft besitzt, die perfekt für die Darstellung im Datenformat geeignet ist. Geld ist klar messbar und es stellt genau das im Zahlenformat dar, was es ist. Anders und schwieriger ist es, weitere Faktoren der Gesellschaft darzustellen. Emotionen, Tradition oder Glaube lassen sich kaum oder nur schwer in genauen Zahlen darstellen. Schicksalsschläge wie Obdachlosigkeit oder Krankheit werden zu Prozentsätzen umgerechnet.
In den europäischen Ländern war die Umsetzung dieser datenbasierten Sichtweise grundlegend mit dem Versprechen verbunden, dass diese maximierende und rationale Entscheidungsfindung zu einem positiven Effekt für die Gesamtbevölkerung führt. Insbesondere in Zeiten, in denen Verwaltungskosten und Bürokratie neue Höchstwerte erreichen, während gesellschaftlicher Aufstieg und Wohlstand für einen grösser werdenden Teil der Menschen nicht besser, sondern schlechter zugänglich werden, führt dies zu aufkommenden Diskussionen.
SOLLTEN WIR DIE KIRCHE IM DORF LASSEN?
Ein Argument dafür, dass eine Fokussierung auf Daten dazu führen kann, dass ideelle Werte übersehen werden, lässt sich basierend auf der Entwicklung der Anzahl der Kirchen im deutschen Raum treffen. Die Anzahl sowohl von Pfarreien als auch von Priestern der katholischen Kirche in Deutschland ist seit 1995 stark rückgängig. Mithilfe einer quantitativen Sichtweise kann diesbezüglich argumentiert werden, dass die Schliessung von Kirchen und die Fusionierung von Gemeinden dadurch bedingt ist, dass die Anzahl an Kirchenaustritten hoch ist und die Gemeinden nicht mehr genügend Mitglieder besitzen. Fusion wird in dieser Hinsicht als eine Möglichkeit der Erneuerung angesehen, weil weniger, aber dafür grössere Gemeinden entstehen.
Sieht man sich den Zeitverlauf jedoch genauer an, wird deutlich, dass die Höhe der Anzahl der Kirchenaustritte zeitlich versetzt mit dem Abbau von Pfarreien und Priestern zusammenhängt. Dabei ist zu erwähnen, dass die Anzahl der Kirchenaustritte nicht monokausal bedingt ist. Jedoch zeigt die qualitative Forschung diesbezüglich auf, dass sich ein Grossteil der deutschen katholischen Christen insbesondere in kleineren Gemeinden verlassen fühlt. Geht man aus Datensicht nur nach Kirchensteuereinnahmen und der Anzahl von Mitgliedern einer Gemeinde, so ist es vermeintlich rational, Kirchen zu schliessen und zu fusionieren.
Genau an dieser Stelle werden häufig die emotionalen und traditionellen Effekte übersehen, welche auch in kleinen Gemeinden stark vorherrschen. Familien haben oft über Generationen Bindungen zu ihren Gemeinden und Kirchen auf-
gebaut. Viele der Betroffenen von Kirchenschliessungen äusserten sich diesbezüglich, dass sie es wie einen Schnitt von Seiten der Kirche in der Beziehung empfanden. Dies wiederum führt zu weiteren Austritten. Ähnliches gilt für das seelsorgerische Angebot. Wenn aufgrund der Datenlage eine Gemeinde nicht mehr als investitionswürdig erscheint und dieses Angebot abgebaut wird, so entfremdet das viele Gemeindemitglieder. Insbesondere in einer Zeit, in der eine grösser werdende Anzahl von Menschen ihre Kirchenmitgliedschaft überdenkt, ist dies signifikant.
Hieraus lässt sich schlussfolgern, dass ein Übersehen der gesellschaftlichen Regeln und Traditionen aufgrund der Datensicht trotz einer rationalen Handlungsweise andere Effekte erzeugen kann, als es im Ursprung angedacht war.
DATENBLINDHEIT FÜR LANGFRISTIGE INVESTITIONEN
Beispiele wie das vorangegangene sind in modernen Gesellschaften kein Einzelfall. Geprägt sind diese in vielen Fällen von kurzfristigen Entscheidungen, welche aufgrund der Datenlage oft als gute Möglichkeit erachtet werden. Die sogenannte Profitmaximierung ist ein zentraler Bestandteil von modernen Unternehmen und Gesellschaften. Mithilfe des Blicks auf die Welt durch Daten lässt sich dieser Profit nicht nur durch langfristige Ansätze erzeugen, sondern auch dadurch, dass kurzfristig Ausgaben gekürzt, bzw. im Fall der Kirche Fusionen durchgeführt werden.
Das Schliessen von Kirchen, das Einstellen eines politischen Programms oder die verminderten Investitionen in Technologie erhöhen allesamt die Profite, da sie die Ausgabenseite der Gleichung reduzieren. Jedoch treten in diesen Fällen langfristige Probleme auf, die durch Einsparung erzielte Profite meist zunichte machen. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob diese datenbasierte Maximierung tatsächlich das geeignete Modell für seelsorgerische Einrichtungen oder demokratische Institutionen ist.
DAS BEISPIEL DER POLITIK: IMMERWÄHRENDE UMFRAGEN
Die Bundeszentrale für politische Bildung veröffentlichte 2021 einen Artikel von Prof. Karl Rudolf Korte, in dem er die fortschreitende «Amerikanisierung» der Wahlen in Europa thematisierte. Grund dafür sei, dass die Bürger Politik fortschreitend durch die Medien erfahren und öffentliche Meinungsbilder stets in Daten zur Verfügung stehen.
Die Gefahr innerhalb dieser Datenfülle im politischen Prozess ist gross. Fortschreitend zählt nicht mehr das konkrete Umsätzen von Plänen in Gemeinden oder das Zugehen auf den Bürger, sondern eine stark auf Umfragen gestützte Sicht. Jede Äusserung und jede Handlung von Politikern wird erhoben und wirkt sich in einigen Fällen stärker, in einigen schwächer prozentual auf die Zustimmung oder auf Wahlprognosen aus. Auch hier findet eine gewisse Form der Entmenschlichung statt. Der Bürger erscheint nicht mehr als Souverän des demokratischen Staates, als Individuum, dessen Wohlergehen an erster Stelle steht, sondern als obskure Prozentzahl in Umfragen.
Dieser Vorgang führt zu realen Konsequenzen. So wird in politischen Kreisen immer mehr die Frage gestellt, ob Bürger angesprochen werden sollen, bei denen die Wahrscheinlichkeit gering ist, von ihnen gewählt zu werden. Konkret umgesetzt wird diese Überlegung bereits heute in politischen Kampagnen über ganz Deutschland. In vielen Städten werden mithilfe von grossen Datenbanken die einzelnen Stadtteile analysiert, um genau festzustellen, wie gross die Chance ist, durch Wahlwerbung oder Wahlauftritte dort Stimmen zu generieren. Wenn die prognostizierten Gewinne so gering
33 PRIVATE UNIVERSITÄT IM FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN
ANZAHL DER KIRCHENAUSTRITTE IN DEUTSCHLAND Daten von 1997 bis 2020 Anzahl Austritte in Tausend 300 T 200 T 100 T 2000 2005 2010 2015 2020 Datenquelle: Statista Datenquelle: Morningstar Investment Data ENTWICKLUNG VON PFARREIEN UND PRIESTERN IN DEUTSCHLAND Daten von 1997 bis 2020 Datenquelle: Statista Werte 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 2000 2005 2010 2015 2020 Anzahl Pfarreien Anzahl Priester JÄHRLICHE ENTWICKLUNG VON LANGFRISTIGEN AKTIENFONDS IM VERGLEICH ZU S&P 500 Daten von 2010 bis 2020 Jährliche Entwicklung 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2010 2012 2014 2016 2018 2020 AKRIX POLIX SP500
sind, dass die Kosten für die Wahlwerbung nicht aufgewogen werden, so wird die Wahlwerbung verworfen.
In der Tat ist diese Vorgehensweise effektiv und maximierend. Sie verhilft den Parteien dazu, möglichst effizient den Wahlkampf zu bestreiten. Obwohl diese Vorgehensweise als modern und rational gilt, ist sie gleichzeitig auch kurzsichtig. Seit der Einführung dieses Vorgehens sinkt die Wahlbeteiligung in Deutschland immer weiter ab. Qualitative Studien zeigen auf, dass sich immer mehr Bürger nur noch als verwaltet ansehen. Wenn Politiker kein Interesse mehr zeigen, nur weil bestimmte Datenpunkte eines Bürgers nicht mit ihren Präferenzen übereinstimmen, so fragen sich immer mehr Bürger, warum sie überhaupt noch mitwirken sollen.
An dieser Stelle wird ein weiteres Problem der datenbasierten Vorgehensweisen deutlich. Denn der Effekt auf die Bürger ist vielen Politikern bekannt. Gleichzeitig kommt allein durch die Existenz dieser Technologien ein grosser Zwang auf. Entscheidet man sich dafür, diese nicht zu nutzen, so verliert man ggf. einen grossen Teil von Stimmen und Effizienz, da andere Parteien diese nutzen.
Die kurzfristige Datensichtweise tritt jedoch auch in anderen politischen Zusammenhängen auf. Dabei sind vor allem die politischen Programme zu nennen. Diese erfordern auf kurzfristiger Basis hohe Investitionen und zahlen sich erst nach langer Zeit wieder aus. Das widerspricht jedoch dem modernen Verständnis von Politik. Als Partei erntet man für die Durchsetzung eines langfristigen Plans direkt den Missmut in Umfragen für die erhöhten Ausgaben und gleichzeitig kann man sich nicht sicher sein, ob man z.B. noch an der Regierung ist, wenn die positiven Effekte eintreten.
Wechselt die Regierung, bevor die positiven Effekte eines langfristigen Plans eintreten, so können sich andere Parteien die positiven Auswirkungen zu Nutze machen, ohne von der negativen Stimmung erhöhter Ausgaben betroffen gewesen zu sein.
Aber ist die Maximierung von Wählerstimmen wirklich der gesamte Zweck der Politik? Diese Frage benötigt eine gesellschaftliche Diskussion, denn nur, wenn eine ausreichende Aufklärung über diese Technologien vorhanden ist, wäre es Politikern möglich, nicht auf diese zurückzugreifen.
DAS BEISPIEL DER UNTERNEHMEN: PERFORMANCE UND LÖHNE
Im Gegensatz zur Politik lässt sich innerhalb der Wirtschaft eine Profitmaximierung einfacher vertreten. Mit der Entwicklung der Shareholder-Value-Orientierung ist der jährliche Profit der zentrale Bestandteil für viele Unternehmen geworden, die öffentlich gehandelt werden. Die real erzielten Umsätze erreichen jedoch in vielen Fällen nicht die prognostizierten Profitraten. In diesem Fall greifen auch Unternehmen darauf zurück, den Profit zu erhöhen, indem die Ausgabenseite gekürzt wird.
Mithilfe der grossen Datenbasis Kürzungen zu erzielen, ist für kundige Unternehmer kein grosses Problem. Das eigentliche Problem entsteht, wenn gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge ausser Acht gelassen werden und dadurch nicht nur ineffiziente Kosten oder überflüssige Verfahrensschritte gekürzt, sondern auch Gehälter, notwendige Investitionen und die Einhaltung von Umweltvorschriften angegangen werden.
Eine vermeintlich positive kurzfristige Profitentwicklung kann sich somit negativ auf die langfristige Entwicklung auswirken. Eine vergleichende Studie der Wissenschaftler Cao und Bi zeigte 2022 auf, dass Fonds mit Unternehmen, welche sich auf langfristige Investitionen stützen, im langen Zeitverlauf fortschreitend performanter sind als Fonds mit Unternehmen, die eine kurzfristige Ori-
entierung aufweisen. Während zu Beginn des vergangenen Jahrzehnts und in den ersten beiden Folgejahren beide Unternehmensarten in ihrer Performance ähnlich blieben, fuhren langfristig orientierte Unternehmen ab einem Zeitraum von fünf Jahren deutlich höhere Gewinne ein als Unternehmen mit kurzfristiger Orientierung.
Wird versucht, mit Einsparungen und kurzfristigen Ansätzen ein dauerhaft hohes Wachstum zu ermöglichen, werden dem langfristigen und nachhaltigen Wachstum durch dieses Vorgehen immer mehr die Grundlagen entzogen. Wachstum kann dann entstehen, wenn Stabilität gewährleistet ist und die Grundlagen für die Arbeit in Unternehmen ausreichend vorhanden sind. Bereits Henry Ford führte aus, dass ein Arbeiter sich die von ihm hergestellten Produkte kaufen können muss. Wenn auf der Grundlage einer datenbasierten Sicht der Arbeiter selbst zur Ware wird, so verringern Unternehmen fortschreitend die Nachfrage nach ihren eigenen Gütern.
WIE KÖNNEN WIR MIT DEN DATENMENGEN LEBEN?
Für die Einzelperson erscheinen die mit den grossen Datenmengen verbundenen Trends oft als unüberschaubar. Grosse gesellschaftliche Trends, welche durch die Verwendung von Datenmengen ausgelöst werden, übersteigen den persönlichen Einflussrahmen. Dennoch zeigt sich, dass jeder Mensch in seiner Funktion die Möglichkeit besitzt, aktiv zu werden und sich über die in diesem Artikel genannten Effekte Klarheit zu verschaffen. Bereits die gedankliche Vorstellung, dass hinter den Zahlenbergen tatsächlich reale Menschen stehen und Menschenleben grundlegend beeinflusst werden können, ist ein wichtiger Fortschritt auf dem Weg, persönlich nicht die sozialen Regeln zu übersehen. Insbesondere Wissenschaftler haben eine Mitverantwortung, diese technologischen Entwicklungen auch der Mehrheit innerhalb der Gesellschaft zugänglich zu machen und zu erläutern. Durch das Ausmass, wie Daten das Leben des Einzelnen beeinflussen, ist es unabdingbar, dass die Einzelpersonen mit in die Diskussion integriert werden. Es ist nötig, die langfristigen Auswirkungen sichtbar zu machen und Gefahren frühzeitig zu erkennen. Und es ist ein wichtiger Aspekt, die Nutzungsweise von Daten anzupassen, damit die positiven Veränderungen der Moderne nicht nur in der Theorie bestehen, sondern praktisch für Menschen erfahrbar werden.
Axel Dockhorn, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Institut für Liechtensteinisches Recht und Rechtstheorie, Private Universität im Fürstentum Liechtenstein (UFL)

Quellen
– Cao, Dongli; Bi Yusheng (2022): Environmental, Social, and Governance (ESG) Investing: How Adopting ESG Criteria Affects Performance and Risk. In: International Journal of Trade, Economics and Finance (13 (4)), S. 129–134.
– Iglauer, Theresa; Schupp, Jürgen; Priem, Maximilian (2021): Subjektives Wohlbefinden und Sorgen. In: Statistisches Bundesamt, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (Hg.): Datenreport 2021. Ein Sozialbericht für die Bundesrepublik Deutschland. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, S. 409–419. – Lanier, Jaron (2017): Dawn of the New Everything: Encounters With Reality and Virtual Reality. New York: Henry Holt and Co.
– Rubinstein, Ariel (2006): A Sceptic ,s Comment on the Study of Economics. In: The Economic Journal (116 [510]), 1–9.
35 PRIVATE UNIVERSITÄT IM FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN
DATEN
Das diesjährige Generalthema «Daten» betrifft die Rechtswissenschaft in zweierlei Hinsicht: Zum einen bilden Daten den Gegenstand des Datenrechts (I.), zum anderen werfen sie aber auch die schwierige Frage auf, ob und inwieweit Wirklichkeitstatsachen rechtswissenschaftliche Erkenntnisse begründen können (II.).
I Das
Verhältnis zwischen Rechtswissenschaft und Daten betrifft zunächst die Daten als Gegenstand rechtlicher Regelungen. Damit ist das Datenrecht angesprochen, das grundsätzlich alle Rechtsbereiche umfasst, die den Umgang mit Daten regeln. Das Datenrecht wird zunehmend als neues, eigenes Rechtsgebiet aufgefasst, das sich in der jüngeren Vergangenheit – aber auch in der absehbaren Zukunft – besonders dynamisch entwickelt hat und weiterhin entwickeln wird.
Zum Datenrecht gehört vor allem das Datenschutzrecht, das dem Schutz personenbezogener Daten und damit dem Recht dient, selbst über die Preisgabe und Verwendung persönlicher Daten zu bestimmen. Dieses Recht wird insbesondere durch den Einsatz digitaler Datenverarbeitungsprozesse gefährdet, die für den Verbraucher kaum noch überschaubar sind. Zu den Rechtsgrundlagen des Datenschutzrechts gehört die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die seit dem 20. Juli 2018 in jedem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums – und damit auch im Fürstentum Liechtenstein – unmittelbar gilt. Die DSGVO ist jedoch nicht das einzige Regelungswerk zum Datenschutz in Liechtenstein. Zu nennen sind hier insbesondere noch das Datenschutzgesetz (DSG) und die Datenschutzverordnung (DSV), die beide die DSGVO ergänzen und präzisieren und am 1. Januar 2019 in Kraft getreten sind.
Neben dem Datenschutz werden mit dem Datenrecht aber noch weitere politische Ziele verfolgt, wie etwa die Förderung des Datenzugangs, des Datenaustauschs und der
Datennutzung, ferner die Regulierung digitaler Plattformen sowie die Gewährleistung der Sicherheit von Netz- und Informationssystemen. Die Europäische Kommission verfolgt mit einer «Europäischen Datenstrategie» das Ziel, die Europäische Union, aber auch den Europäischen Wirtschaftsraum zum Vorbild für eine digitale Gesellschaft zu machen. Derzeit wird mit Hochdruck daran gearbeitet, den rechtlichen Rahmen dafür zu schaffen. Genannt seien an dieser Stelle nur der Digital Markets Act, der Digital Services Act, der Data Act und der Data Governance Act.
Das Datenrecht zählt in einer Zeit stetig voranschreitender Digitalisierung somit zu den grössten Herausforderungen von Gesetzgebung und Rechtswissenschaft. Aber auch die Akteure in der Datenwirtschaft sind angesichts eines immer komplexer werdenden Regelungsdickichts im Datenrecht mit der Schwierigkeit konfrontiert, ständig neue Anforderungen an die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen (sogenannte Compliance-Vorgaben) im Datenschutzrecht erfüllen zu müssen. Das betrifft nicht nur die Privatwirtschaft, sondern auch die öffentliche Verwaltung sowie Forschungseinrichtungen, und zwar auch in Liechtenstein.1
1 Für wertvolle Hinweise zu diesem Abschnitt danke ich Dr. Philipp Mittelberger, LL.M. Herr Dr. Mittelberger war von 2002–2017 Datenschutzbeauftragter des Fürstentums Liechtenstein und ist seit 2017 als Datenschutzexperte in der liechtensteinischen Rechtsanwaltskanzlei BATLINER WANGER BATLINER tätig.

RECHTSWISSENSCHAFT UND
36 PRIVATE UNIVERSITÄT IM FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN
Das Verhältnis zwischen Rechtswissenschaft und Daten betrifft weiterhin die Frage, ob und inwieweit Daten – jetzt im weiteren Sinne verstanden als: Wirklichkeitstatsachen – rechtswissenschaftliche Erkenntnisse begründen können. Diese Frage ist äusserst schwierig zu beantworten, und man kann als Jurist nur neidisch auf die medizinische Wissenschaft blicken, wo erhobene Daten die selbstverständliche Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisstiftung bilden. Der unproblematische Zusammenhang zwischen Daten und Erkenntnis folgt in der medizinischen Wissenschaft daraus, dass es dort um naturwissenschaftliche Erkenntnis geht, die aus den jeweils erhobenen Daten und deren Interpretation abgeleitet wird. Dagegen besteht in der Rechtswissenschaft das Erkenntnisziel gerade nicht in einer naturwissenschaftlichen Erkenntnis, sondern in einer Rechtserkenntnis. Eine Rechtserkenntnis macht keine Aussage über die Natur oder über Naturgesetzmässigkeiten, sondern über den Inhalt des Rechts und enthält damit eine normative Aussage, die vorgibt, was von Rechts wegen sein oder getan werden soll. Die Rechtserkenntnis ist also eine Sollensaussage und damit das Ergebnis einer Bewertung. Ganz zu Recht bezeichnete daher kürzlich Professor Heribert Anzinger von der Universität Ulm in einem Doktorierendenkolloquium der UFL die Rechtswissenschaft als «Wertungswissenschaft».
Ob wissenschaftliche Sollensaussagen überhaupt möglich sind, und wie sich diese erzielen lassen, ist spätestens seit Beginn des 19. Jahrhunderts bis heute höchst umstritten, und zwar nicht zuletzt auch im Hinblick auf die Begründbarkeit von Sollensaussagen mit Wirklichkeitstatsachen. Doch welche Relevanz kommt dieser Streitfrage für die Rechtswissenschaft eigentlich zu, wenn doch, wie Nichtjuristen häufig meinen, ohnehin alles Recht im Gesetz stehe und man doch einfach nur solange im Gesetz suchen müsse, bis man die passende Vorschrift gefunden habe? Diese Vorstellung ist jedoch in vielen Fällen unzutreffend. Oft genug nämlich ist der Inhalt des Gesetzesrechts unklar, umstritten oder widersprüchlich, sodass die Frage entsteht, wie sich diese Unklarheiten beseitigen oder sogenannte Meinungsstreitigkeiten entscheiden lassen. Das betrifft auch die Situation, dass über die Verfassungswidrigkeit oder Europarechtswidrigkeit – und damit letztlich: über die Unrechtmässigkeit – von Gesetzesrecht Streit entsteht. In diesem Fall muss das Verfassungs- oder Europarecht ausgelegt und konkretisiert werden, damit eine Rechtserkenntnis überhaupt erst möglich wird.
Häufig also ist der Inhalt des Rechts zweifelhaft und die Rechtserkenntnis dementsprechend problematisch. Da es sich, wie gesagt, bei der Rechtserkenntnis um das Ergebnis einer Bewertung handelt, ist somit auch die Rechtswissenschaft von den zahlreichen Meinungsverschiedenheiten betroffen, die mit dem Ob und Inwiefern wissenschaftlicher Sollensaussagen einhergehen. Es kann daher nicht verwundern, dass auch bei der Frage nach der Begründbarkeit von Rechtserkenntnissen mit Wirklichkeitstatsachen Streit herrscht: Nach einer Auffassung – die berechtigterweise darauf verweist, dass Recht doch gerade der Gestaltung der Lebenswirklichkeit dient – können Wirklichkeitstatsachen den Inhalt von Rechtserkenntnissen mitbestimmen. So wird etwa gefordert, empirische Untersuchungen darüber, ob eine Gesetzesnorm die mit ihr intendierten politischen Wirkungen hat – oder aufgrund von Veränderungen in der Lebenswirklichkeit vielleicht nicht mehr hat – in die Auslegung unklaren Gesetzesrechts mit einfliessen zu lassen.
Diese Auffassung wird jedoch von einer in der gegenwärtigen Rechtswissenschaft ganz herrschenden Meinung bestritten, die alle Rechtserkenntnis auf das bestehende, positive Recht beschränken will. Nach dieser – auch als «normwissenschaftlich» bezeichneten – Vorstellung von Rechtswissen-
schaft sind wissenschaftliche Aussagen über den Inhalt des Rechts nur im Wege einer Deskription und Analyse des positiven Rechts möglich, bei der Wirklichkeitstatsachen ausser Betracht bleiben. (Diese Überzeugung hat dazu geführt, dass die Ergebnisse der Rechtssoziologie – als der Wissenschaft von den sozialen Wirkungen und Ursachen des Rechts – bei der Gewinnung von Rechtserkenntnissen keine Rolle spielen. Das wiederum ist der Grund dafür, dass die Rechtssoziologie an den Rechtsfakultäten im deutschsprachigen Raum meist nur ein Schattendasein fristet.)
Die Anhänger einer «normwissenschaftlichen» Jurisprudenz berufen sich in ihrer Opposition gegen die erstgenannte Auffassung vor allem auf zwei Argumente: Erstens erblickt man in der Begründung von Rechtserkenntnissen mit Wirklichkeitstatsachen eine Gefahr für die Autonomie der Rechtswissenschaft gegenüber «kausalwissenschaftlichen» bzw. naturwissenschaftlichen Methoden und Ergebnissen. Zweitens wird eingewandt, dass die Einbindung von Wirklichkeitstatsachen in die rechtswissenschaftliche Erkenntnisstiftung zu sogenannten naturalistischen Fehlschlüssen führe, also zu logisch unzulässigen Schlüssen vom (empirischen) Sein – hier: von einer Wirklichkeitstatsache – auf das (normative) Sollen – hier: auf eine Rechtserkenntnis. Zumindest dieses zweite Argument überzeugt jedoch nicht, denn ein naturalistischer Fehlschluss setzt voraus, dass unmittelbar vom Sein auf das Sollen geschlossen wird. Ein naturalistischer Fehlschluss liegt nur dann vor, wenn der logische Unterschied zwischen (empirischem) Erkenntnisgegenstand und (normativem) Erkenntnisinhalt unbeachtet bleibt. Das ist aber nicht der Fall, wenn die Wirklichkeitstatsache lediglich der Begründung einer Bewertung oder Wertentscheidung dient, deren Ergebnis die Rechtserkenntnis ist.
Das führt mich schliesslich zu einer sehr ketzerischen Frage: Trifft der Vorwurf, naturalistische Fehlschlüsse zu begehen, nicht vielmehr die «normwissenschaftliche» Jurisprudenz selbst? Das positive Recht bildet jedenfalls einen Bestandteil der Erfahrungswelt, sodass es einen naturalistischen Fehlschluss darstellte, wenn aus dem empirisch vorgegebenen, positiven Recht unmittelbar – also ohne logische Vermittlung – Rechtserkenntnisse abgeleitet würden. Genau darauf zielt aber die «normwissenschaftliche» Methode ab, die rechtswissenschaftliche Erkenntnisstiftung auf die Beschreibung und Analyse des positiven Rechts beschränken will. Unter diesen Umständen bleibt dann auch die bereits genannte Differenzierung zwischen (empirischem) Erkenntnisgegenstand und (normativem) Erkenntnisinhalt unbeachtet. Dem entspricht es, dass die Anhänger dieser Auffassung den Wertungscharakter der Rechtserkenntnis vehement bestreiten, obwohl die notwendige logische Vermittlung zwischen der (empirischen) Ebene des positiven Rechts und der (normativen) Ebene der Rechtserkenntnis doch nur in einer Bewertung bzw. Wertentscheidung des Rechtswissenschaftlers bestehen kann. Welche Rolle den Wirklichkeitstatsachen bei der Begründung dieser Wertung zukommt, wird im Einzelnen noch zu klären sein.
Prof. Dr. iur. Jens Eisfeld, LL.M. (Illinois), Leiter des Instituts für Liechtensteinisches Recht und Rechtstheorie, Private Universität im Fürstentum Liechtenstein (UFL)

37 PRIVATE UNIVERSITÄT IM FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN
WISSEN SCHAFFEN, WISSEN PFLEGEN –
Blutgruppenforschung und Datenbankmanagement am Institut für Translationale Medizin der UFL
Das Institut in Triesen fungiert als weltweite Drehscheibe von Blutgruppen-Daten. Beispielhaft erklärt eine Studie zur Versorgungssicherheit syrischer Flüchtlinge mit Blut dieses Zusammenspiel von Forschung, Dokumentation und Anwendung in der Praxis.
Seit2021werden alle Daten zu Blutgruppen-Antigenen
Blutgruppen machen keinen biologischen Sinn. Sie sind einfach nur da, Resultat der menschlichen Evolution über einige Jahrzehntausende. Medizinisch betrachtet nichts weiter als eine lästige Hürde, Menschen immer und ausreichend mit Blut versorgen zu können. Aber langsam. Beim landläufig verwendeten Wort «Blutgruppe» denken alle an ihr eigenes A, B, AB, oder 0, mitunter inklusive dem Zusatz «positiv», oder «negativ». Wissenschaftlich betrachtet sind diese Angaben bereits «Blutgruppen-Antigene», die von zwei «Blutgruppen-Systemen», dem System «AB0» und «Rh» repräsentiert werden. Angaben wie «A positiv», «AB» und «0 negativ» sind jedoch nur die Spitze eines Eisbergs, mit – für den Laien meist unbekannter – enormer Vielgestaltigkeit («Polymorphismus»). Ganz allgemein erklärt, sind sogenannte «Antigene» kleine Molekülstrukturen, welche vom menschlichen Immunsystem als «fremd» erkannt werden. Bei korrekter Erkennung des «Fremden» werden dann Antikörper gegen diese Antigene gebildet. Richtet sich diese adaptive Immunreaktion gegen Bakterien, Pilze und Viren, so macht das natürlich viel biologischen Sinn und schützt uns vor Infektionen. Richtet sich die Immunreaktion jedoch gegen ein Ungeborenes (bzw. dessen Blut), oder gegen bestimmte Blutgruppen-Eigenschaften transfundierten Blutes, so ist das Resultat mitunter lebensbedrohend. Was nun tatsächlich bei einer Blutgruppen-Unverträglichkeit im Laufe einer Schwangerschaft oder im Zuge einer Fehltransfusion geschieht und wie derartige Situationen vermieden werden, ist ForschungsInhalt des Instituts für Translationale Medizin (ITM) der Privaten Universität im Fürstentum Liechtenstein (UFL). Zu diesem Zweck untersucht das Institut Details zur Vielgestaltigkeit von Blutgruppen, also den «ganzen Eisberg». Zweitens verwaltet das Institut in Triesen für die International Society of Blood Transfusion (ISBT, Amsterdam) die weltweit einzige Datenbank, die alle 382 verschiedenen «Blutgruppen-Antigene» dokumentiert. Im Folgenden illustriert ein im Jahr 2022 abgeschlossenes und publiziertes Forschungsprojekt die Arbeit des Instituts.
KÖNNEN SYRISCHE MENSCHEN MIT ZENTRALEUROPÄISCHEM SPENDERBLUT VERSORGT WERDEN?
Hintergrund: Im Sommer 2015 stellten 326 900 aus Syrien immigrierte Flüchtlinge einen Teil der grössten jemals in Deutschland beobachteten Migrationsbewegungen dar.
Migrationsbewegungen haben auch Einfluss auf die Blutversorgung. Unterschiede in der Verteilung von Blutgruppen-Antigenen für verschiedene Ethnizitäten sind bekannt. Die Versorgung einer ethnischen Gruppe mit Blut einer anderen ethnischen Gruppe kann daher zu einem erhöhten Risiko einer sog. Alloimmunisierung (Bildung von Antikörpern, unerwünschten Ereignissen) führen oder sogar ganz unmöglich sein. Zum Beispiel ist das Fehlen von Antigenen des Blutgruppensystems Gerbich, also «Gerbich-Negativität», grundsätzlich sehr selten, soll aber bei Menschen aus dem Nahen Osten wesentlich häufiger vorkommen. Würde sich dieser Hinweis bestätigen, so wäre die Versorgungssicherheit mit Blut für Immigranten aus dem Nahen Osten mitunter nicht ausreichend gewährleistet. Ziel und Methode: In diesem Kontext untersuchte das ITM in Kooperation mit dem Blutspendedienst West des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Bad Kreuznach, ob es Unterschiede in der Ausprägung der Blutgruppe «Gerbich» zwischen Syrern (potenzielle Blutempfänger) und Deutschen (Blutspender) gibt und ob diese potenziellen Unterschiede Einfluss auf die Blutversorgen haben könnten. Methode: Mittels molekularbiologischer Verfahren wurde die Häufigkeit von «Gerbich-Negativität» an 1665 vorwiegend syrischen Flüchtlingen bestimmt und mit Daten von 507 Deutschen verglichen. Resultat: Tatsächlich fanden sich unter SyrerInnen vermehrt «Gerbich-Negative», wohingegen unter Deutschen, also unter der vorliegenden Spenderbevölkerung, kein einziger derartiger Mensch identifiziert werden konnte. Trotzdem bleibt die Eigenschaft «Gerbich-Negativität» auch unter Syrern und Syrerinnen selten und können derartige Menschen in Einzelfällen auch in Deutschland mit Blut versorgt werden. Fazit: Transfusionsmedizinern wurde empfohlen, bei Schwangeren und BlutempfängerInnen aus dem Nahen Osten das Blutgruppensystem «Gerbich» besonders zu berücksichtigen. Ausblick: Das beschriebene Verfahren zur genetischen Suche nach Trägern dieser «Gerbich-Negativität» war eine innovative Eigenentwicklung der beteiligten Forscher, basierte auf eigenständigen wissenschaftlichen Vorarbeiten und wurde derartig erstmals für die Suche nach «Gerbich-Negativen» eingesetzt 1 Eine konsequente weitere «Translation» der erzielten Forschungsresultate könnte nun die grossflächige und routinemässige Verwendung der entwickelten molekularen Methode zur Suche nach Gerbich-negativen Blutspenden unter Zentraleuropäern sein.
38 PRIVATE UNIVERSITÄT IM FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN
Boston Philadelphia Campinas São Paulo New York Bethesda San Marcos
zentralin Triesen für die ganzeWeltdokumentiert.
ISBT IST DAS GLOBALE WISSENSNETZWERK
FÜR TRANSFUSIONSMEDIZIN
Die vollständige Kenntnis der Art und Vielfalt der bekannten Blutgruppen sowie deren Allele und Antigene ist die wichtigste Voraussetzung für das sichere Gelingen von Bluttransfusionen.
Die Non-Profit-Organisation ISBT (Internationale Gesellschaft für Bluttransfusion) hat es sich deshalb seit 1935 zur Aufgabe gemacht, das lebensrettende Wissen über Blutgruppen stetig zu erweitern und zu dokumentieren. Das ITM stellt derzeit einen der beiden Vorsitzenden der ISBT-Arbeitsgruppe «Red Cell Immunogenetics and Blood Group Terminology (RCI&BGT)» 2, Professor Christoph Gassner. Innerhalb dieser Arbeitsgruppe dokumentieren 27 international anerkannte Blutgruppen-Experten und deren Teams bekannte Blutgruppensysteme, entdecken, auch gemeinsam mit externen Forschern, regelmässig neue Systeme und neue Antigene bekannter Systeme und ordnen und benennen diese Neuentdeckungen. Heute sind insgesamt 43 Blutgruppensysteme beschrieben, von denen allein seit 2018 sieben neu entdeckt wurden. Jedes dieser Systeme wird von mindestens einem Gen kodiert. Varianten dieser Gene werden «Allele» genannt. Allele entstanden im Zuge natürlicher Evolution über Jahrzehntausende, unterscheiden sich durch Mutationen voneinander und differieren oft von Mensch zu Mensch. Derart entstanden nicht nur die drei verschiedenen HauptAllele des AB0-Systems, die für die Phänotypen A, B, AB und 0 kodieren, sondern alle der heute bekannten 349 menschlichen Blutgruppenantigene, die den 43 verschiedenen Blutgruppensystemen zugeordnet sind. Ein für die Arbeitsgruppe tätiger und von der ISBT beauftragte Datenexperte ordnet, betreut und verwaltet diese Blutgruppen-Vielgestaltigkeit vor allem auf genetischer Ebene. Er ist am ITM und damit am Sitz der UFL in Triesen tätig und koordiniert von dort auch die weltumspannende Kommunikation der Mitglieder der ISBTArbeitsgruppe. Die UFL fungiert somit seit 2021 als Zentrum für die gesamte Kommunikation und Koordination aller Tätigkeiten der ISBT-Arbeitsgruppe «Immungenetik und Blutgruppen-Terminologie», und zwar für die ganze Welt.
Zusammenfassend erlauben die beschriebenen Forschungs- und Dokumentationsarbeiten die faktische Anwendung von wissenschaftlichen Daten und unterstreichen damit den «translationalen Charakter» des Instituts für Translationale Medizin: «Weltweit bedeutende, wissenschaftliche Arbeiten zur konstanten Verbesserung der Versorgung von Menschen mit dem natürlichen Medikament Blut».

Ing. Harald Obergasser, Kurator Blutgruppenallele, Internationale Bluttransfusionsgesellschaft (ISBT), Private Universität im Fürstentum Liechtenstein (UFL)


Prof. Dr. rer. nat. Christoph Gassner, Pro-Rektor Forschung, Institutsleiter Institut für Translationale Medizin, Private Universität im Fürstentum Liechtenstein (UFL)
1 Gassner C, Scherer V, Zanolin-Purin D, Scharberg EA, Flesch B. Occurrence of Rare Deletional Yus and Gerbich Alleles in Syria and Neighbouring Countries. Transfus Med Hemother 2022:1–9.
39 PRIVATE UNIVERSITÄT IM FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN
Cambridge Ulm
Lund Bristol
Kopenhagen Springe ISBT-Amsterdam UFL-Triesen
Barcelona FORSCHUNGSSTANDORTE DER MITGLIEDER DER ISBT WORKING PARTY FÜR RED CELL IMMUNOGENETICS AND BLOOD GROUP TERMINOLOGY
Paris
Tel Aviv Osaka Nanjing Guangzhou Brisbane
Dr. scient. med. Daniela Purin, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Institut für Translationale Medizin, Private Universität im Fürstentum Liechtenstein (UFL)
2 Red Cell Immunogenetics and Blood Group Terminology. Names for GE (ISBT 020) Blood Group Alleles; 2020 Mar 1 https://www.isbtweb.org/isbt-workingparties/rcibgt.html.
NEUES IM KAMPF GEGEN EINE DER HÄUFIGSTEN
GESCHLECHTSKRANKHEITEN: Molekulare Resistenzprüfung bei Neisseria gonorrhoeae
Im 21. Jahrhundert hat Neisseria gonorrhoeae laut der WHO den Status eines «Superbugs» erreicht: Es besteht die Gefahr, dass in Zukunft Tripper nicht mehr behandelbar sein wird. Dieser Beitrag zeigt, welche zentrale Rolle die Resistenzprüfung in der Bekämpfung von Neisseria gonorrhoeae einnimmt und welche neuen Wege dabei in der Diagnostik beschritten werden.
Neisseria gonorrhoeae ist der Erreger der Gonorrhoe, des Trippers. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft Neisseria gonorrhoeae als einen der häufigsten sexuell übertragbaren Erreger ein. Der Erreger selbst präsentiert sich als ein klinisches Chamäleon: Eine unkomplizierte Gonokokken-Infektion tritt oft in Form einer Harnleiterentzündung (Urethritis) auf. Bei Männern verläuft diese meist symptomatisch und ist mit starken Schmerzen verbunden. Kommt es zu einer Chronifizierung, kann es durch das Aufsteigen der Infektion zu Entzündungen im Nebenhoden und der Prostata kommen. Hingegen verläuft die Infektion bei Frauen oft asymptomatisch oder mit ganz wenig Symptomen, der akute Verlauf ähnelt am ehesten einer unspezifischen bakteriellen Entzündung des Gebärmutterhalses. Bei einer unbemerkten Infektion können im Rahmen einer chronischen Entzündung die Eileiter vernarben oder das Becken sich entzünden, was zu Unfruchtbarkeit führen kann.
Neisseria gonorrhoeae fühlt sich aber nicht nur im Urogenitaltrakt wohl. Die Schleimhäute von Enddarm und Ra-
chen können ebenso besiedelt, respektive infiziert werden, ebenso die Bindehaut des Auges. In früheren Jahren war besonders die Blennorrhoe bei Neugeborenen gefürchtet, weswegen eine Credé-Prophylaxe, bestehend aus Silbernitrat, jedem Neugeborenen verabreicht wurde. Die unterschiedlichen Infektionsorte und klinischen Ausprägungen von Infektionen mit Neisseria gonorrhoeae stellen sowohl Mediziner als auch Diagnostiklabore vor besondere Herausforderungen.
Der Umgang mit dem 1879 entdeckten Erreger ist geprägt von einem Wechselspiel zwischen der Entdeckung von neuen erfolgreichen Behandlungsmethoden und der Akquirierung von Resistenzmechanismen von Seiten des Erregers. Resistenzmechanismen sind Mechanismen, mit denen der Erreger der Wirkung eines speziellen Antibiotikums entkommt. Der Erreger lernt durch die Ausbildung von Resistenzmechanismen, trotz Antibiotikatherapie zu überleben, was die Wirkung der Therapie verhindert oder zumindest einschränkt. Nach jeder Einführung einer neuen Antibioti-

40 PRIVATE UNIVERSITÄT IM FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN
ka-Therapie traten die ersten resistenten Fälle typischerweise innerhalb eines Jahrzehnts auf. 1 Zurzeit kann eine unkomplizierte Gonorrhoe in aller Regel erfolgreich mit der Kombination der Antibiotika Ceftriaxon und Azithromycin behandelt werden. Im Jahre 2021 stufte die WHO die Erforschung und Entwicklung von neuen Antibiotika gegen resistente Neisseria gonorrhoeae allerdings als dringlich ein.
In der Diagnostik werden vor allem zwei Möglichkeiten für den Nachweis von Neisseria gonorrhoeae angewendet. Das anspruchsvolle Bakterium kann auf Spezialmedien nach einer Inkubationszeit von mindestens 48 Stunden angezüchtet werden. Die Kultivierung des Erregers bietet den Vorteil, dass eine Typisierung und eine phänotypische Resistenzprüfung durchgeführt werden können. Allerdings kann vor allem bei asymptomatischen Trägern die Keimbelastung so niedrig sein, dass der Erreger den Transport von der Praxis bis ins Labor nicht überlebt. Bis heute gelten dennoch derartige am Bakteriums selbst (sogenannte phänotypische) Methoden zur Prüfung der Empfindlichkeit von Antibiotika als der Goldstandard, trotz ihrer bekannten Nachteile wie die geringe Wiederfindungsrate und den grossen Zeitaufwand.
Eine alternative Methode ist die real-time polymerasechain-reaction (RT-PCR). Diese Methode vervielfältigt geringste Mengen von in einer Probe vorhandener Erbsubstanz des Erregers so stark, dass spezifische Gene des Erregers analysiert werden können. Sie erlaubt es, direkt aus der Patientenprobe Neisseria gonorrhoeae spezifische genetische Eigenschaften nachzuweisen. Im Vergleich zur Kultur besitzt die real-time RT-PCR eine höhere Sensitivität und sehr wesentliche Zeitersparnis. Trotzdem werden in vielen Mikrobiologielaboratorien der Schweiz die Urogenitalproben mittels Kulturverfahren auf Neisseria gonorrhoeae gescreent.
Wir untersuchten den Einfluss eines alternativen Workflows auf die Nachweisrate von Neisseria gonorrhoeae aus Urogenitalproben bei asymptomatischen oder gering symptomatischen Frauen. In 0.40 % (38/9575) aller Proben wurde der Erreger diagnostiziert, davon wurden 100 % (38/38, 95 % CI 85.6 %–100 %) durch die real-time RT-PCR detektiert, jedoch nur 57.90 % (22/38, 95 % CI 40.8 %–73.7 %) durch das Kulturverfahren. Somit wäre in fast der Hälfte der Fälle eine Gonokokken-Infektion verpasst worden, wenn man sich nur auf das Kulturverfahren verlassen hätte. In 23 % (9/38) der Fälle wurde zusätzlich eine Co-Infektion mit Chlamydia trachomatis festgestellt, ein Erreger, der sich mit konventionellen Verfahren nicht kultivieren lässt. In unserem Labor hat sich daher die RT-PCR etabliert. Bei einem positiven RT-PCR Resultat wird zusätzlich versucht, den Erreger kulturell anzuzüchten.
Das Vertrauen der klinisch tätigen Ärzte in die bis heute sehr erfolgreiche Dual-Therapie und die erhöhte Sensitivität und Zeitersparnis mit den molekularen Detektionsmethoden hatten weitreichende Folgen auf die Art und Weise, wie Neisseria gonorrhoeae diagnostiziert und behandelt wurde. Ein geradliniger Algorithmus, bestehend aus einer PCR-Methode ohne Kulturverfahren und empirischer Behandlung schien optimal. Asymptomatische Träger wie auch Co-Infektionen wurden erfasst und zukünftige Resistenzentwicklung muteten in weiter Ferne an. Alles gut also? Nein. Schon 2017 modellierten Fingerhuth et al. in einer Studie unter anderem den Verlauf einer Resistenzentwicklung, wenn diagnostisch nur der direkte Nachweis ohne phänotypische Resistenzprüfung erfolgt.2 Ihre Feststellung: Dieses Procedere würde die Verbreitung von antibiotika-resistenten Gonokokken beschleunigen.
Dies spiegelte sich in der Realität wider. Die ersten multiresistenten Stämme mit Ceftriaxon- und Azithromycin-Resistenz wurden 2018 im vereinigten Königreich und in Aus-
tralien nachgewiesen. Auch in der Schweiz traten die ersten Fälle von auf Ceftriaxon reduziert empfindliche wie auch auf Ceftriaxon resistente Neisseria-gonorrhoeae-Stämmen auf.3 Die Europäischen Guidelines für die Diagnose und Behandlung von Gonorrhoe in Erwachsenen von 2020 weisen darauf hin, dass idealerweise eine Kultur auf ein positives PCR-Resultat folgen sollte. Doch selbst wenn die kulturelle Testung durchgeführt wird, bleibt die grosse Diskrepanz zwischen positiven RT-PCR und negativen Kulturverfahren bestehen. Besonders bei klinischen Proben von asymptomatischen Trägerinnen sowie pharyngalen und rektalen Proben würde die antibiotische Resistenzgrundlage weiterhin fehlen.
Die molekulare Resistenzprüfung bietet allerdings die Möglichkeit, Detektion und Resistenzprüfung miteinander zu kombinieren. Vor allem für das Antibiotikum Ciprofloxacin korrelieren Punktmutationen in den Resistenzgenen gyrA und parC gut mit dem jeweiligen Phänotyp aus der kulturellen Resistenzprüfung. In einem weiteren Forschungsprojekt gelang es uns, Resistenz bestimmende Regionen aus den Resistenzgenen gyrA und parC mittels SYBR Green RTPCR direkt aus der klinischen Probe nachzuweisen. Der molekulare Nachweis gelang dabei in 90.2 % (46/51) der Fälle.
Eines ist sicher: Ohne eine molekulare Resistenzprüfung oder eine phänotypische Resistenzprüfung mit Kultur kann die Ausbreitung von multiresistenten Neisseria gonorrhoeae nicht aufgehalten werden. Unsere Arbeit zeigt, dass in sehr vielen Fällen die Limitationen der Bakterienkultur bei Neisseria gonorrhoeae durch eine Resistenzprüfung mit RTPCR überwunden werden könnten.
Anna Roditscheff, MSc ETH Biologie FAMH Medizinische Mikrobiologie, NF Klinische Chemie und Hämatologie, Labor Dr. Risch, Doktorandin an der Privaten Universität im Fürstentum Liechtenstein (UFL)

1 Unemo M, Shafer WM. Antimicrobial resistance in Neisseria gonorrhoeae in the 21st century: past, evolution, and future. Clin Microbiol Rev. 2014 Jul;27(3):587-613. doi: 10.1128/CMR.00010-14. PMID: 24982323; PMCID: PMC4135894.
2 Fingerhuth SM, Low N, Bonhoeffer S, Althaus CL. Detection of antibiotic resistance is essential for gonorrhoea point-of-care testing: a mathematical modelling study. BMC Med. 2017 Jul 26;15(1):142. doi: 10.1186/s12916017-0881-x. PMID: 28747205; PMCID: PMC5530576.
3 Egli K, Roditscheff A, Flückiger U, Risch M, Risch L, Bodmer T. Molecular characterization of a ceftriaxone-resistant Neisseria gonorrhoeae strain found in Switzerland: a case report. Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2021 Aug 6;20(1):52. doi: 10.1186/s12941-021-00456-5. PMID: 34362393; PMCID: PMC8349002.
41 PRIVATE UNIVERSITÄT IM FÜRSTENTUM
LIECHTENSTEIN
BEOBACHTUNGSSTUDIE ZU BLUTHOCHDRUCK, COVID-19-FRÜHERKENNUNG, NEUEN BIOMARKERN UND WETTERFÜHLIGKEIT BEI FÖHN
Das Team der Liechtensteiner GAPP-Studie untersucht am Studienzentrum in Vaduz einzigartige und vielversprechende Forschungsprojekte von internationaler Bedeutung.
DIE GAPP-STUDIE
Die GAPP-Studie (Genetic and phenotypic determinants of blood pressure and other cardiovascular risk factors; www. blutdruck.li) ist eine grosse Beobachtungsstudie, die die Entwicklung von Risikofaktoren für kardiovaskuläre Erkrankungen wie z.B. Herzinfarkt oder Schlaganfall untersucht. Es wurden zwischen 2010 und 2013 alle Einwohner von Liechtenstein im Alter zwischen 25 – 40 Jahren zur Teilnahme eingeladen. Hauptziel dieser Studie ist die Erforschung der Ursachen von Bluthochdruck und anderen Risikofaktoren wie Diabetes, hohe Blutfette, Entzündungsfaktoren, die für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verantwortlich sind (Abbildung 1).1
Kardiovaskuläre Erkrankungen gehören weltweit zu den häufigsten Todesursachen. Die Prävention von kardiovaskulären Erkrankungen ist somit von grosser Wichtigkeit und beginnt bei der Verhinderung von Risikofaktoren. Klar ist, dass der persönliche Lebensstil und auch genetische Faktoren eine wichtige Rolle spielen bei der Entwicklung von Bluthochdruck, Diabetes oder hohen Cholesterinwerten.
Aufgrund der jungen, gesunden Studienteilnehmer und dem über einen langen Zeitverlauf angelegten Studiendesign der GAPP-Studie kann die Entstehung von kardiovaskulären Risikofaktoren über die Zeit beobachtet werden und mit verschiedensten potenziellen Markern in Zusammenhang gebracht werden.
Eine Langzeitstudie von diesem Format ist in Europa einzigartig und von sehr hohem Stellenwert.
DIE COVI-GAPP-STUDIE FÜR EINE PRÄSYMPTOMATISCHE COVID-19FRÜHERKENNUNG
Mit Ausbruch des Coronavirus (SARSCoV-2) wurde im April 2020 die COVI-GAPPStudie (www.covi-gapp.li) gestartet. Ziel der COVI-GAPP-Studie war, mit einem ursprünglich als Fertilitätstracker entwickelten sensorischen Armband (Ava-Armband) eine mögliche COVID-19-Früherkennung zu untersuchen. Von den 2170 GAPP-Probanden konnten 1144 Probanden für eine Teilnahme an der COVI-GAPPStudie rekrutiert werden. Das sensorische Ava-Armband wurde von den Studienteilnehmern während der Nacht getragen und zeichnete alle 10 Sekunden die physiologischen Parameter Herzfrequenz, Atemfrequenz, Herzfrequenzvariabilität, Durchblutung, Hauttemperatur, Schlafqualität und Bewegung auf. Allen Studienteilnehmern wurde im Verlauf der COVID-19-Pandemie regelmässig Vollblutproben entnommen, um labordiagnostische Testergebnisse und Antikörperreaktionen zu überwachen.
Übersicht GAPP-Studie
Ausführlicher Fragebogen
Blutdruckmessung Grösse und Gewicht
Nächtliche Pulsoxymetrie
Ruhe-EKG (5 Minuten)
Lungenfunktionstest
Blut- und Urinuntersuchung
Bioelektrische Impedanzanalyse
Bewegungsmesser
24-h-Blutdruckmessung und EKG
24
42 PRIVATE UNIVERSITÄT IM FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN
Es konnte ein Algorithmus definiert werden, der zwei Tage vor Symptombeginn Veränderungen der physiologischen Parameter erkennt.2 Der Verlauf der physiologischen Parameter ist der Abbildung dargestellt. Eine folgende europäische Studie (www.covid-red.eu) hat den in der Pilotstudie COVI-GAPP entwickelten Algorithmus an 20 000 Probanden weiterentwickelt und getestet. Erste Ergebnisse werden auf Ende 2022 erwartet. Tragbare Geräte mit entsprechenden Applikationen können in Zukunft eine wichtige Rolle einnehmen, um bei der Eindämmung einer raschen Virusverbreitung zu unterstützen. Sie können frühzeitige Isolierungen asymptomatischer Personen ermöglichen sowie eine frühzeitige diagnostische Labortestung empfehlen.
EIN NEUER BIOMARKER FÜR DIE DIAGNOSE
VON LONG COVID?
Seit der Coronapandemie gibt es viele Berichte über die Symptomatik und den Verlauf der Coronavirus-Erkrankung 2019 (COVID-19). Die Symptome sind sehr vielfältig und reichen von den häufigen und typischen milden Symptomen wie Fieber, Müdigkeit und Husten über seltenere Symptome wie Magen-Darmbeschwerden über schwere respiratorische Symptome, Nieren- oder Herzversagen bis hin zum Tod.
Zusätzlich häuften sich bereits Wochen nach dem Beginn der Pandemie Berichte über diverse milde bis schwere neurologische Manifestationen wie Geruchs-, Geschmacksstörungen, ausgeprägte Müdigkeit (Fatigue), Kopfschmerzen oder Schlaganfälle. Über viele dieser Symptome wurde in der akuten Phase der COVID-19-Infektion berichtet, aber es mehren sich Beweise, dass neurologische Symptome auch nach der akuten Phase der Infektion persistieren können, unabhängig vom Schweregrad.
Die Pathophysiologie, die diesen neurologischen Symptomen zugrunde liegt und der Grad der neurologischen Beteiligung bei COVID-19 Infektion ist noch nicht vollständig geklärt und erschwert somit die Diagnosestellung. Erste vielversprechende Ergebnisse konnten zeigen, dass das Protein Neurofilament Light (NfL), ein Marker für neuronale Schädigungen im zentralen Nervensystem, bei hospitalisierten COVID-19-Patient:Innen oder nach schweren COVID19-Verläufen freigesetzt wird und sich somit als Biomarker für «Neuro-COVID-19» eignen könnte.3 Aktuell gibt es wenige Daten über das Verhalten des Biomarkers nach einer milden oder moderaten COVID-19-Infektion. Deshalb hat es sich das Team der COVI-GAPP-Studie zum Ziel gesetzt, eine mögliche Assoziation dieses NfL-Biomarkers und häufig beschriebenen und länger bestehenden COVID-19-Symptomen zu untersuchen. Damit kann möglicherweise ein besseres Verständnis und eine bessere Diagnostik der Long-COVIDSymptome erreicht werden.
WETTERFÜHLIGKEIT BEI FÖHNWETTERLAGE: EINBILDUNG ODER WAHRHEIT?
Wer im Rheintal im östlichen Zipfel der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein wohnt, kennt ihn nur zu gut, den warmen, meist trockenen Wind, der häufig im Herbst und Winter kräftig durchs Tal bläst; Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schlafprobleme und Unwohlsein sind nur vier der häufigen Symptome, welche von einer relativ grossen Anzahl von Menschen dabei berichtet werden. Um das Phänomen der Wetterfühligkeit besser zu charakterisieren – es ist bisher sehr wenig über die physiologischen Grundlagen der Wetterfühligkeit bekannt –, hat das GAPP-Studien-Team in Zusammenarbeit mit dem Wetterring Liechtenstein (www.wetterring.li) eine neue Studie initiiert: die Föhn-Studie. In dieser Studie werden in einem ersten Schritt Wetterdaten (z.B. Vorkommen von Föhnwinden, Windstärke) aus neun verschiede-
nen liechtensteinischen Wetterstationen in Zusammenhang gesetzt mit Messungen, welche im Rahmen der GAPP- und COVI-GAPP-Studien ermittelt wurden. Damit erhoffen wir uns ein besseres Verständnis der Wetterfühligkeit im Allgemeinen und einem allfälligen Zusammenhang zwischen Wetterfühligkeit und dem Auftreten von Long COVID andererseits.
AUSBLICK
Die momentanen Arbeiten adressieren Themen, welche analog den bereits publizierten Berichten für die internationale wissenschaftlichen Gemeinde von grossem Interesse sind. Die bisherigen Arbeiten wurden weitgehend durch Drittmittel gefördert und waren die Grundlage für Dissertationen an der Privaten Universität im Fürstentum Liechtenstein sowie an den Universitäten Basel und Bern. Mit jedem Jahr fortgeführter Forschungstätigkeit gewinnen die gewonnenen Resultate an Aussagekraft, was den aktuell acht Angestellten und studentischen Mitarbeitenden Motivation für ihren begeisterten und beständigen Einsatz in der einzigartigen Forschungslandschaft Liechtenstein gibt. Dieser Einsatz ist es, welcher eindrücklich darlegt, wie etwas, was im kleinen Land Liechtenstein konsequent betrieben wird, auch für die grosse weite Fachwelt Relevanz bekommen kann.
DANK
Die COVI-GAPP-Studie wurde vom Fürstenhaus von und zu Liechtenstein sowie von der liechtensteinischen Regierung unterstützt.
Ornella C. Weideli, PhD, Studienkoordinatorin und wissenschaftliche Mitarbeiterin GAPP
Julia Telser, MSc, Klinische Immunologie und wissenschaftliche Mitarbeiterin GAPP, Doktorandin an der Privaten Universität im Fürstentum Liechtenstein (UFL)
Laura Velez Colorado, BSc, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Institut für Labormedizin (in Gründung), Private Universität im Fürstentum Liechtenstein (UFL)
Kirsten Grossmann-von Haugwitz, MSc, Leitung GAPP-Studie, Doktorandin an der Privaten Universität im Fürstentum Liechtenstein (UFL)




Prof. Dr. med. Lorenz Risch, MPH MHA, Leiter Institutsgründung, Institut für Labormedizin (in Gründung), Private Universität im Fürstentum Liechtenstein (UFL)

1 D. Conen et al., «Genetic and phenotypic determinants of blood pressure and other cardiovascular risk factors: Methodology of a prospective, populationbased cohort study,» Swiss Med. Wkly., vol. 143, no. January, pp. 1–9, 2013, doi: 10.4414/smw.2013.13728.
2 M. Risch et al., «Investigation of the use of a sensor bracelet for the presymptomatic detection of changes in physiological parameters related to COVID- interim analysis of a prospective cohort study (COVI- GAPP),» pp. 1–12, 2022, doi: 10.1136/bmjopen-2021-058274.
3 C. Li, J. Liu, J. Lin, and H. Shang, «COVID-19 and risk of neurodegenerative disorders: A Mendelian randomization study,» Transl. Psychiatry, vol. 12, no. 1, p. 283, 2022, doi: 10.1038/s41398-022-02052-3.
43 PRIVATE UNIVERSITÄT IM FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN
Mittels der Sequenzierung von SARS-CoV-2-positiven Proben wird das gesamte virale Genom entschlüsselt, um so spezifische Varianten bestimmen zu können. Mutationen des Virus, die den Verlauf der Erkrankung verschlimmern, die Übertragbarkeit des Virus erhöhen oder den gegebenen Impfschutz erniedrigen können, werden so entdeckt. In dieser Hinsicht bietet die Sequenzierung den Verantwortlichen ein wertvolles Tool, um bestehend auf momentanen Daten Entscheidungen zur zukünftigen Corona-Politik zu treffen.
Viren, wie etwa SARS-CoV-2, der Erreger von COVID19, befallen Wirtszellen, die sie für die Replikation ihres Erbguts verwenden.1 Sie können sich verändern (mutieren), wenn sie sich in ihrem Wirt replizieren und weiterverbreiten. Mit jeder Replikation besteht die Chance, dass das Virus eine Mutation in seinen genetischen Code einbaut, die an seine Abkömmlinge weitervererbt wird. Je mehr Menschen sich
infizieren, desto mehr Replikationen können stattfinden und desto mehr Mutationen entstehen. Ob diese Veränderungen die Eigenschaften des Virus nun beeinflussen oder nicht, ist Zufall. Die meisten Mutationen haben keinen Einfluss auf die Übertragung oder die Verbreitung des Virus, da sie keine Veränderung wichtiger Proteine, die für diese Prozesse benötigt werden, zur Folge haben.
SEQUENZIERUNGSRESULTATE – JULI 2021 BIS JULI 2022 – FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN
Sequenzierungsresultate von 1 380 SARS-CoV-2 positiven Proben aus Liechtenstein. 97 % konnten den übergeordneten Varianten Delta, Omicron BA.1, BA.2 und BA.5 zugeordnet werden.
SARS-COV-2-SEQUENZIERUNG IN LIECHTENSTEIN
PCR-Tests Sequenzierungen (8.7 % der Positiven) Negativ 80.1 % Positiv 19.9 % Omicron BA.5 1.7 % Andere 3.1 % Delta 30.1 % Omicron BA.1 31.1 % Omicron BA.2 34 % 44 PRIVATE
IM FÜRSTENTUM
UNIVERSITÄT
LIECHTENSTEIN
Wenn eine Mutation aber die Übertragbarkeit des Virus erleichtert, kann dies zu einem kompetitiven Vorteil gegenüber anderen Viren, die diese Mutation nicht besitzen, führen. Über die Zeit verbreiten sich die mutierten Viren nun schneller und ihre Prävalenz nimmt zu. Sind die Veränderungen so einschneidend, dass Auswirkungen auf das Gesundheitssystem zu befürchten sind, werden diese Mutanten von offizieller Seite (WHO, CDC, ECDC) als neue Varianten («variants of interest» oder «variants of concern») klassifiziert.
Variante Infektionen Dauer Zeitraum Infektionen (Total) (Wochen) (Dominanz) pro Woche
Alpha 494 19 Jan – Mai 2021 26
Delta 2904 26 Mai – Dez 2021 112
Omicron BA.1 5946 9 Jan – Feb 2022 661
Omicron BA.2 5548 14 März – Juni 2022 112
Omicron BA.5 1173 13 Juni – Aug 2022 129
Neben dem Einfluss auf die Übertragbarkeit können Mutationen auch in anderen Bereichen Auswirkungen zeigen. So kann die Ansammlung von genügend Mutationen einen Impfschutz abschwächen, da die bei der Impfung gebildeten Antikörper nicht mehr gleich effizient an die viralen Proteine binden können. Reinfektionen werden dadurch ebenso wahrscheinlicher. Durch denselben Mechanismus kann auch das Ansprechen auf eine Therapie mit monoklonalen Antikörpern abgeschwächt werden. So konnte gezeigt werden, dass die Omicron-Varianten von SARS-CoV-2, mit 30+ Mutationen im Spike-Protein, nicht mehr auf eine Therapie mit pharmazeutisch hergestellten Antikörpern ansprechen.2 Auch ist der Schutz nach 2-facher BioNTechPfizer-Impfung stark erniedrigt. Eine Booster-Impfung hingegensowie eine Zweitimpfung mit einem anderen Impfstoff, erhöhen diesen Schutz wieder.3 Weiter können Mutationen den klinischen Verlauf der Erkrankung verändern, den Zustand des Patienten bei Infektion also verschlimmern oder mildern, was wiederum direkte Auswirkungen auf die Hospitalisierungsrate hat.
Mittels der genetischen Sequenzierung können die verschiedenen Varianten identifiziert und voneinander unterschieden werden. Dabei wird das komplette virale Genom entschlüsselt. Die gesammelten Daten unterstützen anschliessend die Verantwortlichen in ihren Entscheidungen.4 So können z.B. Massnahmen wie Lockdowns veranlasst werden, um die Verbreitung einer neuen Variante mit besserer Übertragbarkeit oder geringerem Impfschutz zu verlangsamen. Darüber hinaus können Vorkehrungen für potenzielle Infektionswellen veranlasst werden. Es kann etwa die Bettenanzahl im Spital und der Vorrat an Sauerstoffflaschen erhöht oder das allgemeine Testen intensiviert werden.
Grundsätzlich finden Sequenzierungsdaten in vielen Bereichen Anwendung. Hauptaufgaben bestehen aber in der Charakterisierung des Virus auf genetischer Ebene, der Abschätzung der Prävalenz einer bestimmten Variante in einer Population sowie der Abschätzung des Effekts medizinischer Interventionen (Impfungen, Antikörpertherapie) oder der Einschätzung der Verbreitung des Virus in einem lokalen Ausbruch.
Das Team vom Labor Dr. Risch führt neben den PCRTestungen seit Juli 2021 auch Sequenzierungen für das Fürstentum Liechtenstein durch. In diesem Rahmen wurden in den vergangenen 12 Monaten 1380 Einzelproben sequenziert, was 8.7 % aller positiv getesteten Proben in diesem Zeitraum entspricht. Dabei wurden 64 verschiedene Subvarianten festgestellt. 97 % der Proben konnten aber 50 Subvarianten, die den übergeordneten Varianten Delta sowie Omicron BA.1, BA.2 und BA.5, angehören, zugeordnet werden.
Subvarianten werden definiert, sobald sich das Virus durch mindestens eine Mutation von seiner «Eltern»-Variante unterscheidet, die «Eltern»-spezifischen Mutationen beibehält und gezeigt werden konnte, dass diese neue Variante weiterverbreitet wird. 5 So wurden bei der Delta-Variante insgesamt 244 Subvarianten beschrieben. Die Omicron BA.1-Variante, die in Liechtenstein nur von kurzer Dauer war, wurde
Charakteristika der bisherigen, dominanten SARS-CoV-2 Varianten in Liechtenstein. Trotz einer relativ kurzen Dauer von 9 Wochen ist die Omicron BA.1 Variante bisher für die meisten Infektionen verantwortlich. (Infektionen entsprechen den positiven Tests im Zeitraum, in dem die jeweilige Variante für mehr als 50 % aller Neuansteckungen verant wortlich war.)
in 53 Subvarianten unterteilt, die anschliessende BA.2-Variante in 117 Subvarianten und die zurzeit dominante BA.5-Variante in bisher 77 Subvarianten.
Überschlagsmässig sieht es in Liechtenstein so aus, dass, obgleich der kurzen Dominanz von nur zwei Monaten, die erste Omicron-Variante BA.1 mit 5243 positiven Tests zu den meisten Infektionen geführt hat. Dies ist neben der erhöhten Übertragbarkeit der Omicron-Varianten vor allem auch der Winterzeit (Ende Dezember 2021 bis Ende Februrar 2022) zu schulden. An zweiter Stelle steht die Omicron-Variante BA.2, die in 14 Wochen für knapp unter 5000 Infektionen verantwortlich war.
Schlussendlich konnten in Liechtenstein bisher 1262 Reinfektionen detektiert werden, was einem Anteil von 6.6 % an allen positiven Tests entspricht. Eine Variantenbestimmung mittels Sequenzierung konnte bei 6.2 % der Reinfektionen durchgeführt werden. In 51 % der Fälle war hier die zweite Omicron-Variante BA.2 verantwortlich. Eine altersgruppenspezifische Analyse der Reinfektionen zeigt, dass Personen zwischen 12 und 44 Jahren 1.6 mal häufiger als erwartet doppelt infiziert wurden. Demgegenüber wurden Senioren mit 65+ Jahren 4 mal, und Senioren über 75 Jahren sogar 5 mal weniger als statistisch erwartet erneut infiziert. Dies kann unter anderem auf allgemeine Präventionsmassnahmen dieser Altersschicht sowie der priorisierten Impfung zurückgeführt werden.
Dominique Hilti, MSc ETH

FAMH-Kandidat Medizinische Mikrobiologie Labormedizinisches Zentrum Dr. Risch, Doktorand an der Privaten Universität im Fürstentum Liechtenstein (UFL)
1 Centers for Disease Control and Prevention. (2022, Jan 24). What is Genomic Surveillance? Abgerufen am 05.09.2022 von https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/genomic-surveillance.html
2 Yamasoba D. et al. Neutralisation sensitivity of SARS-CoV-2 omicron subvariants to therapeutic monoclonal antibodies. Lancet Infect Dis. 2022 Jul; 22(7):942-943.
3 Buchan SA. et al. Estimated Effectiveness of COVID-19 Vaccines Against Omicron or Delta Symptomatic Infection and Severe Outcomes. JAMA Netw Open. 2022;5(9):e2232760.
4 Andrews N. et al. Covid-19 Vaccine Effectiveness against the Omicron (B.1.1.529) Variant. N Engl J Med. 2022 Apr 21;386(16):1532-1546.
5 Rambaut A. et al. A Dynamic Nomenclature Proposal for SARS-CoV-2 Lineages to Assist Genomic Epidemiology. Nature Microbiology. 2020;5: 1403–7.
45 PRIVATE UNIVERSITÄT IM FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN
Aktuelle Forschungsergebnisse der UFL
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache in Liechtenstein und weltweit. Oft tritt ein Herzinfarkt oder Schlaganfall aus anscheinend völliger Gesundheit auf. Die Gefässerkrankung Atherosklerose, die für den Infarkt bzw. Schlaganfall verantwortlich ist, tritt aber keineswegs plötzlich auf. Sie entwickelt sich über viele Jahre und Jahrzehnte, wobei die Betroffenen sehr lange nichts davon spüren.
Ein Herzinfarkt tritt auf, wenn ein Herzkranzgefäss, also eine Schlagader, die Blut und damit Sauerstoff und Nährstoffe zum Herzmuskel transportiert, sich plötzlich verschliesst. Der Prozess, der dafür verantwortlich ist, beginnt lange davor. Zunächst dringen cholesterinhaltige Partikel aus dem Blut in die Gefässwand ein. Dies provoziert eine Entzündungsreaktion; Entzündungszellen sterben ab und bilden gemeinsam mit dem Cholesterin Ablagerungen, sogenannte atherosklerotische Plaques. Wenn eine solche Ablagerung in das Gefäss hinein aufbricht, kommt es zur Verklumpung des Bluts an dieser Stelle, was das Gefäss plötzlich verschliessen und damit einen Herzinfarkt oder Schlaganfall auslösen kann, siehe Abbildung unten. Diese Ereignisse sind damit Äusserung einer Krankheit, welche bereits viel früher begonnen hat – Studien zeigen, dass sehr viele 40-Jährige schon atherosklerotische Veränderungen in ihren Gefässen haben. Dies ist einerseits heimtückisch; andererseits eröffnet es die Möglichkeit, durch rechtzeitige Intervention kardiovaskuläre Er-
eignisse zu verhindern. Dies ist die Aufgabe der präventiven Kardiologie.
In Kooperation mit dem Vorarlberg Institute for Vascular Investigation and Treatment (VIVIT) liegt ein Forschungsschwerpunkt der Privaten Universität im Fürstentum Liechtenstein (UFL) in der präventiven Kardiologie. Die UFL bietet ein Doktoratsstudium in Medizinischer Wissenschaft an, in dem die Studierenden lernen, erfolgreich eigenständige Forschungsprojekte durchzuführen. Es sollen hier einige neue Erkenntnisse zur Vorbeugung von Herz-KreislaufErkrankungen kurz vorgestellt werden, die im Rahmen von Promotionsarbeiten an der UFL gewonnen wurden.
Die Atherosklerose, die Herzinfarkte und Schlaganfälle verursacht, entsteht durch Ablagerungen von Cholesterin transportierenden Partikeln aus dem Blut in die Gefässwand. Die wichtigsten dieser schädlichen Partikel sind die low-density-lipoprotein (LDL)-Partikel. Das in ihnen transportierte LDL-Cholesterin hat deshalb eine zentrale Bedeutung in der Entstehung der Erkrankung. Es wird üblicherweise im Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen bestimmt. Mit der blossen Bestimmung dieses Parameters ist es aber nicht getan. Derselbe LDL-Cholesterin-Spiegel kann ein unterschiedliches Risiko bedeuten, je nachdem wie die das LDL-Cholesterin transportierenden Partikel beschaffen sind. Je kleiner sie sind, desto leichter dringen sie in die Gefässwand ein und desto schädlicher sind sie.




PRÄVENTION VON HERZ-KREISLAUF-ERKRANKUNGEN:
46 PRIVATE UNIVERSITÄT IM FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN
Herz-Kreislauf-Erkrankungen entwickeln sich über viele Jahre ohne Symptome, bis es zu einem kardiovaskulären Ereignis wie Herzinfarkt oder Schlaganfall kommt. Dieser heimtückische Verlauf eröffnet aber auch Möglichkeiten einer rechtzeitigen Intervention.
Die Entstehung von Atherosklerose von links nach rechts: Gesundes Gefäss, beginnende Ablagerungen in der Gefässwand, ausgeprägte atherosklerotische Plaque, Gefässverschluss nach Ruptur einer Plaque
Die direkte Bestimmung der Grösse der LDL-Partikel ist technisch aufwendig. Eine Arbeit der UFL 1 zeigt nun, dass ein aus einfachen Laborparametern kalkulierter Quotient, die LDL-Cholesterin /Apolipoprotein B-Ratio hier eine Hilfe bieten kann: In jedem LDL-Partikel ist ein Apolipoprotein B-Molekül enthalten. Eine hohe LDL-Cholesterin /Apolipoprotein B-Ratio bedeutet, dass viel LDL-Cholesterin pro Partikel transportiert wird, dass der Partikel also gross ist. In einer grossen Studie mit 1687 Patienten, bei denen bereits eine Herz-Kreislauf-Erkrankung (eine Verengung der Herzgefässe oder eine Verengung der Beingefässe) vorlag, konnten wir zeigen, dass die LDL-Cholesterin / Apolipoprotein B Ratio über einen Zeitraum von zehn Jahren ein sehr starker Risikofaktor für schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist. Neben der Senkung des LDL-Cholesterin-Spiegels ist es deshalb auch wichtig, auf Faktoren zu achten, welche zu kleinen LDL-Cholesterin-Partikeln führen. Wichtige solche Faktoren sind Übergewicht, Bewegungsmangel, und Diabetes.
Menschen mit Diabetes haben ein 2- bis 3-fach höheres Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse als nicht an Diabetes Erkrankte. Dies gilt besonders für Patienten mit Typ2-Diabetes, der mit Abstand häufigsten Diabetesform. Im Zentrum der Entstehung dieser Erkrankung steht eine Unempfindlichkeit von Leber- und Muskelzellen gegen das körpereigene glukosesenkende Hormon Insulin, die durch Alter, Veranlagung, aber auch wesentlich durch Übergewicht und Bewegungsmangel verursacht wird. Diese Insulin-Unempfindlichkeit führt dazu, dass die Bauchspeicheldrüse immer mehr Insulin produzieren muss, um eine ausreichende Wirkung zu erzielen. Wenn sie den Mehrbedarf nicht mehr decken kann, steigen die Blutzuckerwerte und ein Diabetes entsteht. Durch die Insulin-Unempfindlichkeit wird auch der Fettstoffwechsel negativ beeinflusst, was sich in der Bildung von kleinen LDL-Partikeln äussert, die ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bedingen.
Niedrige LDL-Cholesterin-Werte bei Typ-2-Diabetes dürfen deshalb keineswegs beruhigen. Sie widerspiegeln kleine, schädliche LDL-Partikel. Die meisten Menschen mit Diabetes sollten deshalb – auch dann, wenn die LDL-Cholesterin-Werte niedrig scheinen – ein Medikament zur Senkung des LDL-Cholesterins erhalten.
Eine weitere Arbeit 2 zeigte in einer Kohorte von über 300 Patienten mit Verengungen der Beinarterien, dass bei Patienten mit Diabetes ein grösserer Teil die international empfohlenen Zielwerte für das LDL-Cholesterin erreicht als bei Menschen ohne Diabetes. Was wie eine gute Nachricht klingt, zeigt in Wahrheit die sehr grosse Lücke zwischen empfohlenen Zielwerten und Erreichtem: Auch bei Patienten mit Diabetes erreichte nur etwa jeder Fünfte ein für Patienten mit bereits manifester Atherosklerose empfohlenes LDL-Cholesterin von unter 1,4 mmol/l – bei jenen ohne Diabetes nur jeder Zehnte. Dies ist sehr bedauerlich, da eine Senkung des LDL-Cholesterins das kardiovaskuläre Risiko senken kann und heute sehr wirkungsvolle Medikamente zur Reduktion des LDL-Cholesterins zur Verfügung stehen.
Wegen ihres erhöhten Risikos für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist eine konsequente kardiovaskuläre Vorsorge für Menschen mit Diabetes von grösster Bedeutung. Besonders wichtig ist dabei, dass die Betroffenen überhaupt von ihrer Erkrankung wissen. Dies ist leider häufig nicht der Fall. Diabetes bleibt sehr lange ohne Symptome und kann dabei grosse Schäden anrichten, wenn die Erkrankung nicht rechtzeitig in einer Laboruntersuchung erkannt wird. Männer und Frauen unterscheiden sich in manchen Aspekten in ihrem Gesundheitsverhalten. Eine Arbeit der UFL 3 konnte zeigen, dass dies auch für das Wissen um eine bestehende Diabeteserkrankung gilt. In einer Hochrisiko-Kohorte von 998
Patienten mit nachgewiesener Herzkranzgefäss-Erkrankung fanden wir, dass der Anteil von Diabetes-Patienten, die von ihrer Erkrankung wussten, bei Frauen deutlich höher war als bei Männern. Die Häufigkeit von Diabetes insgesamt war in der untersuchten Gruppe von Menschen mit Herzerkrankung sehr hoch, sie lag bei etwa 30 %. Dies unterstreicht die Bedeutung von Diabetes als Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Besonders hoch ist das Risiko für zukünftige HerzKreislauf-Ereignisse, wenn bereits eine Herz-Kreislauf-Erkrankung besteht. Dabei spielt die Art der bestehenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen eine grosse Rolle. In einem Forschungsprojekt 4 verglichen wir die Auswirkungen von Diabetes auf das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei 923 Patienten mit koronarer Herzerkrankung und 292 Patienten mit Verschlusskrankheit der Beinarterien. Das Risiko war bereits bei Herzpatienten mit Diabetes sehr hoch: Über einen Zeitraum von zehn Jahren erlitten 35 % von ihnen ein kardiovaskuläres Ereignis. Noch höher war das Risiko bei Patienten mit Diabetes und Verschlusskrankheit der Beinarterien, von denen 47 % ein kardiovaskuläres Ereignis erlitten. Es müssen alle Register gezogen werden, um die Prognose dieser Patienten zu verbessern: Optimale Senkung der LDLCholesterin-Werte, Einstellung der Blutdruckwerte bei Bluthochdruck und Einstellung der Glukose bei Diabetes. Sehr wichtig sind neben medikamentösen Massnahmen auch Lebensstilmassnahmen. So ist das Rauchen ein Hauptrisikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, und der Verzicht auf Nikotinkonsum ist in der kardiovaskulären Prävention ganz entscheidend. Wichtig ist auch eine gesunde Ernährung und körperliche Bewegung. Dazu passend ist Muskelkraft ein sehr starker Prädiktor für das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen: In einer Studie mit 691 Patienten mit etablierter Herzerkrankung untersuchten wir den Zusammenhang zwischen der Kraft des Händedrucks und dem Risiko für zukünftige kardiovaskuläre Ereignisse 5. Wir bestimmten die Stärke des Händedrucks mit einem HandDynamometer; dann erfassten wir das Auftreten von kardiovaskulären Ereignissen über einen Zeitraum von zehn Jahren. Herz-Kreislauf-Ereignisse ebenso wie Todesfälle traten unabhängig von Alter und Geschlecht umso seltener auf, je kräftiger der Händedruck zu Studienbeginn war.
Prof. Dr. med. Christoph Säly, Professor für Präventive Kardiologie; Studiengangsleiter Doktoratsstudium Medizinische Wissenschaft an der Privaten Universität im Fürstentum Liechtenstein (UFL)

Copyright Portrait-Bild: Wild + Team, Salzburg
1 Drexel H, Larcher B, Mader A, Vonbank A, Heinzle CF, Moser B, et al. The LDL-C/ApoB ratio predicts major cardiovascular events in patients with established atherosclerotic cardiovascular disease. Atherosclerosis. 2021;329:44-9.
2 Saely CH, Sternbauer S, Vonbank A, Heinzle C, Zanolin-Purin D, Larcher B, et al. Type 2 diabetes mellitus is a strong predictor of LDL cholesterol target achievement in patients with peripheral artery disease. J Diabetes Complications. 2020;34(11):107692.
3 Saely CH, Mader A, Heinzle CF, Zanolin-Purin D, Larcher B, Vonbank A, et al. Diabetes Awareness Among Coronary Artery Disease Patients Is Higher in Women Than in Men. Diabetes Care. 2019;42(6):e87-e8.
4 Sprenger L, Mader A, Larcher B, Mächler M, Vonbank A, Zanolin-Purin D, et al. Type 2 diabetes and the risk of cardiovascular events in peripheral artery disease versus coronary artery disease. BMJ Open Diabetes Res Care. 2021;9(2).
5 Larcher B, Zanolin-Purin D, Vonbank A, Heinzle CF, Mader A, Sternbauer S, et al. Usefulness of Handgrip Strength to Predict Mortality in Patients With Coronary Artery Disease. Am J Cardiol. 2020;129:5-9.
47 PRIVATE UNIVERSITÄT IM FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN
NEUE DATENTECHNOLOGIEN WIE BLOCKCHAINS VERÄNDERN DIE FINANZWELT RASANT
Die Entwicklungen und Innovationen in der Finanzwirtschaft und Ökonomie legen seit einigen Jahren ein rasantes Tempo vor. Oft stellen sich vielversprechende Ideen als schwer umsetzbar heraus, während vermutete Rohrkrepierer zum grossen Geschäftsmodell werden. Entscheidender Faktor ist dabei meist die Umsetzung und Speicherung der Datenströme.
LIECHTENSTEIN ALS VORREITER IN INNOVATIVER FINANZWIRTSCHAFT
Bereits in der Finanzplatzstrategie 2019 hat sich der Finanzplatz Liechtenstein zum Ziel gesetzt, nicht nur offen für neue Ansätze und technologische Veränderungen am Finanzplatz zu sein, sondern vielmehr proaktiv die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, sich als Vorreiter im Bereich Innovative Finanzwirtschaft zu etablieren. Als Grundstein wurde das «Token und vertrauenswürdige Technologien Dienstleister Gesetz» (TVTG), kurz oft als «Blockchain Act» bezeichnet, geschaffen. Entgegen dem inoffiziellen Kurznamen kommt das Wort «Blockchain» darin jedoch kein einziges Mal vor. Im Gesetz hat man vorrausschauend darauf verzichtet, eine bestimmte Technologie der Datenspeicherung und -verarbeitung zu regulieren und bietet im Gegenzug sehr allgemein anwendbare Regeln, die viel Raum für kreative Entwicklung lassen. Die unterliegenden Grundideen sind dabei jedoch stets dieselben: Effizienzgewinne, höhere Transparenz und Unabhängigkeit von zentralen Institutionen. Erreicht wird dies im Moment hauptsächliche durch die Anwendung von sogenannten Distributed Ledger Technologien (DLTs), welche Daten transparent (für alle sichtbar) speichern können, effizienter sind, da sie weniger intermediäre Dienstleister erfordern (Vertrauen durch Code) und als Netzwerk unabhängig von einer zentralen Einheit bestehen und arbeiten können.
Die Bemühungen haben gefruchtet. Liechtenstein ist mittlerweile im deutschsprachigen Raum als Kompetenzzentrum für Distributed Ledgers, Blockchain und FinTechs aller Art bekannt. Basis des grossen Erfolgs ist das enge Zusammenspiel von Politik, Regulatoren, einigen Banken, FinTechs
sowie Rechtsanwalts- und Steuerkanzleien. Ein wichtiger Katalysator ist dabei die Universität Liechtenstein als unabhängige, zukunftsorientierte Bildungsinstitution und Forschungseinheit. Hochschulen sind generell mehr denn je ein wichtiger Bestandteil dieser Entwicklungen. An ihnen ist es möglich, unabhängige neutrale Forschung zu betreiben, neue Fachkräfte auszubilden und Praxisprojekte mit Partnern aus der Wirtschaft umzusetzen. Die Universität Liechtenstein hat mit Unterstützung von Bank Frick ein «Innovative Finance Lab» eingerichtet, in dem alle Aufgabenfelder, meist mit starkem Liechtensteinbezug, bearbeitet werden.
HYPE ODER ECHTE INNOVATION?
Beobachter des Finanzsektors konnten in den letzten Jahren viele Neuerungen beobachten, die auf der Neuordnung von Datenströmen und -speicherung, z. B. in Form einer Blockchain, basieren. Es liegt dabei in der Natur der Sache, dass nicht alles von Anfang an gut funktioniert und Ansätze scheitern. Ein prominentes Beispiel dafür ist der ICO Boom der Jahre 2018 und 2019. Mittlerweile ist es medial ruhig um diesen Sektor geworden, manch einer hat ihn schon als kurzzeitigen Hype abgeschrieben. Das ist wenig verwunderlich, gab es doch durchaus grosse Probleme in der Umsetzung. Damit sind nicht nur betrügerische Aktivitäten gemeint, sondern auch Probleme in der Durchführung, in der Weiterverwendung von Tokens oder auch in der regulatorisch korrekten Umsetzung. Eine entscheidende Einsicht ist jedoch, dass die Datentechnologien für sich gut funktionierten, aber deren Anwendung und Regulierung noch nicht ausgereift waren. Wer nun also glaubt, dass ICOs bzw. STOs verschwinden werden, der irrt vermutlich. Universitäten analysieren und
48 UNIVERSITÄT LIECHTENSTEIN
erforschen zurzeit intensiv, welche Faktoren relevant sind für die individuelle Umsetzung solcher Projekte, aber auch für die Tokenökonomie als Ganzes. Ein Beispielprojekt an der Universität Liechtenstein ist die Analyse der Struktur von Hunderten ICOs und STOs direkt auf Basis der Daten der Ethereum Blockchain. Ziel ist es, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen, um das grosse Potenzial neuer Technologie voll ausschöpfen zu können.
NEUE ANWENDUNGSFELDER
Viele der in den vergangenen Jahren erkannten Hürden bei der Umsetzung der neuen Technologien können relativ einfach umschifft werden, indem wieder auf zentrale Datenund Prozesslösungen zurückgegriffen wird, was aber der Intention der Unabhängigkeit von diesen Systemen diametral widerspricht. Als Folge hat sich in den vergangen drei Jahren, als neues erstarkendes Feld, eine Reinform von Applikationen entwickelt, welche komplett unabhängig von zentralen Systemen und Institutionen sind und unter dem Namen «Decentralized Finance» zusammengefasst werden. Die Applikationen decken so gut wie alle Finanzprodukte und Services ab, die es im traditionellen Finanzsystem bereits gibt, wie beispielsweise Anleihen, Aktien, Börsen, etc.. Zu Beginn 2022 waren bereits fast 250 Mrd. US-Dollar in dezentralen Kontrakten verankert, nach der Kryptokrise im Mai 2022 hat sich dieser Wert allerdings halbiert und wächst aktuell nur langsam wieder an.
Innovative Finance entwickelt aber auch stets neue Anwendungsfelder für neue Anwendergruppen. Aktuelle Entwicklungen zeigen beispielsweise das grosse Potenzial neuer Finanztechnologien für NGOs zur Umsetzung von
Entwicklungs- und humanitärer Hilfe sowie zur Umsetzung von Sustainable Development Goals (SDGs). Die innovativen Ansätze können dabei sowohl zur Mittelakquise als auch zur Mittelverwendung eingesetzt werden. Die Finanzierung von Projekten kann beispielsweise mit Social Impact Bonds oder Spenden in Form von Kryptowährungen durchgeführt werden. Zur Mittelverwendung könnten Microloans, transparente Prozesse auf Blockchains oder ähnliches eingesetzt werden. Dies ist für NGOs auch insofern sehr spannend, da sie damit auch in andere Rollen schlüpfen können als die des klassischen Spendengeldempfängers. NGOs könnten beispielsweise auch als Investoren auftreten oder als Gutachter für Impact Messungen. Mehr Infos finden sich unter www.uni.li/innovative-finance
PD Dr. Martin Angerer, Habilitierter Assistenzprofessor am Lehrstuhl für Finance. Er befasst sich dort mit den Themen Innovative Finance und Verhaltensökonomik.

Juli20 Dez20 April21 April20 Jan20 Okt20 Jan21 April22 Juli22 Okt22 Jan22
Juli21
Lending
Liquid
Yield In dezentralen Protokollen verankerte Vermögenswerte $ 100 b $ 200 b $ 0 49 UNIVERSITÄT LIECHTENSTEIN
Quelle www.theblock.co
Dez21 Okt21
Dexes
CDP
Staking
DES RÄTIKONS
Manchmal sichtbar, manchmal unsichtbar. Unsere Bergwelt verändert sich mindestens so dynamisch wie der Talraum.
Wenn wir die Alpen als lebenswerte Landschaft für zukünftige Generationen erhalten wollen, müssen wir die dahinterliegenden, überregionalen Prozesse berücksichtigen.
Die Karte stellt eine Illustration verschiedener Interviews und Gespräche dar, welche im Rahmen des Forschungsprojektes durchgeführt wurden. Sie ist, inklusive illustrierter Zitate, als Druck erhältlich.
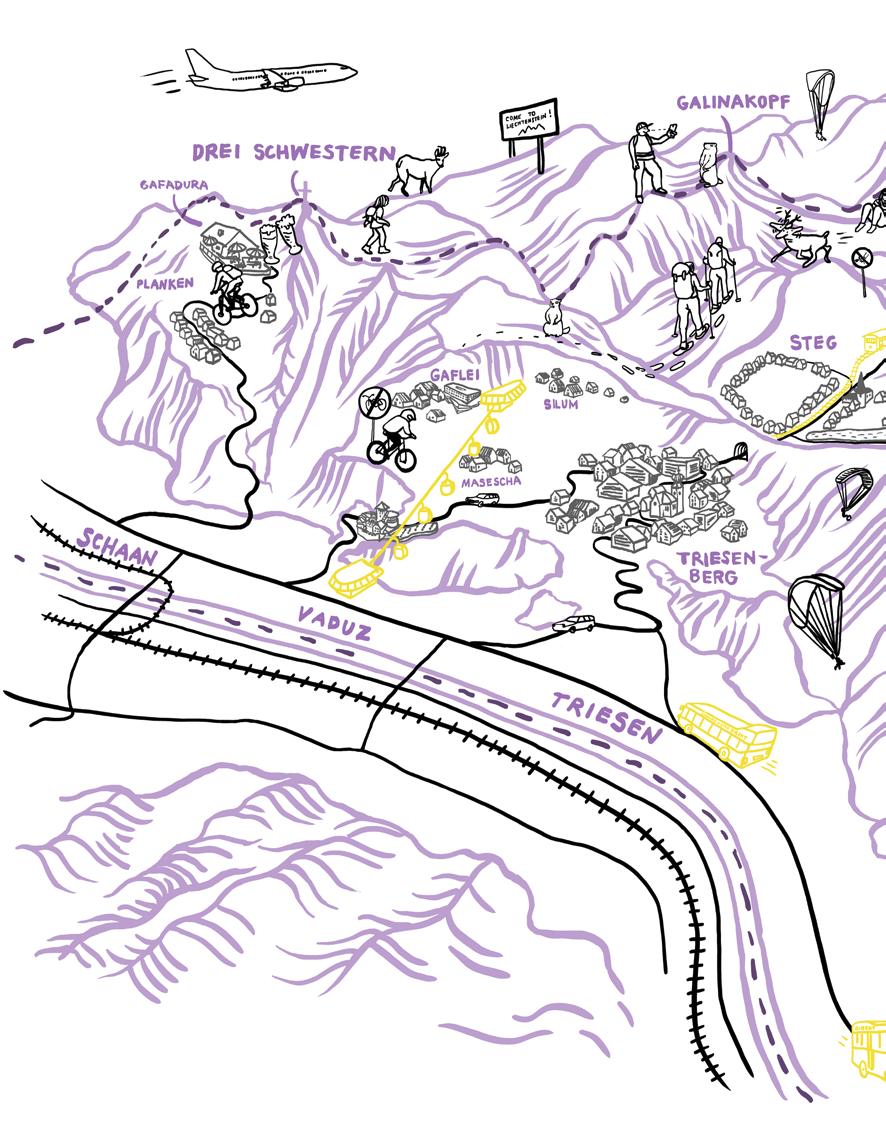
DIE URBANISIERUNG
50 UNIVERSITÄT LIECHTENSTEIN
EINBLICKE IN EINE THEORETISCHE DEBATTE …
Im Alltagsgebrauch denken wir bei Begriffen wie Urbanisierung oder Urbanität vor allem an Grossstädte und Metropolen wie New York oder, in unserer Nähe, Zürich. Zusehends finden diese Begriffe aber auch Einzug in den Sprachgebrauch im gesamten Alpenrheintal, etwa wenn es um neue Zentrumsüberbauungen wie in Schaan oder die Bahnhof City in Feldkirch geht. Gerade in unseren Gefilden macht sich eine
gewisse Unsicherheit breit, was denn aus unseren Dörfern geworden ist. Ist das schon «städtisch» oder noch «ländlich»? Wie «urban» sind denn Vaduz, Bludenz oder Steg? Steg und urban? Anschliessend an aktuelle Diskussionen in der Wissenschaft untersuchten wir im Rahmen des Forschungsprojekts «Alpine Gebrauchslandschaft Rätikon» genau solche scheinbar genuin ländlichen Orte mit der Brille der Urbanisierung. Nach der Konzeption des französischen Philo-

51 UNIVERSITÄT LIECHTENSTEIN
sophen Henri Lefebvre ist die Welt seit Beginn der Industrialisierung auf dem Weg zur kompletten Urbanisierung. In den letzten zehn Jahren haben, aufbauend auf den Schriften von Lefebvre, insbesondere Christian Schmid von der ETH Zürich und Neil Brenner von der University of Chicago das Konzept «planetary urbanization» auf den Weg gebracht (Brenner & Schmid, 2015).
Die zentrale These hinter diesem Konzept ist, dass sich die Urbanisierung bereits jetzt in die hintersten Ecken unseres Planeten ausgebreitet hat. Dabei steht die ständige Wechselwirkung von Konzentration/Implosion und Ausbreitung/Explosion im Vordergrund. Unter Konzentration/ Implosion versteht man dabei die immer grösser werdenden Ansammlungen von Menschen, Gütern, Dienstleistungen, Gebäuden und Infrastrukturen in urbanen Agglomerationen. Ausbreitung/Explosion bedeutet demgegenüber, dass immer neue, bis anhin auch ländliche und periphere Gebiete für die Urbanisierung nutzbar gemacht werden. Diese beiden Prozesse lassen sich aber nicht trennscharf auseinanderdividieren, sondern kommen üblicherweise in unterschiedlichen Verhältnissen vor. Ein aktuelles Beispiel dazu: Mit elektrischen Motoren betriebene Verkehrsmittel wie E-Bikes oder E-Autos erfreuen sich in den immer grösser werdenden Stadtregionen steigender Beliebtheit und verändern die Alltagsmobilität sowie auch die potenziell erreichbaren Orte massiv. Damit diese Geräte aber schlussendlich bei uns landen, ist es andernorts notwendig, komplexe Infrastrukturen zum Abbau und Transport von beispielsweise Lithium oder seltenen Erden aufzubauen. Etwa in der Peripherie von Bolivien oder der Mongolei. Dabei ändert sich an diesen Orten aber nicht nur ihre physische Struktur, wenn aus ehemaligen Weiden Abbaugebiete werden und Lagerhallen und Strassen errichtet werden. Auch der Alltag der ehemals agrarisch geprägten Bevölkerung ändert sich. Aus Bäuerinnen und Bauern werden plötzlich Industriearbeiterinnen und -arbeiter. Auch Binnenmigrationsströme verändern sich komplett. Aus Abwanderungsregionen werden plötzlich Einwanderungsregionen. Neue Häuser werden gebaut, neue Dienstleister siedeln sich an, es entstehen also kleine Agglomerationen.
Immer dichter wird das sogenannte «urbane Gewebe» (Lefebvre: Tissue Urbaine), das die Dörfer mit den Grossstädten und schliesslich auch mit der ganzen Welt verbindet. Historische Elemente wie etwa Bauernhäuser oder kleine Dörfer verschwinden dabei oft nicht einfach, sie werden vielmehr in dieses urbane Gewebe hineingewoben, ihre Funktionen und Nutzungen werden verändert und somit verändert sich auch ihr Verhältnis zum Gewebe (Madden, 2015, S. 514–515). Menschen, Dienstleistungen und Produkte fliessen dabei durch dieses Gewebe, dessen Gestalt und Ausprägung zwar lokal beeinflusst werden kann (z.B. durch Politikbereiche wie Verkehr, Raumentwicklung, Naturschutz etc.), aber gleichzeitig von Prozessen abhängt, die nicht lokal gesteuert werden können (Miller & Mössner, 2020, S. 2243). Ein Ferienhaus, eine Lagerhalle, ein Supermarkt auf der grünen Wiese oder eine Autobahn sind dabei alle Bestandteil dieses urbanen Gewebes (Lefebvre, 2015, S. 38).
… UND IHRE EMPIRISCHE BEDEUTUNG
URBANISIERUNG IM RÄTIKON
Was hat das nun mit dem Rätikon zu tun? Abgesehen davon, dass auch bei uns zusehends mehr Menschen mit elektrisch betriebenen Verkehrsmitteln unterwegs sind, wird bei einem Blick zurück in die Geschichte sichtbar, dass sich vergleichbare Prozesse bei uns schon seit rund 150 Jahren vollziehen. Damals haben sich in den ehemaligen Bauerndörfern plötzlich erste Industriebetriebe angesiedelt. Zur Gewinnung von Wasserkraft wurden Kraftwerke und Stauseen wie etwa jener im Steg oder der Lünersee im Brandnertal gebaut, Eisenbahnlinien und Strassen wurden in der alpinen Landschaft errichtet, damit die hier produzierten Güter leicht nach Zürich oder Wien transportiert werden konnten. Arbeitersiedlungen entstanden, um einer wachsenden Bevölkerung ein Dach über dem Kopf zu gewähren. Nach dem zweiten Weltkrieg nahm die Urbanisierung dann richtig Fahrt auf: ein dichtes Netz aus Einfamilienhäusern entstand, innerhalb einer Generation arbeiteten die Menschen nicht mehr auf dem Bauernhof, sondern in grossen Industriebetrieben oder bei Finanzdienstleistern. Die Kanalisation wurde gebaut, Häuser daran angeschlossen, Brunnen, die man früher zum Waschen genutzt hat, wurden plötzlich redundant und verschwanden.
Diese lange Geschichte der Urbanisierung in unserer Region, also die Veränderung der gebauten Umwelt und der Lebensweisen der Menschen hat uns dazu veranlasst, den Rätikon genauer unter die Lupe zu nehmen. Christian Schmid (2018, S. 592) folgend, haben wir den Rätikon daher als Beispiel genommen, um von einem peripheren Standpunkt aus auf Prozesse der Urbanisierung zu schauen und zu fragen, wie sich die Urbanisierung in unserer Region denn verhält. Das ist insofern von Relevanz, als dass die Alpen in Bezug auf die Urbanisierung gesamthaft kaum im Blick der Forschung stehen. Gleichzeitig handelt es sich um eine der dynamischsten Regionen Europas, die sehr stark von ihrer Integration in das urbane Gewebe profitiert hat. Wenn im Steg also eine Heuhütte in ein Ferienhaus umgebaut wird, in Malbun ein neues Hotel eröffnet oder Schaan ein neues Ortszentrum bekommt, dann sind das alles kleinere oder grössere Hebel, mittels derer die agrarische Vergangenheit überformt und unsere Region in das urbane Gewebe hineingewoben wird.
DREI SPEZIFISCHE PROZESSE IM RÄTIKON
Unsere Forschungen brachten uns im Rahmen von sieben Wanderungen an verschiedenste Orte auf der liechtensteinischen und österreichischen Seite des Rätikon und wir sammelten dabei eine Vielzahl von qualitativen und quantitativen Daten, die wir in mehreren Workshops zusammenführten. Wir führten Interviews mit den dort wohnenden und arbeitenden Menschen, machten Skizzen, Fotografien und werteten historische Dokumente und statistische Daten aus, um schliesslich auf drei Prozesse der Urbanisierung im Rätikon aufmerksam zu werden.
Die Panorama-Urbanisierung ist ein Prozess, der auf der wirtschaftlichen Ausbeutung der alpinen Landschaft durch die Mobilisierung der Massen beruht, wie es in etwa in Malbun oder Brand zu beobachten ist. Die Entwicklung

–
52 UNIVERSITÄT LIECHTENSTEIN
dieser Orte nährt sich einerseits vom umgebenden Alpenpanorama als Ressource, untergräbt deren Qualität andererseits aber durch die ständige Erweiterung der Infrastrukturen wie Skilifte, Bike Trails und Wanderwege oder Aktivitäten wie Alpengolf und Skirennen. Wird das Panorama dabei überfrachtet und die sensible Balance zwischen dem Wachstum der Siedlungen und Infrastrukturen und der Erhaltung des Panoramas als Raison d’être überstrapaziert, so entwertet sich das Gesamtgefüge.
Die Krypto-Urbanisierung verwandelt landwirtschaftliche Strukturen stillschweigend in freizeitorientierte Siedlungen. Sie entfaltet ihr Potenzial allerdings nur dann, wenn ihre Auswirkungen weitgehend unsichtbar bleiben. Dieser Prozess ist beispielsweise im Steg oder Nenzinger Himmel zu beobachten. Während das Aussehen der Hütten und Wiesen formal erhalten bleibt, ändern sich der Inhalt und die Nutzung grundlegend. Frühere Kuhställe sind heute Ferienhäuser mit Saunen und schnellem Internet. Der radikale Planungsansatz der Erhaltung der Grossform mit einer liberalen Haltung gegenüber Veränderungen im Detail und in der Nutzung bildet eine dynamische und malerische Grauzone zwischen Stagnation und Wandel.
Der dritte Prozess spielt sich in den breiten Tälern wie dem Alpenrheintal und dem Walgau ab, und wird durch deren infrastrukturelle Verknüpfung mit Agglomerationen ausserhalb der Alpen ermöglicht. Ihre Entwicklung ist, aus einer gewissen zeitlichen und räumlichen Flughöhe betrachtet, ein kontinuierlicher, homogener und fast teleologischer Prozess: Die unterschiedlichen Siedlungen auf dem Talboden dehnen sich über die Jahrhunderte langsam aus, bis sie an den Rand der Berghänge stossen. Die Aggradations-Urbanisierung integriert das alpine Territorium kontinuierlich in das globale urbane Gewebe und schafft erst die Voraussetzung für die Entstehung von Panorama- und Krypto-Urbanisierung in vormals abgelegenen Tälern.
BEDEUTUNG FÜR UNS ALS REGION

Der Blick der planetaren Urbanisierung soll ein grenzüberschreitendes Denken anregen, das aufzeigt, wie Entwicklungen an einem Ort die Entwicklung von anderen Orten beeinflussen können. In einer solchen Denkweise stellt sich die Frage, wie lokale und nationale Politik- und Verwaltungsbereiche eingreifen können, um eine nachhaltige Raumentwicklung – nicht nur an einem Ort – sicherstellen zu können. Die Beschreibung der drei Prozesse mag überspitzt klingen, dient aber dazu, die Mechanismen der Entwicklung, ihre Triebkräfte, innere Struktur und äussere Erscheinung dis-
kutierbar zu machen. Mehr noch lassen sich daraus normative Fragen und Möglichkeiten zur Zukunft unserer alpinen Landschaft ableiten. Wann wird die Ressource Panorama übernutzt und untergräbt die Attraktivität eines Standortes für Touristen, aber auch für die lokale Bevölkerung? Wie lange kann ein Gebiet funktional verändert werden, bis es dann doch seinen Charakter verliert? Und muss die alpine Landschaft nicht als integraler Bestandteil der Talraumentwicklung gedacht und geplant werden, gerade als Pendant oder Gegenstück zu einer hyperdynamischen Entwicklung? Die Ergebnisse des Forschungsprojektes sind in der Schriftenreihe «Landschaft vom Gebrauch her denken» unter dem Titel «Die Urbanisierung des Rätikons» erschienen, und diese kann über die Universität Liechtenstein bezogen oder auf deren Homepage eingesehen werden.

Dr. Anne Brandl, Ehem. Professorin für Architektur am Institut für Architektur und Raumentwicklung

Johannes Herburger, Wissenschaftlicher Mitarbeiter / Doktorand am Institut für Architektur und Raumentwicklung

Luis Hilti, Wissenschaftlicher Mitarbeiter /Doktorand am Institut für Architektur und Raumentwicklung

Quellen
–
Brenner, N., & Schmid, C. (2015). Towards a new epistemology of the urban? City, 19(2-3), 151–182. https://doi.or g/10.1080/13604813.2015.1014712
– Lefebvre, H. (2015). From the City to Urban Society. In N. Brenner (Ed.), Implosions/Explosions: Towards a Study of Planetary Urbanization (pp. 36–51). Jovis Berlin.
– Madden, D. J. (2015). City Becoming World: Nancy, Lefebvre and the Global- Urban Imagination. In N. Brenner (Ed.), Implosions /Explosions: Towards a Study of Planetary Urbanization (pp. 36–51). Jovis Berlin.
– Miller, B., & Mössner, S. (2020). Urban sustainability and counter-sustainability: Spatial contradictions and conflicts in policy and governance in the Freiburg and Calgary metropolitan regions. Urban Studies, 57(11), 2241–2262. https://doi.org/10.1177/0042098020919280
– Schmid, C. (2018). Journeys through planetary urbanization: Decentering perspectives on the urban. Environment and Planning D: Society and Space, 36(3), 591–610. https://doi. org/10.1177/0263775818765476
53 UNIVERSITÄT LIECHTENSTEIN

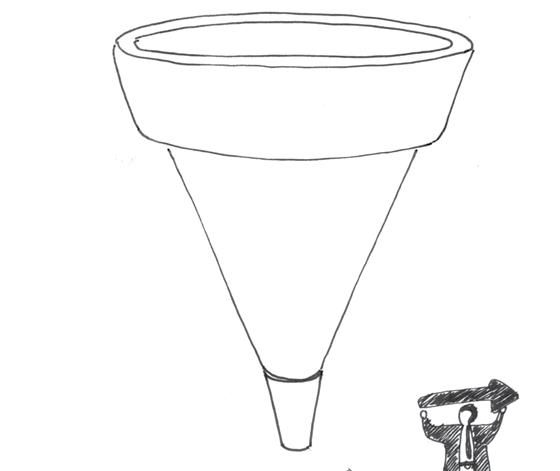
54 UNIVERSITÄT LIECHTENSTEIN
[ ]
Evaluation Forschungsartikel Praxis
& # + ! () * Daten
DATEN UND IHRE BEDEUTUNG FÜR DIE PERSONALENTWICKLUNG
Wissenschaftliche Erkenntnisse durchdringen jeden Bereich unseres Lebens, von den Mikrochips in unseren Smartphones bis hin zu den grossen Rätseln des Universums. Für die alltägliche Arbeit an einer Universität spielen Daten eine essenzielle Rolle, nicht nur für die Grundlagenforschung, sondern auch, um wirkungsvolle Trainingsprogramme für Angestellte und Führungskräfte in der Praxis zu gestalten –wie und warum möchten wir hier aufzeigen.
DATEN UND WIE SIE GEWONNEN WERDEN
Fast alle kennen Querschnittstudien: die übliche Form dieser Studienart ist die Umfrage. Hierfür wird eine geeignete Stichprobe ausgewählt und befragt, beispielsweise Menschen in einer bestimmten Altersgruppe oder in einem bestimmten Beschäftigungsfeld. Querschnittstudien sind vergleichsweise schnell und einfach durchführbar und liefern verlässliche Erkenntnisse darüber, wie oft bestimmte Eigenschaften in der Bevölkerung vertreten sind. Sie erlauben jedoch keine Aussagen über deren Ursachen oder Auswirkungen. Um hierüber belastbare Aussagen treffen zu können, braucht es Experimentalstudien. Dabei werden die Teilnehmenden in eine Experimental- und eine Kontrollgruppe aufgeteilt. Die Kontrollgruppe wird lediglich beobachtet, während man in der Experimentalgruppe eine sogenannte Intervention vornimmt, indem man beispielsweise ein Medikament verabreicht oder ein Training durchführt. Die Datenerhebung findet für beide Gruppen gleichzeitig statt, und zwar bevor und nachdem die Intervention in der Experimentalgruppe durchgeführt wurde. Da beide Gruppen zur selben Grundgesamtheit gehören, kann man davon ausgehen, dass unterschiedliche Entwicklungen zwischen den Gruppen auf die Intervention zurückzuführen sind.
DATEN FÜR DAS ARBEITSLEBEN
Experimentalstudien kommen auch häufig bei der Evaluierung der Wirksamkeit von Personalentwicklungsprogrammen zum Einsatz. Die einfachste und am häufigsten eingesetzte Datenquelle, die Selbstbewertung, gibt einen Einblick in die Person selbst und ihre Einschätzung der Wirksamkeit des Trainings. So erhobene Daten sind jedoch stark subjektiv: Personen, die sich einen Trainingseffekt erhoffen, werden sich danach üblicherweise besser bewerten als zuvor, auch wenn sich eigentlich nichts geändert hat. Zudem besagt der sogenannte Hawthorne-Effekt, dass allein das Durchführen einer Studie dazu führen kann, dass eine gefühlte Verbesserung in allen möglichen Bereichen eintritt. Um dem entgegenzuwirken, hat sich die Methode des 360-Grad-As-
sessment etabliert. Hierbei werden nicht nur Daten von den Teilnehmenden des Trainings selbst erhoben, sondern auch in ihrem Umfeld – Vorgesetzte, gleichgestellte und unterstellte Kolleg:innen – wodurch sich ein holistischer Eindruck der tatsächlichen Veränderungen gewinnen lässt. Häufig reicht aber auch das nicht aus, denn auch solche Einschätzungen sind stets subjektiv. Digitalisierung und technologische Innovationen ermöglichen hier objektive (computergestützte) Analyseverfahren. Diese bieten sich zwar nicht bei allen Arten von Interventionen an, aber vor allem, wenn es darum geht, das Verhalten der Teilnehmenden zu beeinflussen (z.B. ihre Kommunikation oder die Fähigkeit zur konkreten Zielformulierung), zeigen sie ihre Stärke. So kann beispielsweise Eye-Tracking Veränderungen im Blickverhalten erfassen, computergestützte Textanalyse kann geschriebene oder gesprochene Worte kategorisieren und Prosodieanalysen erlauben durch Auswertung von Silbenlänge und Tonhöhe einen Einblick in die individuelle Art zu sprechen.
DATENGESTÜTZTE PERSONALENTWICKLUNG IN DER PRAXIS
Ganzheitliche Führung durch Self-Leadership Im Rahmen einer Studie an Führungskräften wird erforscht, wie sich die Führungsleistung und die Stressbewältigungskompetenz infolge eines 6-wöchigen Online-Trainings in Self-Leadership, Leadership- und Mindfulness-Trainings verändern. Bei den Teilnehmenden handelt es sich um Führungskräfte auf der mittleren Ebene, also Modul-, Gruppen- und Segmentleitende sowie deren Stellvertretungen und Teamleitende, die sich durch ein hohes Mass an Verantwortung für ihre Mitarbeitenden sowie das Unternehmen auszeichnen und dadurch einer hohen Arbeitsbelastung ausgesetzt sind. Durch die zufällige Einteilung in Experimental- und Kontrollgruppe können hier besonders verlässliche Aussagen über die Auswirkungen des Trainings getroffen werden. Zusätzlich zur Befragung der Teilnehmenden werden zu jeder Führungskraft je mindestens drei Mitarbeitende befragt, was eine sogenannte Mehrebenenanalyse zulässt. Dieser Prozess findet
55 UNIVERSITÄT LIECHTENSTEIN
einmal vor und einmal nach der Studie statt. Dabei soll herausgefunden werden, ob die Mitarbeitenden ihre jeweilige Führungskraft nach dem Ende der Studie verändert wahrnehmen und ob Veränderungen im Verhalten der Führungskraft zu einer Stärkung der Mitarbeitenden führen.
Visionäre Führung durch Charisma Einen anderen Ansatz zur Steigerung der Führungsleistung verfolgen Trainings zur Steigerung des individuellen Charismas. Aktuelle Forschungsergebnisse konnten zeigen, dass Charisma gar nicht so schwer greifbar und definierbar ist, wie man lange Zeit dachte. Tatsächlich basiert es grösstenteils auf verbalen und nonverbalen Kommunikationstechniken, wie der Nutzung von Metaphern, Kontrasten, emotionaler Sprache, ausgeprägter Gestik, Mimik und Sprachmelodie. Direkt auf diesen und weiteren Befunden aufbauend, wurde deshalb an der Universität Liechtenstein ein datengestütztes Training in charismatischer Kommunikation entwickelt, welches derzeit evaluiert wird. Um eine direkte Übertragung des Trainings in die Praxis sicherzustellen, wird bei diesem Kurs vor allem auf die direkte Einübung der Kommunikationstechniken in verschiedenen Kontexten zurückgegriffen. Neben 360-GradAssessments kommen hier auch Videoaufnahmen für die Evaluierung zum Einsatz, welche händisch Wort-für-Wort und in Folge auch maschinell mittels computergestützter Textanalyse ausgewertet werden. Somit lassen sich Änderungen im Kommunikationsverhalten exakt und objektiv quantifizieren und die Wirksamkeit des Trainings optimieren.
Mehr Resilienz durch Mindfulness Der Arbeitsplatz stellt derzeit den meistgenannten persönlichen Stressor dar; die Verringerung beruflicher Überlastung und die Sicherstellung der psychischen Gesundheit bei Mitarbeitenden ist zu einem der dringlichsten Themen der heutigen Zeit avanciert (World Bank, 2019). Befinden sich jedoch zwei Personen in einer vergleichbar anspruchsvollen Situation, so können manche darin eine Herausforderung sehen und sich persönlich weiterentwickeln, während sich bei anderen lediglich Überforderung und Erschöpfung einstellen. Im Rahmen einer Studie mit Angestellten im Bereich Soziale Arbeit wird untersucht, welche persönlichen Eigenschaften (wie Selbstbewusstsein oder Achtsamkeit) diese verschiedenen Wahrnehmungen verursachen und ob die Teilnehmenden mithilfe von Mindfulness-Trainings ihre Resilienz steigern können. Die Teilnehmenden durchlaufen ein 8-wöchiges Training, in dem sie verschiedene Aufmerksamkeits- und Achtsamkeitsübungen erlernen und mithilfe einer App regelmässig üben. Neben der Datenerhebung per Fragebogen kommt bei dieser Studie zusätzlich ein computergestützter Reaktionszeittest zum Einsatz, bei dem gemessen wird, wie schnell und genau die Teilnehmenden emotionale Mimik erkennen und darauf richtig reagieren.
DATEN ALS VORTEIL FÜR DIE GESAMTE REGION
Warum lohnt es sich nun, derart aufwendige Studien durchzuführen? Für die Entwicklung eines neuen Medikaments ist die sorgfältige Evaluation der Wirksamkeit schnell einleuchtend; geht es aber um «weichere» Auswirkungen wie etwa die Effektivität von Führungsverhalten, vertrauen viele auf persönliche Erfahrung und andere wenig wissenschaftliche Datenquellen. Den Sustainable Development Goals der UNO zufolge ist qualitativ hochwertige Bildung jedoch ein Grundpfeiler einer nachhaltigen gesellschaftlichen Weiterentwicklung. Um diesem Ziel gerecht zu werden, reicht es auch nicht aus, Daten aus wissenschaftlichen Studien heranzuziehen, um Trainings zu gestalten. Wir benötigen auch Daten, um deren Wirksamkeit zu überprüfen, sie stetig weiterentwickeln und so die höchsten Qualitätsstandards sicherstellen zu können. Nur dann können wir substanziell
zum aktuellen Forschungsstand beitragen und den Teilnehmenden unserer Trainings die grösstmöglichen Erfolge in Aussicht stellen.
Die Resultate werden sowohl für Führungskräfte als auch für Unternehmen der Region von grossem Interesse sein, denn Führungskräfte und Mitarbeitende, die über ein hohes Mass an Self-Leadership-Kompetenz, Charisma und Achtsamkeit verfügen, können erwiesenermassen effektiver mit Stress umgehen, flexibler und proaktiver an ihre Aufgaben herangehen und sicherer in einem dynamischen Umfeld agieren. Sie werden ihre Teams objektiv betrachtet geschickter wie auch in der eigenen subjektiven Wahrnehmung effektiver führen. Charismatische Führungskräfte haben sich vor allem in Krisenzeiten als essenziell erwiesen, Unternehmen möglichst wohlbehalten aus unsicheren Gewässern hinauszusegeln. Diese besondere Fähigkeit, die den Unterschied zwischen Unternehmenserfolg und -misserfolg ausmachen kann, beruht vor allem auf der Kompetenz von Führungskräften, effizient zu kommunizieren, ihren eigenen Enthusiasmus auf ihre Mitarbeitenden zu übertragen und eine gegenseitige Identifikation zu erleichtern.
Der Erfolg dieser Trainings sowie deren Wert für die Praxis kann nur dann sichergestellt werden, wenn Daten in all ihrer Breite und Tiefe und aus unterschiedlichsten Quellen bei ihrer Erstellung einbezogen und für ihre laufende Evaluierung und Weiterentwicklung eingesetzt werden. Trainings in Self-Leadership, Achtsamkeit und charismatischer Kommunikation können einen wertvollen Beitrag dazu leisten, gute Führungskräfte zu herausragenden zu machen. Unternehmen, die ihren Angestellten eine gezielte Kompetenzentwicklung ermöglichen, können Burnout-Risiken vermeiden sowie die individuelle Stresstoleranz und Führungsleistung steigern. So wird die nachhaltige Innovationsfähigkeit des Unternehmens gewährleistet, was sich schliesslich positiv auf das Unternehmen und die Gesellschaft auswirkt.
Simon Liegl, Wissenschaftlicher Mitarbeiter / Doktorand am Lehrstuhl für Entrepreneurship und Leadership
Sebastian Moder, Wissenschaftlicher Mitarbeiter / Doktorand am Lehrstuhl für Entrepreneurship und Leadership


Julia Tenschert, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Entrepreneurship und Leadership

Referenzen
– Antonakis, J., Bastardoz, N., Jacquart, P., & Shamir, B. (2016). Charisma: An ill-defined and ill-measured gift. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 3, 293-319.
– Antonakis, J., Fenley, M., & Liechti, S. (2011). Can charisma be taught? Tests of two interventions. Academy of Management Learning & Education, 10(3), 374-396.
– Avolio, B. J., Reichard, R. J., Hannah, S. T., Walumbwa, F. O., & Chan, A. (2009). A meta-analytic review of leadership impact research: Experimental and quasi-experimental studies. The Leadership Quarterly, 20(5), 764-784.
– World Bank. (2019). World development report 2019: The changing nature of work.
56 UNIVERSITÄT LIECHTENSTEIN
DER
WhatsApp der Verbrecher
Wenn im Staat A Beweismittel erhoben («gesammelt»)
werden, die anschliessend im Staat B im Rahmen eines dort neu eingeleiteten Strafverfahrens verwendet werden, stellt sich die Frage, ob der Beweistransfer auf zulässige Weise (also: rechtshilfe-konform) erfolgte, sonst könnte ein Beweisverbot vorliegen. Gerade darum geht es bei dem aktuellen EncroChat-Fall!
EINFÜHRUNG 1
Kommunikation als Austausch und Übertragung von Informationen ist für zwischenmenschliche Beziehungen eine Bedingung sine qua non. Darauf weist schon die Etymologie des Wortes hin. Das Wort Kommunikation kommt aus dem Lateinischen («communi – care») und bedeutet «teilen, mitteilen, teilnehmen lassen, gemeinsam machen, vereinigen». Dank der technologischen Entwicklung ist es dem Menschen gelungen, neue Wege zu finden, um schnell und möglichst günstig mit Personen auf der ganzen Welt zu kommunizieren. So kennt inzwischen jeder den Instant-Messaging-Dienst WhatsApp.
Kommunikation ist genauso wichtig für Kriminelle. Ein entscheidender Unterschied liegt allerdings darin, dass Kriminelle für die Abwicklung illegaler Geschäfte möglichst sichergehen wollen, dass die durchgeführte Kommunikation in der digitalen Dunkelheit verborgen bleibt, mithin keineswegs mitverfolgt wird – vor allem nicht durch Ermittlungsbehörden. Gerade diesen Wunsch nach sicherer, schneller, verborgener und zugleich grenzüberschreitender Kommunikation liess EncroChat – das «WhatsApp der Kriminellen» – in Erfüllung gehen. Genau genommen handelte es sich dabei um einen Dienstleistungsanbieter von Ende-zu-Ende verschlüsselten Instant-Messengern und Endgeräten. Solche Kryptohandys, worauf die EncroChat-Software zum verschlüsselten Austausch von Nachrichten installiert war, konnte man mit Nutzerlizenz für bis zu sechs Monate über eBay gegen einen Betrag von über 1000 Euro erwerben. Niemand erschien nach aussen als Verantwortlicher des Unternehmens EncroChat und es gab auch keinen offiziellen Firmensitz eines Unternehmens namens EncroChat. Auf der (inzwischen deaktivierten) offiziellen Internetseite von EncroChat stand das folgende, verlockende Angebot:
«EncroChat protects conversations with the following four tenets
Perfect Forward Secrecy Each message session with each contact is encrypted with a different set of keys. If any given key is ever compromised, it will never result in the compromise of previously transmitted messages – or even passive observation of future messages.
Repudiable Authentication Messages do not employ digital signatures that provide third party proofs. However, you are still assured you are messaging with whom you think you are.
Deniability Anyone can forge messages after a conversation is complete to make them look like they came from you. However, during a conversation the recipient is assured all messages received are authentic and unmodified. This assures non-reputability of messages.
Encryption Strength The algorithms employed are many times stronger than that of PGP (RSA+AES). We employ algorithms from different families of mathematics, which protects message content in the event that one encryption algorithm is ever solved.»
Weil die französischen Behörden dem EncroChat-Server in Frankreich auf die Spur gekommen sind und daher alle Beweise durch französische Ermittler gesammelt wurden, stellt sich die Frage, ob ein Beweisverwertungsverbot nach der deutschen Strafprozessordnung (StPO) für in Deutschland abgeurteilte Straftaten von EncroChat-Nutzern besteht, wenn die Durchführung der Ermittlungen und insbesondere die Beweiserhebung in Frankreich den Voraussetzungen in Deutschland nicht entsprechen. Dies ist eine hochaktuelle Frage des internationalen Beweistransfers, die für alle Länder relevant werden kann.
ENCROCHAT-FALL – das
57 UNIVERSITÄT LIECHTENSTEIN
Der vorliegende Text bezieht sich nun konkret auf deutsche Rechtsprechung, weil es (noch) keine anderen deutschsprachigen Gerichtsurteile gibt. Am 2.3.2022 hat sogar der deutsche Bundesgerichtshof (BGH) ein wegweisendes und grundlegendes Urteil gesprochen, das die Nutzung der EncroChat-Daten erlaubt. Im Folgenden wird anlässlich dieser höchstgerichtlichen Entscheidung die Chronologie des EncroChat-Falles geschildert, um dadurch die grosse Bedeutung des (sogenannten «kleinen») Rechtshilferechts zum Ausdruck zu bringen.

FRANKREICH: ORT DER BEWEISERHEBUNG
Der französischen Gendarmerie ist es 2017 und 2018 im Rahmen von mehreren Ermittlungsverfahren gelungen, verschlüsselten Telefonen mit «EncroChat-Lizenz» auf die Spur zu kommen, die sodann sichergestellt wurden, um schliesslich im Frühling 2020 das Netzwerk per se zu infiltrieren. Die Chronologie, so wie sie bisher gerichtlich festgestellt wurde, sieht im Einzelnen wie folgt aus:
Die Auswertung eines der 2017 sichergestellten Kryptohandys hatte eine Datenverbindung zu einem in Roubaix
(Frankreich) betriebenen Server offenbart, der durch die Gesellschaft Virtue Imports angemietet worden war, deren Sitz wiederum in Vancouver (Kanada) lag. Es erging daraufhin ein richterlicher Beschluss, auf dessen Grundlage am 21.12.2018 die Daten des Servers zwecks Auswertung kopiert werden konnten. Die Auswertung wies auf illegale Aktivitäten insbesondere aus dem Bereich des Drogenhandels hin. Infolgedessen erteilte das Gericht in Lille am 30.1.2020 die Genehmigung zur Installation einer Trojanersoftware auf dem Server sowie auf allen damit verbundenen Endgeräten und am 20.3.2020 zur Umleitung aller Datenströme des Servers in Roubaix.
Die Auswertung der abgefangenen Informationen führte am 7.4.2020 zur Erweiterung der Ermittlungen in Bezug auf weitere Straftaten (Transport, Besitz, Erwerb, Anbieten oder Abgabe von Betäubungsmitteln und Besitz und Erwerb von Waffen ohne Genehmigung). Die Erkenntnisse rechtfertigten eine Verlängerung der Massnahmen per erneutem richterlichen Beschluss. Sämtliche Massnahmen wurden in Frankreich am 28.6.2020 aufgehoben, als der Geschäftsbetrieb des Unternehmens EncroChat bekannt gegeben wurde.
DEUTSCHLAND: ORT DER BEWEISVERWERTUNG
Zielpersonen der durch französische Behörden durchgeführten Überwachung hielten sich allerdings auch auf deutschem Hoheitsgebiet auf. Nach den geltenden supranationalen Regularien (insbesondere nach Art. 31 Abs. 1 lit. b RLEEA [Richtlinie 2014/41/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3.4.2014 über die Europäische Ermittlungsanordnung in Strafsachen]) war deshalb Frankreich («überwachender Mitgliedsstaat») verpflichtet, Deutschland («unterrichteter Mitgliedsstaat») von der Überwachung zu unterrichten. Diese Unterrichtung blieb zunächst aus. Jedoch wurden Daten des EncroChat-Netzwerkes dem deutschen Bundeskriminalamt zwecks Aufbereitung in der Zeit zwischen dem 3.4.2020 und dem 28.6.2020 übermittelt. Auf dieser Grundlage leitete die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main einzelne Ermittlungsverfahren ein.
Am 2.6.2020 erliess die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main eine Europäische Ermittlungsanordnung (im Folgenden: EEA) zur Erlangung von Beweismitteln, die sich bereits im Besitz der zuständigen französischen Behörden befanden. Zugleich ersuchte sie die französischen Justizbehörden, die unbeschränkte Verwendung der EncroChat-Daten in Strafverfahren gegen die Täter zu genehmigen, welche am 13.6.2020 erteilt wurde. Die französischen Behörden stimmten auch der Verwendung der EncroChatDaten «im Rahmen eines jeden Ermittlungsverfahrens im Hinblick auf jedwedes Gerichts-, Strafverfolgungs- oder Untersuchungsverfahren» zu.
ZUR VERWERTBARKEIT DER IN FRANKREICH GEWONNENEN BEWEISMITTEL IN DEUTSCHLAND
Die formellen Anforderungen eines ausgehenden Ersuchens sind in § 91j DE-IRG geregelt. In materieller Hinsicht soll der Erlass einer EEA nach Art. 6 Abs. 1 lit a RL-EEA für die Zwecke des ihr zugrunde liegenden Strafverfahrens unter Berücksichtigung der Rechte der betroffenen Person notwendig und verhältnismässig sein. Eine Verpflichtung zur Prüfung im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. b RL-EEA besteht nach der Entscheidung des BGH nicht.
Selbst wenn es jedoch auf die Beweiserhebung nach deutschem Recht ankäme, wäre diese per se in rechtmässiger Weise möglich gewesen. Der Zugriff auf die Endgeräte der betroffenen EncroChat-Nutzer und auf die darauf gespeicherten Daten, welche die Beteiligung an Betäubungsmittelstraftaten nach § 29a Nr. 2 DE-BtMG belegten, wäre insbesondere sowohl nach § 100a Abs. 2 Nr. 7 lit. b DE-StPO (Telekommunikationsüberwachung) als auch nach § 100b Abs. 2 Nr. 5 lit. b DE-StPO (Online-Durchsuchung) gerechtfertigt gewesen, wobei für den Tatverdacht bereits die Besonderheiten des EncroChat-Systems gesprochen hätten.
Problematisch könnte sein, dass die Beweiserhebung in Frankreich nicht nach allen massgeblichen Rechtsvorschriften stattgefunden hat. Im Ergebnis wurde die Verwertbarkeit der gewonnenen Beweismittel von mehreren obergerichtlichen Urteilen sowie zuletzt vom BGH bejaht. Zu Recht wird betont, dass deutsche Gerichte nicht befugt seien zu prüfen, ob die französischen Behörden bei der Beweiserhebung auf französischem Hoheitsgebiet gegen französisches Straf prozessrecht verstossen hätten. Verstösse gegen den ordre public seien insoweit jedenfalls nicht ersichtlich.
Für den Zugriff auf Endgeräte der in Deutschland befindlichen EncroChat-Nutzer sind dagegen Art. 30, 31 RLEEA einschlägig. Wie geschildert, haben die französischen Behörden ihre Unterrichtungspflicht nach Art. 31 Abs. 1 RLEEA spätestens dann vernachlässigt, als sie vom Aufenthalt der Zielpersonen in Deutschland erfuhren. Aus diesem
Grund konnten auch die deutschen Behörden ihre aus Art. 6 Abs. 1 lit. b RL-EEA resultierende Pflicht nicht erfüllen. Die Verletzung der Unterrichtungspflicht per se genügt allerdings nicht für ein Beweisverwertungsverbot. Darüber hinaus seien auch keine anderen Gründe ersichtlich, die für ein Beweisverwertungsverbot sprechen, so der BGH weiterhin. In der gebotenen Kürze sei auf folgende Überlegungen des BGH hingewiesen: Ein Beweisverwertungsverbot ergebe sich erstens nicht aus rechtshilfespezifischen Gründen wie der Verletzung völkerrechtlicher Grundsätze, des ordre public oder rechtshilferechtlicher Bestimmungen. Insbesondere gebe es kein allgemein gültiges Prinzip und sonst auch keine höherrangige Regelung dahingehend, dass ein Verstoss bei der Beweiserhebung kausal zu einem Beweisverwertungsverbot führe. Zweitens ergebe sich ein Verwertungsverbot nicht unmittelbar aus der Verfassung, obwohl eine strikte Verhältnismässigkeitsprüfung geboten sei. Denn es gehe im vorliegenden Fall um Verbrechen, die auch im Einzelfall schwer wiegen, die Erforschung des Sachverhalts wäre ohne diese Beweismittel nicht möglich gewesen und die Daten betreffen keine Erkenntnisse aus dem Kernbereich der privaten Lebensgestaltung. Drittens folge ein Verwertungsverbot mangels entgegenstehender Normen auch nicht aus sonstigem Prozessrecht.
AUSBLICK
Inzwischen gibt es mehrere EncroChat-Urteile in verschiedenen Ländern, unter anderem in Frankreich. Der französische Kassationsgerichtshof hat vor wenigen Wochen sogar entschieden, die Daten könnten rechtswidrig erlangt worden sein. Eine abschliessende Beurteilung bedarf jedoch nun der näheren Klärung, wie genau die Behörden an die Daten gelangt sind. Angesichts der vielen kritischen Stimmen im Schrifttum und vor allem vonseiten der Strafverteidiger, die meinen, es sei von einem Verwertungsverbot für die erlangten EncroChat-Daten auszugehen, Strafverfolgung um jeden Preis sei dem Rechtsstaat fremd und der Zweck heilige die Mittel gerade nicht, kann man durchaus gespannt auf Urteile vom EuGH oder EGMR sein.
Prof. Dr. Konstantina Papathanasiou, Inhaberin des Lehrstuhls für Wirtschaftsstrafrecht, Compliance und Digitalisierung, Stv. Institutsleiterin des Instituts für Wirtschaftsrecht
1 Für den vorliegenden Text vgl. bereits Papathanasiou, ZJS 2022, 259.

59 UNIVERSITÄT LIECHTENSTEIN
In der heutigen Welt nutzen institutionelle Investoren eine Vielzahl öffentlich verfügbarer Datenquellen zur Optimierung ihrer Investitionsentscheidungen. Dabei hat in den vergangenen Jahren die Bedeutung von sogenannten «alternativen Daten» stark zugenommen.









LEARNING FROM ALTERNATIVE DATA
KonsumTransaktionen Nachhaltigkeit Satellitenbilder Daten Internet der Dinge App-Nutzung Geolocation Soziale Medien 60 UNIVERSITÄT LIECHTENSTEIN
Alternative Daten sind unkonventionelle bzw. nicht marktbezogene Daten, die in der Regel extern erhoben werden, also nicht aus dem unternehmenseigenen oder üblicherweise verwendeten Datenpool stammen. Für ihre wachsende Bedeutung sprechen zweierlei Gründe: Zum einen werden immer mehr Daten gesammelt, elektronisch aufbereitet und in digitalisierter Form, oft in Echtzeit, zur Verfügung gestellt. Zum anderen spielen, gerade bei der Aufbereitung der Daten, Methoden aus der Welt der künstlichen Intelligenz sowie des maschinellen Lernens – wie zum Beispiel das «Natural Language Processing» oder «Machine Learning-based Image Processing» – eine immer stärkere Rolle.
Haben Computer noch vor wenigen Jahren eingescannte Dokumente lesbar gemacht und interpretiert (z.B. Schlagworte und Stimmung eines Geschäftsberichtes oder Zeitungsartikels), so analysieren sie heutzutage z.B. in Echtzeit Reden von CEOs auf Hauptversammlungen hinsichtlich ihrer Botschaft und ihrer Stimmung, um darauf basierend Aktien zu kaufen oder abzustossen. Eine weitere Form alternativer Daten, die stark an Bedeutung gewonnen hat, sind Daten zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Unternehmen.
WIESO LOHNT SICH DIE ANALYSE VON ALTERNATIVEN DATEN?
Neben den üblichen Argumenten zur Bedeutung von Daten für Investitionsentscheidungen sind es Nachhaltigkeitsdaten, die besonders im Fokus stehen. Einerseits ist es für viele private und institutionelle Investoren wichtig, in ein nachhaltig agierendes Unternehmen zu investieren. Andererseits verspricht man sich von nachhaltig agierenden Unternehmen eine langfristig höhere Rendite, da diese besser gegen den Klimawandel, die gesellschaftlichen und demographischen Veränderungen sowie gegen politische Risiken geschützt sind. Nachhaltigkeitsbestrebungen haben dadurch einen Einfluss auf die erwartete Rendite, aber auch auf das Risiko. Investoren nutzen daher alternative Daten, um bestimmte Unternehmen in kritischen Industrien (z.B. Öl- und Gasunternehmen) bei der Investmentauswahl auszuschliessen («Negative Screening»), oder andere besonders nachhaltige Unternehmen in ihren Portfolios überzugewichten («Positive Tilt»).
WELCHE NACHHALTIGKEITSDATEN GIBT ES?
In den Vereinigten Staaten werden laut dem Forum for Sustainable Investing (US SIF) circa 17 Billionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen nach Nachhaltigkeitskriterien investiert. Trotz dieser enormen ökonomischen Relevanz sind die finanziellen Auswirkungen dieser nicht-finanziellen Unternehmensleistungen bis heute unklar. Ein Grund dafür ist sicherlich die enorme Schwierigkeit, die Nachhaltigkeit von Unternehmen in den drei üblichen Kategorien Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance) – kurz ESG – objektiv und genau zu bewerten. Trotz Milliardeninvestitionen verschiedener Unternehmen sind diese Bewertungen oft intransparent, basieren auf Analystenschätzungen und weichen signifikant voneinander ab (Berg et al., 2022). In der Zukunft soll manche Datengrundlage, wie zum Beispiel die von den Unternehmensaktivitäten verursachten CO2-Emmissionen, gemäss der Sustainable Finance Initiative der Europäischen Kommission sowie der EU-Taxonomie-Verordnung (Verordnung (EU) 2020/852) in Form einer umsatzbasierten Kennzahl offengelegt werden. Jedoch betrifft dies zunächst lediglich die Umweltdimension der Nachhaltigkeit. Eine Lösung zur akkuraten und effektiven Nachhaltigkeitsbewertung von Unternehmen ist daher erst einmal nicht in Sicht. Abhilfe können hier jedoch Methoden des maschinellen Lernens schaffen.
NACHHALTIGKEITSBEMESSUNG DURCH MASCHINELLES LERNEN
Eine Frage, die es hierbei zu beantworten gilt, ist jene nach der tatsächlichen Bedeutung einer «akkuraten Nachhaltigkeitsbewertung». Nimmt man hier wiederum die Investorenperspektive ein, so sollten echte Verbesserungen/Verschlechterungen in der Nachhaltigkeit vom Markt erkannt und honoriert oder sanktioniert werden. Beim jetzigen Stand der Forschung ist noch nicht klar, ob der Zusammenhang ein positiver (Verbesserungen in der Nachhaltigkeit führen zu positiven Renditen) oder ein negativer (Nachhaltigkeitsverbesserungen wirken sich negativ auf die Unternehmensbewertung aus) ist. Methoden des überwachten («supervised») maschinellen Lernens können Aufschluss geben. Diese sind in der Lage, aus grossen Mengen von Input-Daten nicht nur die tatsächlich relevanten herauszufiltern (Variablenselektion), sondern auch komplexe nicht-lineare Zusammenhänge zu erkennen. Die Anwendung dieser Methoden bestätigen die zuvor erwähnten Unterschiede zwischen den verschiedenen Datenanbietern (MSCI ESG Ratings haben einen vorausschauenden Charakter, siehe Serafeim & Yoon, 2022) sowie innerhalb der drei Kategorien E, S und G (G hat hier den grössten Einfluss, siehe auch Giese et al., 2021). Ebenso findet man den von Shanaev und Gimire (2021) dokumentierten nichtlinearen Zusammenhang zwischen ESG-Rating-Veränderungen und zugehörigen Aktienrenditen (negative Veränderungen in der Mitte des ESG-Spektrums haben die grösste Auswirkung auf den Aktienkurs). Nutzt man nun die Vorteile mancher Methoden des maschinellen Lernens in diesem Zusammenhang aus, so kann man sogenannte «Random Forests», «Boosted Trees» oder auch speziell konfigurierte neuronale Netze (bekannt als «Deep Learning») verwenden, um die Ergebnisse zuvor erwähnter Forschungsarbeiten zu bestätigen, aber auch, um Fondslösungen zusammenstellen, welche in optimaler Weise die Informationsfülle der alternativen (Nachhaltigkeits-)Daten für sich nutzen. Dies geschieht derzeit zum Beispiel im Rahmen einer Innosuisse-geförderten Kooperation der Universität Liechtenstein mit der Liechtensteinischen Landesbank AG im Projekt «An ESG-based Investment Case for Absolute Return Funds».
Dr. Sebastian Stöckl, Assistenzprofessor (mit Tenure-Track) am Lehrstuhl
für Finance
Dr. Othar Kordsachia, Assistenzprofessor am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, Bank- und Finanzmanagement

Quellen
–
Berg, F., Kölbel, J. F., & Rigobon, R. (2022). Aggregate Confusion: The Divergence of ESG Ratings. Review of Finance, rfac033. https://doi. org/10.1093/rof/rfac033
Giese, G., Nagy, Z., & Lee, L.-E. (2021). Deconstructing ESG Ratings

–
Performance: Risk and Return for E, S, and G by Time Horizon, Sector, and Weighting. The Journal of Portfolio Management, 47(3), 94–111. https://doi.org/10.3905/jpm.2020.1.198 –
Serafeim, G., & Yoon, A. (2022). Stock Price Reactions to ESG News: The Role of ESG Ratings and Disagreement. Review of Accounting Studies. https://doi.org/10.1007/s11142-022-09675-3 –
Shanaev, S., & Ghimire, B. (2021). When ESG Meets AAA: The Effect of ESG Rating Changes on Stock Returns. Finance Research Letters, 102302. https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102302
61 UNIVERSITÄT LIECHTENSTEIN
PROCESS SCIENCE – wie wir Digital Trace Data nutzen können, um Veränderungen zu verstehen und zu gestalten
Aufgrund des kontinuierlichen Wandels in Wirtschaft und Gesellschaft wird die Anpassungsfähigkeit zu einer Kernkompetenz der Menschen und Organisationen. Im Rahmen aktueller Forschung am Hilti Lehrstuhl für Business Process Management der Universität Liechtenstein wird – gemeinsam mit internationalen Partnern – das Studium von Veränderungen in den Mittelpunkt gerückt. Im Forschungsgebiet «Process Science» werden neue Wege beschritten, um mithilfe von Digital Trace Data früh Veränderungen zu sehen, sie zu verstehen und sie dann auch zu gestalten. Das Forscherteam entwickelt eine auf Veränderungen (nicht Stabilität) ausgerichtete Weltsicht und Managementlehre.
WAS IST PROCESS SCIENCE?
Process Science ist ein Wissenschaftsgebiet, das sich zum Ziel gesetzt hat, die vielfältigen Veränderungen unserer Welt besser zu verstehen und daraus Gestaltungsempfehlungen für Wirtschaft, Gesellschaft und Politik abzuleiten. Process Science rückt Prozesse in den Mittelpunkt, denn sie erlauben es, Veränderungen aus verschiedenen Blickrichtungen zu untersuchen. Process Science ist inter- und transdisziplinär, denn es baut auf Theorien und Methoden verschiedener Forschungsdisziplinen auf, um Veränderung ganzheitlich zu verstehen. Es kann auch als Beispiel post-disziplinärer Forschung angesehen werden, da das Phänomen – die Veränderung – im Mittelpunkt steht und verschiedene Disziplinen erst im Hinblick auf ihren Erkenntnis- und Gestaltungsbeitrag heranzieht. Process Science integriert ein weites Spektrum an Disziplinen, die unterschiedliche Perspektiven auf Veränderung bieten: Informatik, Organisationslehre, Psychologie, Ingenieurwissenschaften, Wirtschaftsinformatik. Process Science schafft eine Plattform, um Beiträge aus verschiedenen Disziplinen zusammenzuführen und bietet hierfür konzeptionelle und methodische Voraussetzungen. Der Begriff «Process» wird so definiert, dass er für viele Disziplinen kompatibel bleibt; eine «Folge von Veränderungen, die sich über Zeit entfalten und auf mehreren Bezugsebenen stattfinden können.» (vom Brocke et al. 2021, S. 3). Gemessen werden Veränderungen z.B. anhand von Ereignissen, die in gewissen Kontexten und zu spezifischen Zeiten erfasst werden und so in ihrer zeitlichen und logischen Beziehung zueinander analysiert werden können. «Digital Trace Data» – also digitale Daten, die bei Interaktionen mit digitalen Technologien hinterlassen werden – ist hier ein aktuell viel beachtetes Beispiel, das eine faszinierende Datengrundlage für Process Science bietet. Das ist nicht zuletzt dem Umstand geschuldet, dass immer mehr unserer berufli-
chen und privaten Aktivitäten mithilfe von digitalen Technologien durchgeführt werden und so eine reichhaltige Quelle für Digital Trace Data liefern; man denke beispielsweise an Sensordaten, Enterprise Software, Social Media oder Body Data, (Pentland et al. 2021).
MIT DIGITAL TRACE DATA WANDEL VERSTEHEN UND GESTALTEN
Die zunehmende Verfügbarkeit von Digital Trace Data bietet neuartige Möglichkeiten zur Untersuchung des organisationalen Wandels. Digital Trace Data umfassen Nachweise über Ereignisse oder Aktivitäten, die in einem Informationssystem digital aufgezeichnet und gespeichert werden. Wenn beispielsweise ein Mitarbeiter eine Transaktion in einem Enterprise System (z.B. SAP) ausführt, so wird eine digitale Spur dieses Ereignisses abgespeichert. Aber auch ausserhalb von Unternehmenssoftware kann Digital Trace Data gesammelt werden: Wenn wir etwa wissen möchten, wie viele Menschen durch eine Tür gehen, wie die Luftqualität, die Sonneneinstrahlung oder der Geräuschpegel ist, dann können wir dies über Sensoren erfassen (Otto et al. 2022). Auch Meinungen und Erfahrungen werden zunehmend auf sozialen Medien kommentiert und können mit Methoden des Text Minings –der automatisieren Textanalyse – effizient ausgewertet werden. So untersuchen Wissenschaftler am Hilti Lehrstuhl der Universität Liechtenstein z.B. seit Ausbruch der Pandemie im März 2020, wie Menschen die Arbeit und das Leben auf Web-Conferencing Systemen wie Zoom oder Teams erleben; durch ihre Analyse von über 10 Millionen Tweets konnten sie so herausfinden, was Menschen beim Web-Conferencing in spezifischen Handlungssituationen als nützlich und was auch als hinderlich empfinden (Hacker et al. 2020). Abbildung 1 zeigt beispielhaft, wie Digital Trace Data in einem Prozess aussehen können.
62 UNIVERSITÄT LIECHTENSTEIN
ID Zeitstempel
O-10464 2021-09-16 05:53:00
Aktivität
Enter Service Area
O-10464 2021-09-16 05:54:00 Choose Bundle
O-10464 2021-09-16 05:54:00
O-10464 2021-09-16 06:00:00
O-10464 2021-09-16 06:36:00
O-10489 2021-09-17 03:18:00
Enter Sub Service Area
Insert Bundle Information
Collect basic customer details
Enter Service Area
O-10489 2021-09-17 03:19:00 Choose Bundle
… … …
Digital Trace Data bieten unvoreingenommene Einblicke in Handlungen, die mit digitalen Technologien durchgeführt werden, sie treten typischerweise in grossen Mengen auf, enthalten detaillierte Informationen über Art und Kontext der Aktivität und können auf vielfältige Weise analysiert werden. Dies ist besonders relevant für prozessorientiere Forschung im Bereich von Process Science. Neben E-Mails, Transaktionen in Enterprise Systemen oder Social Media Posts werden vor allem mit Process Mining analysierbare Ereignisse (Event Logs) immer relevanter für prozessorientiere Forschung. Wie in Abbildung 1 ersichtlich, sind Digital Trace Data typischerweise mit zeitlichen Informationen ausgestattet, d.h. sie geben Aufschluss darüber, wann bestimmte Aktionen oder Ereignisse stattgefunden haben. Dadurch ermöglichen sie es, die Dynamik von organisatorischen Phänomenen und deren zeitlichen Verlauf darzustellen und erklärbar zu machen.
EIN BEISPIEL – PROCESS SCIENCE IM KUNDEN-ONBOARDING-PROZESS EINER LIECHTENSTEINISCHEN BANK
Process Science findet sowohl in der Wissenschaft als auch in der Praxis zunehmend Beachtung. Um Process Science zu illustrieren, berichten wir von einem Projekt einer liechtensteinischen Bank, in dem der Kunden-OnboardingProzess mit Process-Science-Methoden untersucht wurde. Aufgrund des starken Wachstums hat die Bank mehrere Reorganisationen im Umfeld des Onboardings durchgeführt, doch haben diese nicht immer spürbare Verbesserungen bewirkt. Teils berichteten Mitarbeitende auch von dem Ein-
druck, dass einige Prozesse sogar länger dauerten als zuvor. Andere Mitarbeiter:innen berichteten von Verbesserungen, sodass unklar war, welche Wirkung die Reorganisationen in verschiedenen Bereichen hatten. Gemeinsam mit der Bank wurde daher eine Process-Science-Studie durchgeführt, in der diese Zusammenhänge genauer untersucht wurden. Ziel war es, die Wirkung spezifischer Reorganisationsmassnahmen in verschiedenen Anwendungskontexten genauer zu verstehen und daraus Handlungsempfehlungen für die Zukunft abzuleiten.
Zu Beginn wurden aus den operativen Systemen der Bank die Digital Trace Data exportiert und aufbereitet, sodass verschiedene digitale Analysetechniken angewandt werden konnten. Untersucht wurde die zeitliche Abfolge von Ereignissen, die innerhalb einzelner Prozesse stattgefunden haben. So konnten Phasen definiert werden, in denen sich der Prozess verändert hat. Solche Phasen werden in der wissenschaftlichen Literatur als «Temporal Brackets» bezeichnet (vgl. Abb. 2) (Langley 1999). Sie bilden wichtige Analyseeinheiten für Process Science.
Die Studie hat zwei interessante Kontextveränderungen zutage gebracht, in denen der Prozess unterschiedlich verlaufen ist. Kenngrössen für den Vergleich waren z.B. die Dauer bestimmter Prozessschritte, die durchschnittliche Durchlaufzeit oder auch die Anzahl abgearbeiteter Anfragen pro Tag. Die Unterschiede konnten auf spezifische Entwicklungen und Entscheidungen im Umfeld des Prozesses zurückgeführt werden.
Die erste Kontextveränderung, die in ihrer Wirkung untersucht werden konnte, war eine Reorganisation der Kundenbetreuungsabteilung der Bank. Diese wurde im Zuge des schnellen Wachstums durchgeführt, um die Customer Experience und Effizienz zu erhöhen. Dabei wurde eine Abteilung geschaffen, welche sich mit der Betreuung der Kunden beschäftigt und der ehemalige Kundenbetreuer:innen und Assistent:innen angehörten. Die betrachtete Reorganisation wurde in zwei Schritten ausgeführt, weshalb in der Analyse drei Abschnitte (Brackets) betrachtet werden: (1) vor der Ankündigung der Reorganisation, (2) nach der Anpassung der Organisation und (3) nach Übernahme der neuen Organisationsstruktur im System, welche etwa sechs Wochen nach Ankündigung stattfand (siehe Abbildung 2).
ABBILDUNG 1: BEISPIEL VON DIGITAL TRACE DATA EINES PROZESSES
Prozess Temporal Bracket Phase 1 ø 146 h Temporal Bracket Phase 2 ø 388 h Dauer Prozessschritt: Beantwortung Kundenbetreuerfragen Temporal Bracket Phase 3 ø 124 h DIGITAL TRACE DATA ABBILDUNG 2: AUSWIRKUNGEN EINER REORGANISATION AUF DEN PROZESS 63 UNIVERSITÄT LIECHTENSTEIN
Vertieft betrachtet wurde dann ein spezifischer Prozessschritt: die Beantwortung von Fragen durch Kundenbetreuer:innen. Bei Vergleich der durchschnittlichen Bearbeitungszeit je Abschnitt ist festzustellen, dass im zweiten Abschnitt ein starker Anstieg der Prozessbearbeitung stattfand, von durchschnittlich 146 Stunden auf 338 Stunden. Erst nach Implementierung der neuen Struktur in den Systemen – abgebildet in Abschnitt drei – sank die benötigte Zeit wieder, und dann sogar unter den Startwert. Die Darstellung zeigt auf, dass nach Ankündigung der Reorganisation direkt ein starker Anstieg stattfand – also der gegenteilige Effekt, der mit der Reorganisation beabsichtigt wurde. Dieser hat sich erst langsam normalisiert und zwar insbesondere nach den technischen Anpassungen der Reorganisation in den operativen Systemen.
Die zweite Kontextveränderung war eine Mitarbeitermutation in einem Team der Front Abteilung. Konkret wurde hier für ein Team das zuvor längere Zeit ohne eine Teamleitung gewesen war, eine neue Teamleitung eingesetzt. Aus der Perspektive von Process Science wurde hier der erste Prozessschritt, der von Kundenbetreuer:innen bearbeitet wird – das Annehmen oder Ablehnen einer Anfrage – genauer betrachtet. Dabei wurden zwei Phasen definiert (siehe Abbildung 3).
Vergleichen wir lediglich die durchschnittliche Dauer der Aktivität in den zwei Abschnitten, so ist kaum eine Veränderung zu erkennen. Betrachten wir nun aber die Veränderung im Zeitverlauf genauer, so ist zu erkennen, dass um den Eintritt der neuen Teamleitung ein starker Anstieg der Dauer des betrachteten Prozessschrittes zur Bestätigung der Anfrage zu erkennen war. Nach einer Weile flachte dieser dann ab und pendelte sich auf einem niedrigeren Niveau ein.
Beide organisationalen Veränderungen hatten Auswirkungen auf den Prozess und wurden durch die Anwendung von Process Science sichtbar. Durch Analyse der temporalen Abschnitte konnte ein Vergleich der einzelnen Phasen durchgeführt werden. Diese Analyse lieferte wichtige Erkenntnisse in Bezug auf Veränderungen im Unternehmen. Eine wesentliche Erkenntnis sind die Verzögerungseffekte, mit denen Reorganisationen Wirkung zeigen. Diese Effekte konnten durch die Untersuchung in den Daten genau gezeigt und auch Ursachen konnten erkannt werden. Hierdurch ist es der Bank in Zukunft möglich, Verzögerungen zu reduzieren und auch die zunächst negativen Wirkungen von Reorganisationen auf die Prozessperformance zu vermeiden.
Prof. Dr. Jan vom Brocke, Lehrstuhlinhaber des Hilti Lehrstuhls für Business Process Management, Institutsleiter des Instituts für Wirtschaftsinformatik
Sandro Franzoi, Wissenschaftlicher Assistent / Doktorand am Hilti Lehrstuhl für Business Process Management


Thomas Grisold, PhD, Assistenzprofessor am Hilti Lehrstuhl für Business Process Management

Sophie Hartl, Doktorandin am Hilti Lehrstuhl für Business Process Management

Quellen
– Hacker, J., vom Brocke, J., Handali, J., Otto, M. & Schneider, J. (2020) Virtually in this together – how web-conferencing systems enabled a new virtual togetherness during the COVID-19 crisis, European Journal of Information Systems, 29:5, 563-584
– Langley, A. (1999). Strategies for theorizing from process data. Academy of Management re-view, 24(4), 691-710.
– Otto, M., Kipping, G., Gau, M., Grisold, T., & vom Brocke, J. (2022). Towards Space Mining: A Smart Space Management Solution to Minimize Indoor Spreading Risk of COVID-19. Paper presented at the 17th International Conference on Design Science Research in Information Systems and Technology, St. Petersburg, Florida, USA.
– Pentland, B., Vaast, E., & Wolf, J. R. (2021). Theorizing Process Dynamics with Directed Graphs: A Diachronic Analysis of Digital Trace Data. MIS Quarterly, 45(2), 967–984.
– vom Brocke, J., van der Aalst, W. M. P., Grisold, T., Kremser, W., Mendling, J., Pentland, B. T., Recker, J., Roeglinger, M., Rosemann, M., Weber, B. (2021). Process Science: The Interdisciplinary Study of Continuous Change. SSRN Electronic Library.
Prozess Temporal Bracket Phase 1 ø 80 h Temporal Bracket Phase 2 ø 83 h Dauer Prozessschritt: Anfrage bestätigen DIGITAL TRACE DATA ABBILDUNG 3: AUSWIRKUNGEN EINER MITARBEITERMUTATION AUF DEN PROZESS 64 UNIVERSITÄT LIECHTENSTEIN
WENN KÜNSTLICHE INTELLIGENZ KREATIV WIRD
Künstliche Intelligenz (KI) tritt in Bereiche ein, die bisher menschlichen Akteurinnen und Akteuren vorbehalten waren: Gestaltung, Kunst, Design. Doch was bedeutet das für die Zukunft von Arbeit?

Wenn ich mich recht erinnere, habe ich das letzte Mal ein Bild im Kunstunterricht auf dem Gymnasium gemalt. Das ist mehr als zwanzig Jahre her. Meine Bilder waren nie gut. Künstlerisch bin ich wohl eher untalentiert. Warum das etwas zur Sache tut? Das obige Bild ist eines der ersten, die ich mit DALL-E 2 1 erstellt habe. DALL-E 2 ist ein System künstlicher Intelligenz, das Bilder auf Basis textueller Inputs (sogenannter «Prompts») generiert. Mein Input für dieses Bild lautete: «an expressionist version of an algorithm» («eine expressionistische Version eines Algorithmus»). Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Ein Freund mit künstlerischem Hintergrund sagte mir, dass es etwas von Jean-Michel Basquiat habe. Das kann ich nicht beurteilen und natürlich macht mich die Eingabe eines Prompts nicht zum Künstler. Der Punkt ist jedoch: Ich selbst wäre ohne die Verwendung einer solchen KI nicht in der Lage, irgendetwas in dieser Form zu erstellen.
Die computergenerierte Erstellung von Bildern ist kein neues Phänomenon, sondern wird schon seit mehreren Jahrzehnten in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel der
Filmindustrie, eingesetzt. Doch sind in jüngster Zeit Systeme wie DALL-E 2, Midjourney 2 oder Stable Diffusion 3 sehr populär geworden. Ein mit Midjourney erstelltes Bild hat sogar einen künstlerischen Wettbewerb gewonnen – durchaus auch zum Missfallen vieler Kunstschaffender, eindrucksvoll dokumentiert in entsprechenden Diskussion auf Twitter.4 Doch wie funktionieren solche Systeme? Im Grunde ist das recht einfach: Sie lernen Beziehungen, die zwischen Text sowie Bildern bestehen, und nutzen diese dann, um neue Bilder zu generieren. Bei der Frage, wie sie das tun, wird es allerdings komplex. Zunächst werden diese Systeme zu diesem Zweck auf sehr grossen Datenmengen (auf viel Text und vielen Bildern) «trainiert». Dann kommen sie zum Einsatz (lernen aber weiterhin auf Basis neuer Daten). Der DALL-E 2 zugrunde liegende Ansatz zur Generierung von Bildern wird beispielsweise als «Diffusion» bezeichnet. Dies beschreibt einen Prozess, der mit zufällig verteilten Punkten startet und diese dann Schritt für Schritt so verändert, bis ein Bild entsteht, das den textuell beschriebenen Anforderungen ent-
–
und was es für den Menschen bedeutet
65 UNIVERSITÄT LIECHTENSTEIN
spricht.5 Die Abbildung auf Seite 67 zeigt eine frühe sowie die finale Version von Bildern mit Bussen am Strand, erzeugt mit Midjourney (Prompt: «a painting of a bus on the beach»; «ein Bild eines Busses am Strand»).
Das Einsatzspektrum ist sehr breit. So wollte ich zum Beispiel sehen, ob mir DALL-E 2 dabei helfen kann, ein imaginäres Haus am Strand zu entwerfen (Prompt: «a futuristic house by the sea in photorealistic style»). Ich habe meine Kolleginnen und Kollegen aus der Architektur nicht gefragt, was sie vom Ergebnis halten, aber der Punkt ist, dass ich auch hier nicht in der Lage gewesen wäre, etwas Vergleichbares ohne die Hilfe eines KI-basierten Systems zu generieren.
Bilder auf Basis von Text zu erstellen (bzw. erstel len zu lassen), macht Spass. Es zeichnet sich aber bereits ab, dass diese Systeme nicht nur hedonistischen Charakter haben, sondern dass sie auch vermehrt im professionellen Bereich Anwendung finden werden. Im Zusammenwirken mit Experten werden sie zu mächtigen Werkzeugen. Die untenstehenden Bilder wurden von einem professionellen Künstler – Ed Lee –erstellt.6 Die Stärke KI-basierter Systeme entfaltet sich dann, wenn maschinelle und menschliche Fähigkeiten kombiniert werden. Bei der Erstellung der unten stehenden Bilder war dies der Fall – sie resultieren aus dem Zusammenwirken von KI und menschlicher Fähigkeit und Kreativität. Dieses neue Miteinander von Mensch und Maschine hat wichtige Auswir-
kungen auf die Entwicklung von Design-Arbeit – und wie wir sie organisieren. Ich möchte zwei Punkte hervorheben: gemeinsames Lernen und «Orchestrierung».

GEMEINSAMES LERNEN

In der Vergangenheit haben menschliche Designerinnen und Designer lernen müssen, wie sie bestimmte Werkzeuge am besten einsetzen können – einen Pinsel, Farbe, eine Leinwand. Das gleiche gilt für digitale Werkzeuge, die zum Beispiel das Zeichnen oder Malen erleichtern (die Fähigkeiten von Photoshop sind wahrscheinlich hinlänglich bekannt). In diesem traditionellen Design-Paradigma gehen Künstlerinnen und Künstler eine enge Beziehung mit den Werkzeugen ein, mit denen sie arbeiten. Über die Zeit werden sie geübter, manchmal sogar virtuos. Doch wie verändert sich dies in der Gegenwart von Maschinen, die selbst Fähigkeiten haben, die manch einer als kreativ bezeichnen würde? An die Stelle exklusiv menschlichen Lernens treten Kombinationen aus menschlichem und maschinellem Lernen.7 Erstens müssen Menschen lernen, wie sie mit diesen neuen Systemen arbeiten können. Welche Inputs führen zu welchen Outputs? Wirkt es sich aus, ob ich die Wörter in unterschiedlicher Reihenfolge eingebe? Welche Rolle spielen Substantive, welche Rolle spielen Verben? Sollte mein Prompt besser in Form von Text erfolgen oder sollte ich ein Bild als Input verwenden (auch dies ist möglich) – und in welcher Situation bietet sich was an? Zweitens lernt nun auch die Maschine. Wie oben erwähnt, haben DALL-E 2, Midjourney und Stable Diffusion zum Beispiel gelernt, aus Text-Input Bilder zu generieren – und dabei wichtige Eigenschaften wie Stil oder Farbgebung selbstständig zu berücksichtigen. Und drittens lernen nun Mensch und Maschine als hybride Systeme gemeinsam. Menschliche Designerinnen und Designer geben Inputs und lernen, in welchem Zusammenhang diese zu Outputs stehen. Sie bewerten das Resultat («gute» maschinen-generierte Designs werden vielleicht heruntergeladen oder sogar weiterbearbeitet). Dies hilft wiederum der Maschine, zu lernen. Mensch und Maschine stimmen ihre Arbeitsweisen aufeinander ab. Das Ergebnis ist ein komplexes System aus Mensch und Maschine, das im Zeitablauf immer neue Ergebnisse hervorbringen kann.
ORCHESTRIERUNG
Menschliche Designer und Designerinnen delegieren DesignArbeit an Maschinen. Sie können verschiedene Systeme miteinander kombinieren, eigene Visualisierungen oder Text als Inputs verwenden und die Ergebnisse verändern, in-
https://edleeart.artstation.com/projects/ArxN6q
Ed Lee,
66 UNIVERSITÄT LIECHTENSTEIN
«Environment lighting samples (2022)» von Ed Lee 6






«a futuristic house by the sea in photorealistic style» 67
«a painting of a bus on the beach»
dem sie traditionellere Werkzeuge (wie z.B. Photoshop) verwenden. Die Outputs eines KI-basierten Systems können als Inputs für ein anderes dienen. Die verschiedenen KI-basierten Systeme unterscheiden sich in ihren Fähigkeiten. Während manche gut darin sind, Gesichter zu erstellen, können andere gut darin sein, Landschaften zu generieren. Und für manche Probleme werden weiterhin manuell zu bedienende Werkzeuge verwendet.
Im Beispiel rechts habe ich einen der Busse von Seite 67 verwendet, um vier Variationen auf Basis dieses Outputs in DALL-E 2 zu erstellen – ich habe also zwei Systeme orchestriert.
Es geht also darum, KI-basierte Systeme, traditionelle Design-Werkzeuge und menschliche Fähigkeiten miteinander zu kombinieren, um so bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Designer werden mehr und mehr verstehen, welche KI-basierten Systeme wie eingesetzt und kombiniert werden können – auch mit traditionelleren Werkzeugen wie Photoshop. Sie orchestrieren Mensch-Maschine-Design-Systeme.
AUSBLICK
In den Händen von Experten liefern neue, KI-basierte Systeme beeindruckende Ergebnisse, die beispielsweise bei der Erstellung sogenannter Concept Art für Videospiele oder Filme zum Einsatz kommen können. Kunstschaffende können in kurzer Zeit neue Bilder generieren, diese modifizieren und das für ihre Zwecke beste auswählen. In diesem neuen Paradigma ist Kreativität ein sozio-technisches Phänomen, in dem Menschen und Maschinen symbiotisch zusammenwirken. Ein Bild, dessen Erstellung früher mehrere Tage gedauert hat, kann nun – inklusive der manuellen Tätigkeiten –in einer oder einer halben Stunde erstellt werden. Ein geübter Designer kann innerhalb weniger Tage einen grafischen Roman (graphic novel) erstellen.
Die Stärke künstlicher Intelligenz in ihrer heutigen Form liegt in ihrer Interaktion mit menschlichen Akteuren. Es ist nach wie vor der Mensch, der eine Vision hat und an die Maschine delegiert – und dessen künstlerische Fähigkeiten in der Bearbeitung zu beeindruckenden Ergebnissen führt. Doch Systeme wie DALL-E 2, Midjourney oder Stable Diffusion ermöglichen es, dieser Vision eine erste Gestalt zu geben. Natürlich gibt es auch Bedenken. Sollten und können Maschinen kreativ sein? Welche Auswirkungen haben diese Technologien für den Arbeitsmarkt? Wie sieht es mit Urheberrechten aus (schliesslich werden die Maschinen ja auf Basis existierenden Materials «trainiert»)?
Berechtigte Bedenken kommen immer dann auf, wenn neue Technologien in Bereiche eindringen, die in der Vergangenheit menschlichen Akteuren vorbehalten waren – und sie die etablierte Identität dieser Akteure infrage stellen. Doch die Geschichte hat uns gelehrt – man denke an Buchdruck, Radio, Film, Fernsehen, Computer und Internet – dass disruptive Technologien zwar einerseits zu grundlegenden Veränderungen führen, doch dass diese Veränderungen nicht gleich die Rolle des Menschen obsolet machen. Vielmehr verändern und erweitern sich seine Aufgaben und Möglichkeiten.
In diesem Sinne wünsche ich viel Freude beim Ausprobieren dieser neuen Technologien und bei der Erkundung der damit verbundenen Möglichkeiten.
Prof. Dr. Stefan Seidel, Lehrstuhlinhaber Lehrstuhl für Informationssysteme und Innovation, Institut für Wirtschaftsinformatik

1 https://openai.com/dall-e-2/ 2 https://www.midjourney.com
https://stability.ai 4 Roose, K (2022). An A.I.-Generated Picture Won an Art Prize. Artists Aren’t Happy. New York Times. https://www.nytimes.com/2022/09/02/ technology/ai-artificial-intelligence-artists.html. Accessed 2022-10-17. 5 https://openai.com/dall-e-2/ 6 https://edleeart.artstation.com/projects/ArxN6q 7 Wir beschreiben dies ausführlich in Seidel, S., Berente, N., Lindberg, A., Lyytinen, K., & Nickerson, J. V. (2018). Autonomous tools and design: a triple-loop approach to human-machine learning. Communications of the ACM, 62(1), 50-57. Abrufbar unter: https://dl.acm.org/doi/pdf/ 10.1145/3210753





3
68 UNIVERSITÄT LIECHTENSTEIN
Publikationen und digitale Projekte der Universität Liechtenstein
Demütige Führung, kompetitive Mitarbeitende
Demütiges Führungsverhalten besteht aus drei Facetten: (1) der Wertschätzung der Stärken und Beiträge anderer, (2) dem Anerkennen der eigenen Schwächen und (3) der Bereitschaft zum Lernen. Kompetitive Mitarbeitende haben ein starkes Bedürfnis mit anderen Personen zu konkurrieren und um jeden Preis zu gewinnen. In zwei Studien (einer 14-monatigen Fragebogenstudie und einem Szenario-Experiment) wurde untersucht, ob Führungskräfte, die demütiges Verhalten zeigen, besser in der Lage sind, Vertrauen gegenüber ihren Mitarbeitenden aufzubauen und diese dadurch im Unternehmen zu halten, als Führungskräfte, die ein weniger demütiges Verhalten zeigen.
Liborius, P., & Kiewitz, C. (2022). When leader humility meets follower competitiveness: Relationships with follower affective trust, intended and voluntary turnover. Journal of Vocational Behavior, 135, 103719. https://doi. org/10.1016/j.jvb.2022.103719
Zufall – Rechtliche, philosophische und theologische
Aspekte
Was ist Zufall? Gibt es Zufälle oder ist alles determiniert? Welche Relevanz hat Zufall für die Beurteilung menschlichen Handelns? Der Tagungsband beleuchtet den Zufallsbegriff dem Titel nach aus rechtlicher, philosophischer und theologischer Perspektive, wobei die einzelnen Beiträge ein noch weiter gefächertes Spektrum an Ansätzen liefern. Von der (Quanten-)Physik, der Wahrscheinlichkeitstheorie oder noch den Topoi von Wissen und Willensfreiheit, über die strafrechtliche Zurechnungslehre, den moralischen Zufall und den strafrechtlichen Unrechtsbegriff oder noch die öffentlich-rechtliche Frage der Verteilung des CoronaImpfstoffes bis hin zur Sprechakttheorie und Psychoanalyse in der Theologie, zur Sozialphilosophie oder noch zum umfassenden Aspekt (religions-)philosophischer Kontingenzbewältigungen.
Konstantina Papathanasiou (Editor), Zufall – Rechtliche, philosophische und theologische Aspekte, 2022, Philosophische Schriften (PHS), Band 109, 206 Seiten, Berlin: Duncker & Humbolt.
Onlinekurse im Bereich Pension und Personal Finance
In einschlägigen Studien wird die Financial Literacy der allgemeinen Bevölkerung oft als «mangelhaft» beschrieben. Komplexe Themen wie die optimale Vermögensanlage während des Arbeitslebens, die Absicherung von Überlebensrisiken aber auch das Verständnis für die Problematik des demographischen Wandels im Zusammenhang mit der Alterssicherung spielen hier eine wichtige Rolle. Diese verlangen jedoch ein fundiertes finanzmathematisches Vorwissen sowie ein Verständnis der wichtigsten Begriffe und Gesetzesgrundlagen. In diesem Zusammenhang konnten am Lehrstuhl in Finance von Prof. Dr. Michael Hanke sowie Ass.Prof. Dr. Sebastian Stöckl zwei, von der EU geförderte, Erasmus+-Projekte zu diesem Themenkomplex eingeworben werden, welche in deutscher und englischer Sprache der allgemeine Bevölkerung Europas die notwendigen Werkzeuge vermitteln sollen.
Alle Kurse aus den drei Projekten finden sich im Onlinekurs-Portal der Universität Liechtenstein unter https://courseware.uni.li.
Smart Home
Die Digitalisierung verändert unser Zuhause und die Art des Zusammenlebens. Unter anderem sind die Implikationen von Smart Homes auf den versicherungsrechtlichen Bereich nahezu unerforscht. In der Abhandlung wurden daher eingängig die grundlegenden Fragen von Smart Homes im Zusammenhang mit dem liechtensteinischen Versicherungsvertrags- und dem Gebäudeversicherungsgesetz beleuchtet.
Es wurde untersucht, ob sich durch nachträglich installierte Smart-Home-Geräte eine Änderung der Gefahrenlage für den Versicherer ergibt und eine Leistungsreduktion oder auch der Wegfall der Leistungspflicht eintreten kann.
Es ist festzuhalten, dass eine Qualifikation von SmartHome-Geräten als erhebliche Gefahrentatsache nur in den seltensten Fällen vorliegen wird und sohin grundsätzlich keine nachträgliche Anzeigepflicht für die Versicherungsnehmenden besteht.
Butterstein, A., Jörg, M., & Lettenbichler, M. (2020). Das Smart Home im liechtensteinischen Versicherungsrecht. Spektrum des Wirtschaftsrechts, 499510. (online abrufbar: http://www.spektrum-des-wirtschaftsrechts.at/)
Krisen bewältigen: Das Zusammenspiel von Innovation und politischer Unterstützung
In Krisenzeiten stellt sich die Frage, wie es gelingen kann, die wirtschaftliche Leistung von Unternehmen zu stabilisieren, bis der Sturm vorüber ist. Diese Studie verbindet Forschung zu staatlichen Eingriffen (z.B. über staatliche Nachfrage) und zu unternehmerischer Innovationstätigkeit. Die Untersuchung der deutschen erneuerbaren Energiebranche während der globalen Finanzkrise ergab, dass staatliche Eingriffe in dieser Situation vor allem diejenigen Unternehmen stabilisiert haben, die weder radikale noch inkrementelle Innovationen verfolgen wollten oder konnten. Hoch innovative Unternehmen litten nicht zwangsläufig darunter, reagierten jedoch mit einer höheren Volatilität der Ergebnisse. Diese Studie betont die Bedeutung der Abstimmung zwischen Politik und Wirtschaft und bietet Erkenntnisse für das Postulat der Hilfe zur Selbsthilfe in Krisenzeiten.
Claudia Doblinger, William Wales, Alexander Zimmermann, Stemming the downturn: How ambidexterity and public policy influence firm performance stability during economic crises, European Management Journal, Volume 40, Issue 2, 2022, Pages 163-174, ISSN 0263-2373, https://doi. org/10.1016/j.emj.2021.06.002.
Wie
funktionieren die sogenannten digitalen Gefährten?
Diese Fragen stellt Dr. Leona Chandra Kruse in einem von Erasmus + geförderten Projekt «AI-Bility: Building AI Awareness in Schoolchildren». Digitale Gefährten (engl. digital companions) für Kinder sind KI-basierte Charaktere, die eine Unterhaltung selbstständig weiterführen können und zu denen die Kinder eine Beziehung aufbauen und gemeinsame Aktivitäten durchführen können. Diese Charaktere können sogar eine physische Verkörperung (z.B. in der Form eines Roboters oder eines intelligenten Spielzeugs) haben. Jedoch wissen wir noch zu wenig über die damit verbundenen Risiken für Kinder. Durch Fokusgruppendiskussionen und Experimente versucht das Projektteam, sich diesem Thema anzunähern.
Mehr Information auf https://ai-bility.eu.
69 UNIVERSITÄT LIECHTENSTEIN
FORSCHUNG UND LEHRE AUF 160 QUADRATKILOMETERN
Liechtenstein-Institut
Das Liechtenstein-Institut ist ein privates, unabhängiges wissenschaftliches Forschungsinstitut. Es bearbeitet liechtensteinrelevante Forschungsthemen in den Fachbereichen Geschichte, Politik, Recht und Volkswirtschaft. Ziel ist es, wissenschaftlich fundierte Antworten auf zentrale Fragen zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft Liechtensteins, zur Region und zu Kleinstaaten allgemein zu liefern. Sitz Gamprin-Bendern Gründung 1986 Mitarbeitende 21 Website www.liechtenstein-institut.li

70
Universität Liechtenstein
Die Universität Liechtenstein ist eine führende Hochschule der internationalen Bodenseeregion. Sie ist ein Raum für persönliche Entfaltung und für Begegnung. In den Bereichen Architektur und Raumentwicklung, Entrepreneurship, Finance, Wirtschaftsrecht und Wirtschaftsinformatik wirkt sie als ein bedeutender Ort kritischen und kreativen Denkens und als Innovationsstätte für Zukunftsgestaltung. In zahlreichen Projekten und Programmen gibt sie Impulse für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Seit über 60 Jahren werden gefragte Fachkräfte aus- und weitergebildet. Das Studium erfolgt in einem sehr persön lichen Umfeld.
Sitz Vaduz
Gründung Universität 2011 (die Vorläufer Abendtechnikum 1961 und Fachhochschule 1993)

Mitarbeitende 205 Studierende ca. 800 Website www.uni.li
Private Universität im Fürstentum Liechtenstein (UFL)

Die Private Universität im Fürstentum Liechtenstein (UFL) ist eine staatlich bewilligte und nach europäischen Qualitätsstandards akkreditierte private Universität. Sie bietet seit über 20 Jahren Doktoratsstudiengänge in den Rechtswissenschaften und der Medizinischen Wissenschaft sowie akademische Weiterbildungsstudiengänge und Fortbildungskurse an.
Sitz Triesen Gründung 2000 Mitarbeitende 24 (ohne externe Lehrbeauftragungen) Studierende 175 Website www.ufl.li
71
Ein gemeinsames Magazin von LIECHTENSTEIN-INSTITUT PRIVATE UNIVERSITÄT IM FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN (UFL) UNIVERSITÄT LIECHTENSTEIN
Herausgeber Liechtenstein-Institut St. Luziweg 2, 9487 Gamprin-Bendern www.liechtenstein-institut.li
Private Universität im Fürstentum Liechtenstein (UFL) Dorfstrasse 24, 9495 Triesen www.ufl.li
Universität Liechtenstein Fürst-Franz-Josef-Strasse, 9490 Vaduz www.uni.li
Redaktion
Christian Frommelt, Ruth Allgäuer (Liechtenstein-Institut)
Elisabeth Berger, Christoph Säly (Private Universität im Fürstentum Liechtenstein)
Stefan Seidel, Heike Esser (Universität Liechtenstein)
Auflage 21 750 Exemplare Visuelles Konzept und Gestaltung Screenlounge Grafik Studio

Illustrationen Screenlounge, Ariana Huber, Anna Hilti (S.50–53)
Druck BVD Schaan 100 % Recyclingpapier
160 2 – DEZEMBER 2022


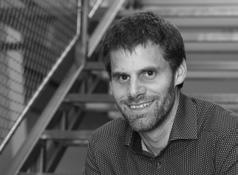








 ler vom 11. Juli 1913. In: Copie de Lettres, Band l, S. 50/51 (Privatarchiv Rupert Quaderer)
ler vom 11. Juli 1913. In: Copie de Lettres, Band l, S. 50/51 (Privatarchiv Rupert Quaderer)