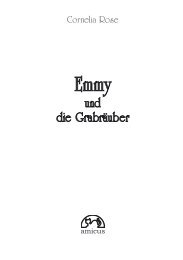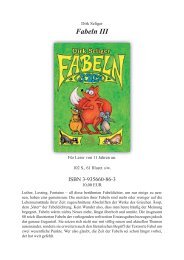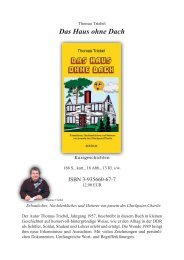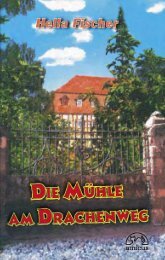Einfach mal Probelesen - amicus Verlag
Einfach mal Probelesen - amicus Verlag
Einfach mal Probelesen - amicus Verlag
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Inhaltsverzeichnis<br />
Walter Steiner Klassentreffen 1990<br />
Heinz Sperschneider Vergangenheitsbewältigung<br />
Helga Sperschneider Hausfrau - ein DDR-untypischer Beruf<br />
Werner Römmelt Begegnungen<br />
Liselotte Rath Ein weiblicher Hans im Glück<br />
Marianne Bergerhoff Unternehmen Barthold<br />
Christa Spiegl Gibt es Wurzeln?<br />
Walter Steiner Aufbruch und Ernüchterung<br />
Walter Steiner Mein Freund Gustav<br />
Heinz Heinkel Die Jenenser Studentengruppe<br />
Friedrich Escher Ein Leben mit drei Mittelpunkten: Familie - Pflanzen - Junge Menschen<br />
Heinrich Hofmann Die Reifeprüfung im Schatten des Hungers bestimmte meinen<br />
Lebensweg<br />
Magdalene Hitzig Jahrgang 1927<br />
Artur Rau Schicksal<br />
Gerhard Schröter Fluchthilfe<br />
Hans Braunschmidt Neue Heimat im Coburger Land<br />
Joachim Venter Im Spannungsfeld zwischen Heimat und Fremde<br />
Elisabeth Lauter Wegstrecken in der Ferne<br />
Burkhard Kreiß Zwischenstation Zweistromland<br />
Helga Heinemann Weichenstellungen<br />
Brigitte Fries Vom Einzelkind zur Mutter einer Großfamilie<br />
Trautel Baake Das andere Leben<br />
Sigrid Hartung Ein Leben für andere<br />
Harry Stamm 44 Jahre im Dienste der Post<br />
Walter Steiner Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste<br />
Bernhard Krämer Meine Erfahrungen in der deutschen Entwicklungshilfe<br />
Wolfgang Troppmann Auf Achsen geboren - für Europa bestimmt<br />
Helmut Sperschneider Viereinhalb Jahre russische Gefangenschaft<br />
Johannes von Depka Prinzip Hoffnung<br />
Elisabeth Schreiber Ein Wunsch wurde wahr<br />
Franz Héron Vergangenheits- und Zukunftsbewältigung
Heinz Sperschneider<br />
Vergangenheitsbewältigung 1<br />
"Innere Verarbeitung selbst erlebter Geschichtsvorkommnisse" steht im Wörterbuch "Der tägliche<br />
Wortschatz" von Lutz Mackensen und Eva V. Hollander, Stuttgart 1989, unter dem Stichwort<br />
"Vergangenheitsbewältigung". Im Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache der DDR gibt es<br />
dieses Stichwort nicht.<br />
Für mich begann die Vergangenheitsbewältigung am 8. Mai 1945, als ich in Dänemark im<br />
Gefangenenlager als 17jähriger mit einem Postbeamten aus Oberfranken zusammensaß und darauf<br />
wartete, dass etwas geschehen sollte. Wir wussten nur, der Krieg war aus, und wir hatten vorerst<br />
überlebt. In die Stille hinein, am Strand von Esbjerg, sagte der etwa 35jährige Kamerad: "Mensch,<br />
haben die uns das Leben versaut! Wie soll das weitergehen?"<br />
Und da wurde mir zum ersten Mal klar, dass es ja eine Zukunft gab und nicht nur die Vergangenheit<br />
mit Schule, Hitlerjugend, Luftwaffenhelferzeit an der Saaletalsperre, Arbeitsdienst in der Rhön und<br />
Wehrmacht im "Protektorat Böhmen und Mähren" und zum Kriegsende Gott sei Dank in Dänemark.<br />
"Sei bloß froh, dass du nie hast auf Menschen schießen müssen, Kleiner", sagte der Postler nach einer<br />
ganzen Weile in den Wind.<br />
Darüber hatte ich mir überhaupt noch keine Gedanken gemacht. Urplötzlich stand diese Frage vor mir.<br />
Ich hätte bedenkenlos geschossen. Und nun in dem Augenblick wurde es mir klar: Ich wusste, ich<br />
würde nie auf Menschen schießen und war dankbar, dass ich es bisher nicht musste. Der eine Satz<br />
meines Begleiters genügte, mich zum Pazifisten zu machen. Er hatte mit mir nie über den Krieg<br />
gesprochen, nur immer von seiner Frau und seinen Kindern erzählt, von seinen zwei Dörfern, durch<br />
die er vor dem Krieg täglich bei Wind und Wetter mit der Posttasche geradelt war.<br />
Ich kannte da<strong>mal</strong>s weder das Wort Vergangenheitsbewältigung noch das Wort Pazifist, aber ich<br />
wusste, dass ich mich mit dem Vergangenen auseinandersetzen musste und dass ich ein<br />
Verhaltensmuster für die Zukunft hatte: nie auf Menschen schießen!<br />
Zeitig, schon Ende August 1945, kam ich nach Hause. Schulanfang, Abitur, Freunde und Freundinnen,<br />
Beginn des Studiums in Halle ließen Vorsätze zur Vergangenheitsbewältigung immer mehr in den<br />
Hintergrund treten. Der Alltag forderte uns, ob es nun die Sorge um das tägliche Brot war (Stipendien<br />
kannten wir ja nicht) oder der Kampf um ein paar Sack Briketts. Und dann die vielen neuen<br />
Eindrücke, die ich begierig in mich aufnahm: Theater, Kunstausstellungen, Diskussionspodien, Dinge,<br />
die ich als Dorfkind aus dem Thüringer Wald nur vom Hörensagen kannte und die mich neben dem<br />
ernsthaften Studium voll in Anspruch nahmen.<br />
Durch eine Otto-Dix-Ausstellung in der Moritzburg wurde ich wieder zurechtgerückt. Vor dem<br />
Tryptichon "Krieg" haben wir manchen Nachmittag verbracht. Es stärkte meine pazifistische<br />
Grundhaltung und meine Hoffnung, dass wir einer friedlichen demokratischen Zeit entgegengehen<br />
müssen. In dieser fast euphorischen Phase schlug es wie eine Bombe ein, als ich erfuhr, dass<br />
Klassenkameraden von mir in Jena wegen "sozialdemokratischer Umtriebe" verhaftet worden waren.<br />
Sie wurden samt und sonders zu 25 Jahren Bautzen verurteilt. Da fiel mir zum ersten Mal nach Jahren<br />
wieder mein Briefträger ein, der nun sicher wieder in Oberfranken von Dorf zu Dorf fuhr: Mensch,<br />
haben die unser Leben versaut! Zwei Jahre habe ich dann noch in Jena studiert. Ich fand ältere<br />
Freunde, die mehr vom Krieg erlebt hatten, die mir Bertha von Suttners "Die Waffen nieder" gaben.<br />
Ich schloss mich ihnen in der Hochschulgruppe der CDU an, die ich übrigens am 18. oder 19. Juni<br />
1953 wieder verließ, nachdem der Parteivorsitzende Otto Nuschke die Maßnahmen des SED-Regimes<br />
und der sowjetischen Besatzungstruppen ausdrücklich gebilligt hatte. Meine Examensarbeit sollte sich<br />
mit dem Antikriegsroman beschäftigen. Daraus wurde nichts. Neben Pliviers "Stalingrad", ein Buch,<br />
das mir schlaflose Nächte bereitete, gab es 1950 in den Bibliotheken keine Antikriegsliteratur. Zu<br />
diesen beiden Büchern, die Suttner und den Plivier, kam noch "Im Westen nichts Neues", das mir ein<br />
alter Sozialdemokrat in meinem Heimatort gab. Es war eines von etwa 20 Büchern des ehe<strong>mal</strong>igen<br />
"Sozialdemokratischen Lesevereins Hämmern", das er über die Nazizeit gerettet hatte.<br />
Nach dem Examen durfte ich als Hilfskraft für 135 Mark im Monat bei 48stündiger Wochenarbeitszeit<br />
im Institut für Mundartforschung arbeiten. Erst ein Jahr später gab es eine Assistentenstelle. In dieser<br />
Zeit erwachte mein Interesse für volkskundliche Fragen.<br />
1 Dieser Artikel wurde am 13.11.1990 in der Universitätszeitung "alma mater jenensis" veröffentlicht.
Im Germanistischen Institut hatte sich eine Gruppe junger Genossen etabliert, die fast alle keine<br />
Ahnung von der sprachwissenschaftlichen Seite unseres Faches hatten. Dort fehlte jemand, der<br />
Seminare zur Einführung in Mittelhochdeutsch machte. Aufgrund einer soliden Ausbildung bei Carl<br />
Wele in Jena konnte ich mich dieser Aufgabe stellen und überstand recht und schlecht meine ersten<br />
Semester in der Lehre. Der Chef der Abteilung für ältere deutsche Sprache und Literatur war zu dieser<br />
Zeit Henrik Becker, der mich dann sehr bald für ein Semester beurlaubte, damit ich die Erhebungen in<br />
über 100 Dörfern des Thüringer Waldes für meine Dissertation anstellen konnte. Als Becker seines<br />
Parteiaustritts wegen aus der Lehre entfernt wurde und ein eigenes Institut für Sprachpflege und<br />
Wortforschung bekam, (er musste zudem auch Platz machen für Prof. Tschirch, der aus persönlichen<br />
Gründen aus Greifswald "abgezogen" wurde), der Nachfolger aber einen Assistenten mitbrachte,<br />
wurde mir vom da<strong>mal</strong>igen Institutsdirektor Joachim Müller gekündigt. Er sagte mir klar, dass mich die<br />
Parteigruppe nicht im Kollektiv wünsche, er selbst habe keinen Grund für die Kündigung. Als<br />
Schwerbeschädigter hatte ich allerdings an der Universität Kündigungsschutz und Henrik Becker bot<br />
mir an, in seinem Institut zu arbeiten.<br />
Inzwischen war 1957 mein Promotionsverfahren abgeschlossen worden und 1959 meine Dissertation<br />
in der Reihe "Deutsche Dialektgeografie" in Marburg/Lahn erschienen. Der Druck erfolgte mit<br />
ausdrücklicher Genehmigung des da<strong>mal</strong>igen Staatssekretariats für das Hoch- und Fachschulwesen.<br />
Wie sauer man darauf im Germanistischen Institut reagierte, musste ich bald nach dem Erscheinen<br />
meiner Arbeit erfahren. Auf einer Veranstaltung des Gesamtinstituts wurde ich angegriffen wegen<br />
einer "Publikation beim Klassenfeind". Irgendeiner der Genossen führte schließlich an, dass die Arbeit<br />
ja nicht gut sein könne, denn wenn sie gut wäre, wäre sie marxistisch und wenn sie marxistisch wäre,<br />
wäre sie nicht im Westen erschienen, ergo sei sie schlecht und es lohne sich nicht, darüber zu streiten.<br />
Dieser Argumentation war ich nicht gewachsen. Die fünf oder sechs internationalen Rezensionen<br />
wurden von den Genossen natürlich ignoriert.<br />
In diese Zeit fiel auch ein erster Kontakt mit dem Institut für Volkskunde an der Akademie für<br />
Wissenschaften in Berlin. Es war geplant, eine regionale Arbeitsstelle für Thüringen einzurichten, wie<br />
sie schon in Dresden für Sachsen und in Rostock für Mecklenburg-Vorpommern bestanden. Für den<br />
Aufbau dieser Stelle in Jena war ich vorgesehen. Die Absprache ging dahin, dass ich für einige Zeit<br />
zur Einarbeitung nach Dresden gehen sollte. In einem ausführlichen Gespräch mit Friedrich Sieber,<br />
dem Leiter der Dienststelle für Sachsen, kamen wir überein, dass ich zu ihm "in die Lehre" gehen<br />
sollte. Allerdings, so sagte er mir zum Abschied, habe das letzte Wort natürlich die Kaderabteilung.<br />
Die Angelegenheit lief den üblichen Weg: Anfrage aus Berlin in Jena, Anfrage der Jenaer<br />
Kaderabteilung bei der Parteigruppe der Germanistik. Die Beurteilung von dort, die meinen weiteren<br />
Lebensweg bestimmt hat, fand ich in meiner Kaderakte unter den laufenden Nummern 30 bis 32. Dass<br />
zwischendurch auch noch 1960, (dem Zeitpunkt der Einschätzung) bis zum Jahre 1970 Nummern der<br />
Akte fehlten, als man sie mir zur Einsicht gab, zeugt wohl davon, dass sie schon "kritisch<br />
durchgesehen" war.<br />
Hier nun der Text, der im schönsten "Parteichinesisch" verfassten Originalhandschrift von Hans<br />
Richter, derzeit ordentlicher Professor an der Sektion Literatur- und Kunstwissenschaft unserer<br />
Universität. Aus dieser Beurteilung hat der da<strong>mal</strong>ige Kaderchef Georg Konietzny den Bericht an die<br />
Akademie zusammengestellt. Dabei konnte er offenbar das Wort "philiströs" nicht entziffern und hat<br />
in seiner Einfalt daraus das neue Wort "politiströs" geschaffen.<br />
SED-GO Phil. III<br />
Zur Beurteilung des Koll. Dr. Heinz Sperschneider<br />
Koll. Dr. Sperschneider kommt aus der arbeitenden Bevölkerung des Thüringer Waldes und besitzt<br />
durchaus Sinn für die Probleme des werktätigen Volkes, hat sich aber nie zum vollen Verständnis der<br />
historischen Mission der Arbeiterklasse aufgeschwungen. Sein politischer Horizont ist beschränkt,<br />
seine Lebensauffassung und -gestaltung trägt ausgeprägte kleinbürgerlich-philiströse Züge. Während<br />
seines Studiums und auch danach nahm er nie sehr ernsthaft, und vor allem ohne rechte Energie, am<br />
gesellschaftlichen Leben teil. Das hinderte ihn freilich nicht daran, im Institut für Mundartforschung<br />
als Kenner der thüringischen Mundartforschung nützliche Arbeit zu leisten.<br />
Am Germanistischen Institut allerdings, wo er wegen Mangel an linguistischen Fachkräften von 1955-<br />
58 tätig war, konnte er das notwendige politisch-ideologische Entwicklungstempo nicht erreichen und<br />
erwies sich als kaum geeignet, im erforderlichen Maße erzieherisch zu wirken. Obwohl er sich durch<br />
den endlichen Abschluss seiner Dissertation fachlich weiterqualifizierte, schied er nach gründlichen
kritischen Diskussionen in der Gewerkschaftsgruppe aus dem Institut aus und wurde auf Wunsch Prof.<br />
Beckers im hiesigen Institut für Sprachpflege und Wortforschung eingestellt, wo er sich bewähren<br />
sollte und nach Angabe seines Institutsdirektors auch bewährt haben soll. Tatsächlich scheint sich<br />
Koll. Dr. Sperschneider in der jüngsten Vergangenheit in seiner Haltung zu unserem Staate gefestigt<br />
zu haben und mit etwas größerer Bewusstheit, wenngleich in den Grenzen seines Vermögens, für<br />
unser gesellschaftliches Leben zu wirken.<br />
Im Auftrag der Leitung<br />
gez. Richter<br />
Mitgl. d Leitg. d GO<br />
Phil. III<br />
Wie bewusst bösartig und diffamierend Hans Richter bei der Abfassung der Beurteilung vorgegangen<br />
ist, mag daran zu sehen sein, dass er über meine fachliche Arbeit nur zu berichten weiß, dass ich<br />
"durch den endlichen Abschluss" meiner Dissertation mich fachlich weiterqualifiziert habe. Diese<br />
Beurteilung ist wohl im Herbst 1960 geschrieben worden. (Das daraus entstandene Schreiben der<br />
Kaderabteilung stammt vom 1. November 1960). Ich wurde aber bereits am 14. Dezember 1957<br />
promoviert und 1959 im Frühsommer war die Dissertation im Druck erschienen. Aufgrund dieser<br />
Beurteilung wurde natürlich nichts aus dem Thüringeninstitut. Ich blieb also im Institut für<br />
Sprachpflege und begann Mitte der sechziger Jahre auf Anraten von Prof. Nedo, dem Ordinarius für<br />
Volkskunde an der Humboldt-Universität, Materialsammlungen zur Volkskunde der<br />
Spielwarenarbeiter meiner Heimat für eine Habilitationsschrift anzulegen. Anlässlich der<br />
Hochschulreform wurde das Institut für Sprachpflege aufgelöst, Henrik Becker war 65 geworden,<br />
Bibliothek und Personal wurden in das Ferdinand-Hestermann-Institut übernommen.<br />
Ein neuerlicher Versuch Professor Nedos, die Volkskunde in Jena, dies<strong>mal</strong> als Universitätsstelle, zu<br />
etablieren, scheiterte an Prof. Fricke, dem da<strong>mal</strong>igen Dekan. Er äußerte gegenüber Prof. Nedo: Wir<br />
warten, bis wir einen Genossen für diese Stelle haben. So warten wir in Jena bis heute noch auf eine<br />
wissenschaftliche Arbeitsstelle für thüringische Volkskunde. Übrigens wurde mir kurz nach diesem<br />
Gespräch zwischen Nedo und Fricke von der Sektionsleitung bedeutet, dass es sich für mich nicht<br />
lohnen würde, eine Promotion B anzustreben, da ich mit Gewissheit an dieser Sektion keine Dozentur<br />
für Volkskunde bekäme.<br />
1972 wurde die Stelle des Direktors des Deutschen Spielzeugmuseums in Sonneberg frei. Der<br />
Museumsbeirat der DDR sah eine Gelegenheit, die fehlende wissenschaftliche Forschungsstelle für<br />
Thüringische Volkskunde mit der Leitung des Museums zu koppeln, und schlug mich dem Rat des<br />
Bezirkes Suhl vor. Ich stand auch unter den Suhler Museologen als einziger Kandidat fest. Der<br />
Vorschlag wurde von der Kaderleitung des Bezirkes abgeblockt mit dem lapidaren Satz: "Uns<br />
interessiert kein Fachmann, uns interessiert ein Genosse!" Vorher hatte man - alle Anzeichen deuten<br />
darauf hin - an der Universität nachgefragt.<br />
Jetzt, in den letzten zwei Jahren, bevor ich "berentet" werde, kann mir die Beurteilung der<br />
Genossinnen und Genossen von der da<strong>mal</strong>igen SED-GO Phil. III hoffentlich nicht mehr schaden.<br />
Darüber bin ich froh.<br />
Ich beginne nun ein zweites Mal Vergangenheit zu bewältigen. Das wird wohl lange dauern, immerhin<br />
waren es 45 Jahre. Und manch<strong>mal</strong> denke ich dabei an den Satz meines Briefträgerfreundes aus<br />
Oberfranken vom 8. Mai 1945:<br />
Mensch haben die uns das Leben versaut!<br />
"Versaut"?<br />
Ein kurzes Wort anlässlich eines langen Artikels 2<br />
Der Verfasser des Aufsatzes "Vergangenheitsbewältigung" in Nr.6 dieser Zeitung berichtet mitteilsam<br />
aus seinem Leben, das er mit Nachdruck für "versaut" erklärt. Dabei macht er mich als einen<br />
(Mit)schuldigen besonders sinnfällig namhaft: Er zitiert in Gänze einen vor über drei Jahrzehnten im<br />
2<br />
Die Erwiderung von Hans Richter auf Heinz Sperschneiders Artikel erschien in der "alma mater jenensis" am 11.12.1990<br />
Auch das ist eine Vergangenheitsbewältigung!?
Auftrag der da<strong>mal</strong>igen SED-Parteileitung des Bereichs geschriebenen Beitrag zu seiner Beurteilung,<br />
der ihm erst vor Monaten bekannt geworden ist. Da wir einander gut kennen und schon viele lockere<br />
Gespräche miteinander hatten, wäre denkbar gewesen, dass er mir den Text sofort auftischt, um zu<br />
hören, was ich dazu sagen kann. Freilich verstehe ich sehr gut, dass er das Schriftstück, (von dem ich<br />
längst keine Ahnung mehr hatte), nun öffentlich macht und es mit Schärfe kommentiert.<br />
Wie gerade ein Philologe die Vokabel "Parteichinesisch" brauchbar finden kann, mag sein Problem<br />
bleiben. Wenn er jedoch aus meinem Text bewusste Bösartigkeit herausliest, muss ich ihm ganz<br />
entschieden widersprechen. Wie immer man das auch empfinden mag: ich habe da<strong>mal</strong>s meiner vielen<br />
bekannten Gewohnheit gemäß, nur das und möglichst ausgewogen geschrieben, was ich mit gutem<br />
Gewissen für wahr und richtig hielt. Dass Parteigremien von der Kaderleitung veranlasst wurden,<br />
politische Urteile über Kollegen abzugeben, die denen unzugänglich blieben, war mir seinerzeit leider<br />
so selbstverständlich, wie es mir inzwischen suspekt ist. Solche Praxis einst mitgemacht zu haben, ist<br />
gewiss eine Schuld, zu der ich mich bekennen muss. Als Schmied von jemandes Unglück vermag ich<br />
mich aber auch nach der aufschlussreichen Lektüre besagten Artikels nicht zu sehen. Und ich weiß<br />
auch niemand, der seinem Autor die Chance "versaut" hätte, sich zu habilitieren. Die Einlassungen des<br />
Klägers haben mich nicht des Eindrucks beraubt, dass er die Kunst zu leben ebenso gut versteht wie<br />
den Dialekt der Thüringer.<br />
Hans Richter<br />
"Ein kurzes Wort" – aber doch ein symptomatisches Wort 3<br />
Obgleich ich seit einigen Wochen aufgrund einer Berufung nach Freiberg nicht mehr zur Friedrich-<br />
Schiller-Universität gehöre, fühle ich mich ihr nach über 20-jähriger Zugehörigkeit nach wie vor<br />
verbunden und verfolge mit Interesse alle Anzeichen des Erneuerungsprozesses, soweit dies durch die<br />
Lektüre der Universitätszeitung möglich ist. Ich bin der festen Überzeugung, dass Artikel wie<br />
"Vergangenheitsbewältigung" (AMJ-UZ Nr. 6, Stj. 1990/91) von Dr. Heinz Sperschneider eine<br />
unumgängliche Voraussetzung darstellen, all die Wunden wenigstens oberflächlich zu heilen, die<br />
durch mangelnde Integrität und menschliches Versagen einzelner Persönlichkeiten dieser Hochschule<br />
erzeugt worden sind und die andernfalls eine zukünftige kreative Zusammenarbeit unzumutbar<br />
belasten würden. Ohne jeden Zweifel ist es auch wünschenswert, dass belastend Angesprochene dazu<br />
Stellung nehmen und auch diese Erwiderungen abgedruckt werden ("'Versaut?' Ein kurzes Wort<br />
anlässlich eines langen Artikels" von Hans Richter, AMJ-UZ Nr. 8, Stj. 1990/91).<br />
Wer nun aber vielleicht die Illusion besessen hatte anzunehmen, es könnte in dieser Entgegnung<br />
wenigstens eine Spur des Bedauerns früherer Handlungsweisen zum Ausdruck kommen oder gar der<br />
Versuch unternommen werden, sich beim Geschädigten zu entschuldigen, der sah sich getäuscht. Er<br />
"vermag sich nicht als Schmied jemandes Unglücks zu sehen", ging es doch nur um die Erfüllung von<br />
seinerzeit ihm selbstverständlichen Pflichten, über die da<strong>mal</strong>s eindeutig diskriminierende Wirkung des<br />
Inhalts der zitierten Beurteilung geht man stillschweigend hinweg, wohl aber bringt man seinerseits<br />
die vom Fachwissen des Germanistikprofessors getragene Entrüstung zum Ausdruck, wie einer, den<br />
man ja ansonsten wohlwollend noch als Philologen gelten lassen will, die schwülstige Phraseologie<br />
jener Beurteilung als Parteichinesisch bezeichnen kann! (Sie haben natürlich recht, Herr Kollege<br />
Richter, die Wurzeln dieses pseudowissenschaftlichen Kauderwelsches lagen in der "Sprache der<br />
Partei Lenins" und nicht in der Maos. Aber jede Art sprachlicher Verständigung beruht<br />
bekanntermaßen auf Übereinkunft; und da der Unverständlichkeitsgrad dieses Vokabulars, das mit<br />
scheinbar bekannten Worten abstruse Aussagen machte, bei einer unbedeutenden Mehrheit unseres<br />
Volkes, zu der Sie offensichtlich nur wenig Kontakt hatten, in logisch gewiss nicht nachvollziehbarer<br />
Weise Assoziationen zum Chinesischen statt zum Russischen geweckt hatte, gehörte die Vokabel<br />
"Parteichinesisch" tatsächlich zur "Sprache der DDR", aber natürlich nicht zur "Literatursprache der<br />
DDR", die in Ihren Zuständigkeitsbereich gefallen wäre.)<br />
Und überhaupt: Was muss dieser Dr. Sperschneider für ein Mensch sein, dass er die ganze<br />
Angelegenheit drucken lässt, obwohl man sich doch so viele Jahre und so gut kennt?! Wäre diese<br />
Nebensächlichkeit nicht durch Schulterklopfen und wissendes Lächeln ("War ja nicht so gemeint, aber<br />
3 Diese Reaktion auf Hans Richters Erwiderung erschien in der "alma mater jenensis" am 29.1.1991.
Sie wissen doch, wir konnten da<strong>mal</strong>s nicht anders ...") viel menschlicher aus dem Weg zu räumen<br />
gewesen? So etwa liest sich die Einleitung des Richterschen Textes.<br />
Ich muss ehrlich gestehen, dass mich eine derartige arrogante Borniertheit, wie sie von Anfang bis<br />
Ende in der Entgegnung eines Hochschullehrers dieser Universität zum Ausdruck kommt, maßlos<br />
empört. Allzu leicht sind gerade gegenwärtig manche von uns, die wir die DDR über 40 Jahre<br />
miterlebt haben, vor allem in Diskussionen mit Kollegen aus den alten Bundesländern über<br />
Notwendigkeit oder gar Unumgänglichkeit der sogenannten "Abwicklung" (wir brauchen<br />
offensichtlich dringend einen dem "Parteichinesisch" analogen Begriff, der die Entgleisungen des<br />
modernen Bürokratendeutschs kennzeichnet!) geisteswissenschaftlicher Fachrichtungen geneigt, einen<br />
Vermittlung suchenden und differenzierenden Standpunkt einzunehmen. Wenn man allerdings<br />
derartige blasierte Sentenzen eines bisherigen Repräsentanten einer geisteswissenschaftlichen<br />
Fachrichtung als symptomatisch für deren Geisteshaltung auffassen muss, sollte einem die Korrektur<br />
des eigenen Standpunktes nicht schwer fallen.<br />
Prof. Dr. E. Müller, Bergakademie Freiberg
Liselotte Rath<br />
Ein weiblicher Hans im Glück<br />
Nach dem Abitur war ich zunächst Landwirtschaftslehrling in der "Flarichsmühle", einem<br />
Einzelgehöft bei Nordhausen. Es war eine schöne Zeit. Ich erzähle euch ein paar Geschichten von<br />
da<strong>mal</strong>s:<br />
Die Sau hat nicht geferkelt.<br />
Als Mitglied der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft fuhr mein Lehrchef jährlich zu Tagungen<br />
nach Göttingen. Ich brachte Herrn Lücke jeweils mit der Kutsche über die Grenze nach Walkenried,<br />
von dort aus fuhr er mit der Bahn weiter. Er blieb sechs bis acht Tage.<br />
In dieser Zeit war ich für den 380 ha großen Betrieb verantwortlich. Ausgerechnet in dieser Zeit<br />
ferkelte eine der wertvollen Zuchtsauen, und die Ferkel wurden sehr krank. Der herbeigeholte Tierarzt<br />
diagnostizierte eine Ferkelgrippe. Die "Säuglinge" waren nicht zu retten - dieses war ein hoher<br />
finanzieller Verlust.<br />
Im Jahr darauf (1948) war wieder Tagung in Göttingen, just in der Zeit, da die Zuchtsauen ferkeln<br />
mussten. Meine Ängste und schlaflosen Nächte könnt Ihr Euch vorstellen. Ich war nur noch im<br />
Schweinestall. Da holte mich eine Landarbeiterin aus den Gesindehäusern, weil eine der<br />
Flüchtlingsfrauen, Frl. L., genannt Minke, mit sehr großen Beschwerden in den Wehen läge, Die<br />
Gemeindeschwester des benachbarten Dorfes war telefonisch nicht zu erreichen , es war Sonntag. So<br />
fuhren wir mit der Kutsche in Richtung Nordhausen, mussten jedoch umkehren, da sich die Wehen<br />
verstärkten. Gemeinsam ersetzten wir die Hebamme. Minke brachte gesunde Zwillinge zur Welt.<br />
Zwei Tage danach holte ich Herrn Lücke in Walkenried ab. Auf seine Frage, ob alles in Ordnung sei,<br />
meine prompte Antwort: "Die Sau hat nicht geferkelt, aber Minke hat Zwillinge". Noch heute werde<br />
ich damit aufgezogen.<br />
Ein<strong>mal</strong> auf dem Pferd sitzen<br />
An Sonntagen im Sommer radelte ich gerne zum Baden im "Seeloch". Nach dem Bad am<br />
Spätnachmittag besuchte ich auch einen alten Wallach, der in der Nähe seine "Gnadenjahre" verlebte.<br />
Die Weide gehörte zu einem benachbarten Dorf, der Gaul kannte mich, hatte ich doch immer eine<br />
Möhre für ihn dabei.<br />
Dieses Mal sollte es sein, dieses Mal wagte ich es: Ich öffnete das Weidetor, kletterte auf eine Latte<br />
des Zaunes und dann hinauf auf das Pferd. Das Tor war offen, das Fahrrad lehnte am Zaun, und der<br />
Gaul setzte sich gemächlich in Bewegung, hinaus aus der Weide. Ich, oben, schwitzte vor Angst, hielt<br />
mich krampfhaft an der Mähne fest, ein "Ritter von trauriger Gestalt". Wohin sollte die Reise gehen?<br />
Ich hatte keine Ahnung, hatte keine Macht, die Reise zu bestimmen, ich konnte nur "Haltung"<br />
bewahren.<br />
[Es ist zu erklären, dass dort schon Vorharz-Gebiet ist. Das Seeloch liegt erhöht, bzw. seine Ufer. Der<br />
unfreiwillige Ritt ging also abwärts, hinunter von dem Hügel.]<br />
Gemächlichen Schrittes - das war mein Glück - führte mich das Pferd abwärts und in die der<br />
"Flarichsmühle" entgegengesetzten Richtung. Zu allem Übel kamen auch noch<br />
Sonntagsspaziergänger, die erstaunt guckten. Ich, hochrot vor Scham, sah betreten zur Seite. Hinter<br />
mir hörte ich: "Ist das nicht Lückes neuer Lehrling?"<br />
Der Gaul ging zielstrebig mit mir immer weiter, kein Halt, kein Mut abzusteigen, ich hatte nur die<br />
Mähne, um mich daran festzuhalten. Ich konnte nichts tun, ich musste alles mit mir geschehen lassen.<br />
Wir, das Pferd mit mir, bogen in ein Dorf ein, durchs Dorf. Zum Glück war die Dorfstraße nicht sehr<br />
belebt! Am Ausgang der kleinen Gemeinde bog der Gaul mit mir, der inzwischen<br />
"Schweißgebadeten“, in ein Hoftor ein. Der Bauer kam aus dem Haus, nahm mich in Empfang: "Da<br />
kommt ja unser Fritz." Er half mir vom Pferd und sagte seinem fünfzehnjährigen Sohn, er brauche nun<br />
nicht mehr zur Weide, da Fritz schon hier sei mit einer Amazone. Nachdem ich alles erklärt hatte, bat<br />
man mich zur Kaffeetafel. Alle waren amüsiert, ich war umso betretener. Nein, meinem Chef wollten<br />
sie nichts erzählen, so versprach man mir. Es war aber noch ein dicker Herr mit Soutane zu Gast. Und<br />
er, der Schwarze, der Katholische, hat wohl …
Walter Steiner<br />
Aufbruch und Ernüchterung<br />
Aufgewachsen bin ich in dem kleinen Dorf am Übergang von den Bergen des Thüringer Waldes zur<br />
Linder Ebene, wo es sich einen Kilometer lang an der Steinach hinzieht. Verbrachte ich ein<strong>mal</strong> einige<br />
Tage anderswo, und war es auch nur einige Kilometer entfernt, dann befiel mich eine heftige<br />
Sehnsucht. Nirgends fand ich es so schön wie zuhause. Der Tag der Heimkehr von einer Reise wurde<br />
für mich jeweils der schönste Tag meines Lebens.<br />
In meiner Erinnerung sehe ich mich als fünfjährigen Buben durch das Dorf laufen, auf der<br />
geschotterten und mit vielen Schlaglöchern versehenen Straße immer am Rand, an den Zäunen<br />
entlang. Die Beschaffenheit der Straße, die Löcher in den Zäunen, die Bepflanzung der Gärten und die<br />
Standorte der Blumen waren mir so vertraut, dass mir jede Veränderung sofort auffiel. Mein Blick<br />
richtete sich nach unten, entdeckte dort einen Mikrokosmos, eine in sich geschlossene kleine Welt, die<br />
mir ans Herz wuchs und deren Veränderungen im Jahresablauf vom keimenden Grün im Frühjahr über<br />
den Staub des Sommers bis zu dem Eis auf den Pfützen im Winter ich ganz intensiv miterlebte, was<br />
mich mit einem tiefen Glücksgefühl erfüllte.<br />
Dieses Gefühl besonderer Vertrautheit mit jedem Grashalm und jedem Baum am Wegrand habe ich an<br />
keinem Ort, wo ich später wohnte, je wiedererlebt. Die späteren Wohnsitze erschlossen sich mir als<br />
Makrokosmos, waren nicht verknüpft mit jenem mikrokosmischen Heimatgefühl. Mit 16 Jahren habe<br />
ich die Heimat verlassen. Krieg, Gefangenschaft, Studium, Haft, mehr<strong>mal</strong>iger Umzug über Hunderte<br />
von Kilometern hinweg haben mich zum Vagabunden gemacht. Eigentlich müsste doch jetzt das<br />
Sonneberger Land aus der Kindheit und Jugendzeit der ruhende Pol sein, zu dem es mich sehnsüchtig<br />
zurückzieht? Doch ich fühle keine Sehnsucht mehr, nichts zieht mich zurück in die alte Heimat. Ich<br />
bin heimatlos geworden. …<br />
*<br />
*<br />
*<br />
Dieser Kreis um Gustav festigte sich. Das Zusammengehörigkeitsgefühl blieb erhalten, auch wenn es<br />
einzelne von uns zwischendurch woandershin verschlug. Am Ende kamen wir alle wieder in Jena<br />
zusammen.<br />
Wir waren jugendliche Heißsporne, die die Welt reformieren wollten. Gedanken an raffiniertes<br />
Taktieren und Hinter-dem-Berg-halten mit persönlichen Überzeugungen und Absichten waren uns<br />
fremd. Wir glaubten an unsere Ideen und wollten diese unter die Menschen bringen, um ihnen zum<br />
Durchbruch zu verhelfen. Auf Versammlungen politischer Organisationen oder bei studentischen<br />
Veranstaltungen nahmen wir kein Blatt vor den Mund und legten unsere Vorstellungen einer<br />
Entwicklung zum demokratischen Sozialismus dar.<br />
Ursprünglich befanden wir uns dabei in Übereinstimmung mit den Zielen der Besatzungsmacht und<br />
der sozialistischen Bewegung in der SBZ. Doch dann kamen wir immer stärker in Widerspruch zur<br />
Parteilinie, die einen Schwenk vom anfänglich propagierten deutschen Weg zum Sozialismus hin zum<br />
allein gültigen sowjetischen Weg über die Diktatur des Proletariats mit all den negativen<br />
Nebenerscheinungen, wie man sie von der Sowjetunion her kannte, vollzog. Wir erkannten, dass der<br />
Konflikt zwischen demokratischer Augenwischerei und diktatorischem Machtstreben der<br />
Kommunisten nicht mehr mit demokratischen Mitteln gelöst werden konnte. Deshalb distanzierten wir<br />
uns schließlich von der Partei, der SED.<br />
Das Studium verlief ansonsten glatt für mich. Als selbstverständlich nahm ich hin, dass ich im Herbst<br />
1946 sofort einen Studienplatz erhielt, schließlich war ich ja "proletarischer" Herkunft und in keiner<br />
Weise braun belastet. Trotz Kriegseinsatz und Gefangenschaft habe ich die Schule regulär mit 18<br />
Jahren abgeschlossen. Mit 22 Jahren würde ich fertiger Studienassessor für Englisch und Russisch<br />
sein. Nach meiner Landarbeiterperspektive in der Gefangenschaft schien mir dies fast des Guten<br />
zuviel. Wenn da bloß nichts dazwischenkam!<br />
Und es kam etwas dazwischen. Da Gustav und die acht Freunde ab Sommer 1948 nach und nach aus<br />
der SED ausgetreten waren, was u.a. dazu führte, dass allen sofort das Stipendium gestrichen wurde,<br />
wurden alle unsere Aktivitäten von SED und NKWD sorgfältig beobachtet.<br />
Im Februar und März 1949 war es dann soweit. Einer nach dem anderen wurde verhaftet. Heinz und<br />
ich waren die letzten. Wir trafen uns noch Anfang März zuhause und berieten, was wir tun sollten. Wir
hätten ohne große Schwierigkeiten über die Grenze nach Westdeutschland gehen und dort Aufnahme<br />
bei Verwandten finden können. Leicht würde es nicht sein, sich allein und mittellos durchzuschlagen.<br />
In der Abwägung der Schwierigkeiten im Westen mit der Gefahr der Verhaftung im Osten,<br />
entschieden wir uns zu bleiben. Denn was hatten wir schon getan? Wir hatten Gebrauch von den von<br />
Besatzungsmacht und herrschender Partei propagierten demokratischen Rechten auf Gedanken- und<br />
Redefreiheit gemacht. Sicherlich musste man unsere verhafteten Freunde wieder frei lassen. Es lag<br />
doch keinerlei kriminelles Belastungsmaterial vor. So einfältig waren wir noch zu jener Zeit. Im<br />
Nachhinein konnten wir uns selber nicht mehr verstehen.<br />
Am 8. März 1949 wurden Heinz und ich verhaftet und nach einer Nacht im Keller der IHK Sonneberg,<br />
dem Sitz der sowjetischen Kommandantur, ins Untersuchungsgefängnis Weimar gebracht. Ich fühlte<br />
mich wie in einem schlechten Traum und hoffte, dass ich bald aufwachen würde, um festzustellen,<br />
dass alles nicht Wirklichkeit war. Bis dann eine Tür hinter mir zuschlug und ich in einem kleinen<br />
sch<strong>mal</strong>en Raum stand. Wie durch Nebel sah ich zwei Augenpaare auf mich gerichtet. 'Was wollen die<br />
von dir' war mein erster Gedanke. Dann entdeckte ich, dass beide kahlgeschoren und ihre Kleidung<br />
ziemlich zerlumpt war. Ob die mich fertig machen sollten? Ich stand lange unbeweglich neben der<br />
Tür, bis einer der beiden mich ansprach: "Du kannst dich auf den Kübel setzen. Erhol' dich erst <strong>mal</strong>.<br />
Vor uns brauchst du keine Angst zu haben. Wir sind genauso arme Würstchen wie du. Ich heiße Ernst<br />
und das ist Gerhard." Ganz benommen setzte ich mich und stellte fest, dass außer dem Kübel und<br />
einigen Strohsäcken am Boden kein Möbelstück in der Zelle war. Das Halbdunkel kam von der<br />
Blende, die den Kontakt mit der Außenwelt verhindern sollte. Ernst wandte sich wieder an mich: "Du<br />
brauchst uns nicht zu erzählen, warum du verhaftet wurdest. Du bist hier in Untersuchungshaft. Nachts<br />
wirst du zum Verhör geholt, dann wollen die Russen alles von dir wissen. Je weniger aber wir von<br />
dem wissen, was man dir vorwirft, umso besser ist es für uns alle. Manch<strong>mal</strong> setzen die Russen auch<br />
Spitzel in die Zelle, die dich aushorchen sollen. Sei also vorsichtig!" Das klang vernünftig, und Ernst<br />
wurde mir gleich sympathisch. Der Druck wich von mir und ich realisierte: 'Das ist kein Traum. Jetzt<br />
stehen dir harte Jahre bevor'.<br />
Die beiden Kollegen führten mich einfühlsam in das Knastdasein ein, informierten mich über die<br />
Dinge des Alltags, angefangen beim Verhalten der einzelnen Wachposten bis zur Weitergabe von<br />
Kassibern beim morgendlichen Kübelleeren und berichteten auch von ihren Erfahrungen bei den<br />
Verhören. Das machte die schwere Zeit einigermaßen erträglich. Gerhard war lungenkrank und sehr<br />
schweigsam. Er dichtete. Abends trug er uns manch<strong>mal</strong> seine Gedichte vor, die er im Gedächtnis<br />
gespeichert hatte. Eines hat mich besonders beeindruckt:<br />
Durch das Fenster meines Kerkers<br />
seh' ich Wolken und ein halbes Dach<br />
bis zum Rande eines Erkers.<br />
Sonne kenn' ich nur dem Schatten nach<br />
an dem Schornstein gegenüber,<br />
woran die Stunden ich erkennen kann.<br />
Täglich wird der Himmel trüber,<br />
schöner Sommer ist umsonst vertan.<br />
Ernst war heiter, immer guter Laune. Er redete viel, wohl auch, um seine depressiven Anwandlungen<br />
zu vertreiben. Seine detaillierten Erzählungen vom Verhalten der Vernehmungsoffiziere haben mir bei<br />
meinen eigenen Vernehmungen manchen Schock erspart, da ich in etwa wusste, was auf mich<br />
zukommen würde. Die Verhöre waren nachts. Nach Mitternacht wurde man aus dem Schlaf gerissen,<br />
schlaftrunken wurde man mit Fragen überschüttet, angeschrieen, eingeschüchtert und in vielen Fällen<br />
auch körperlich misshandelt. Danach saß man stundenlang auf einem Hocker ohne Lehne, wurde<br />
nichts mehr gefragt, nur von grellen Scheinwerfern angestrahlt. Und dann begann dasselbe Spiel von<br />
vorn, noch ein<strong>mal</strong> dieselben Fragen, solange bis die Vernehmungsoffiziere Widersprüche entdeckten<br />
oder überhaupt eine Aussage erhielten.<br />
Ich persönlich wurde nie geschlagen oder misshandelt. Bei uns lagen komplette Spitzelberichte<br />
darüber vor, was wir getan oder gesagt haben. Die allgemeine Knasterfahrung lehrte uns, dass es<br />
sinnlos ist, etwas abzustreiten, was als Faktum vorlag. Schwieg ein Beschuldigter, dann griffen die<br />
Vernehmer zu härteren Methoden und misshandelten ihn so lange, bis sie ein Geständnis<br />
herausgeprügelt hatten. Dabei spielte keine Rolle, ob das Geständnis den Tatsachen entsprach. Die
Vernehmungsoffiziere mussten wie alle Arbeiter im sozialistischen System ihre Leistungsvorgaben<br />
und Normen erfüllen. Das bedeutete in ihrem Fall, in einer bestimmten Zeit soundsoviele Häftlinge zu<br />
überführen. Nach meiner Schätzung war mehr als die Hälfte der Häftlinge unschuldig. Sie waren nur<br />
aufgrund von Denunziationen eingesperrt worden. Sie wurden alle verurteilt, auch wenn sie bis zum<br />
Schluss standhaft blieben und nichts zugaben. Die beschuldigende Aussage eines fremden Menschen<br />
reichte aus zur Verurteilung.<br />
Hatten die Russen das Geständnis, dann wurden sie freundlich, spendierten warmes Essen oder<br />
Zigaretten und schrieben derweilen das Protokoll in Schönschrift.<br />
Mein Russisch war zwar nicht das beste, aber zum Zeitung lesen reichte es. Mithäftlinge, die das<br />
wussten, schleusten mich in das Küchenarbeitskommando. Der Koch brachte täglich eine Zeitung mit<br />
zum Dienst, und die lag dann irgendwo herum, sobald er sie gelesen hatte. Statt Kartoffeln zu schälen,<br />
musste ich mich dann hinter einem Kessel verkriechen und die für uns interessanten Artikel übersetzen<br />
und vorlesen. Die wichtigste Meldung in dieser Zeit war das Scheitern der Berliner Blockade – für uns<br />
alle ein Hoffnungszeichen auf baldige Freilassung.<br />
Unsere Gerichtsverhandlung war ein Kasperletheater, das weder das Tribunal, bestehend aus Richtern<br />
und Staatsanwalt, noch die neun Angeklagten sonderlich ernst nahmen. Verteidiger und Zeugen waren<br />
nicht zugelassen. Der vorliegende Sachverhalt der politischen Meinungsbildung und Diskussion in<br />
einer Gruppe von Freunden, die ihre Meinung in der Öffentlichkeit vertraten und Austausch mit<br />
demokratischen Parteien und Persönlichkeiten in Westdeutschland und im Ausland pflegten, wurde<br />
nach § 58 des sowjetischen Strafgesetzbuches als illegale Gruppenbildung, antisowjetische<br />
Propaganda und Spionage interpretiert und mit zwei <strong>mal</strong> 25 und ein<strong>mal</strong> zehn Jahren<br />
Zwangsarbeitslager, zusammengezogen auf 25 Jahre, bestraft. Die Angeklagten hatten ein letztes<br />
Wort, das sich die Richter nicht nur höflich lächelnd, sondern auch hier und da erstaunt aufschauend<br />
anhörten, so als ob sie zum ersten Mal etwas von unserer politischen Motivation mitbekämen:<br />
"Interessant aber nix gut für Sozialismus in Sowjetunion".<br />
Nach der Verhandlung kamen wir alle in die Verurteiltenzelle. Da saßen schon über 20 Leute. Viele<br />
kannte man schon über die internen Informationskanäle als "Fälle" oder dem Namen nach. Auch wir<br />
neun Freunde hatten uns viel zu erzählen. Gott sei Dank musste sich keiner den Vorwurf machen,<br />
einen Kollegen durch Falschaussagen belastet zu haben. Wir waren in einer übermütigen<br />
Stimmungslage und als der nächste Abgeurteilte in die Sammelzelle kam und tränenüberströmt sagte,<br />
er sei zu zehn Jahren Zwangsarbeit verurteilt, haben wir ihn regelrecht ausgelacht und ihm gesagt:<br />
"Als Minderbestrafter hast du in diesem Raum eigentlich gar nichts zu suchen. Hier sitzen nur Leute<br />
mit anständigen 25 Jahren."<br />
Wenige Tage später wurden wir mit der grünen Minna nach Bautzen transportiert. Hatten wir bisher<br />
die Welt nur mit einem Blick nach oben zum Schatten des Schornsteins erhascht, so konnten wir aus<br />
dem Auto durch einen Luftschlitz an der hinteren Tür nur einen Blick nach unten werfen. Wir<br />
erblickten staubige Straßen und grüne Wegränder, ab und zu Beine und Fahrräder. Die Frauen trugen<br />
keine Strümpfe, es war Frühling. Der freie Blick auf die Welt war uns verschlossen, und ein Gefühl<br />
tiefster Isolierung überkam mich.<br />
Bei der Ankunft in Bautzen war ich sehr deprimiert. Der gepflegte Vorhof des "gelben Elends" mit der<br />
Kirche mutete mich an wie ein Krematorium. Wir wurden "dawai, dawai" gleich in die Kellerräume<br />
getrieben, wo wir geschoren und entlaust wurden und duschen konnten. Die Frisöre waren Häftlinge,<br />
die neugierig fragten: "Wie heißt du? Wo kommst du her? Was gibt es Neues in der Welt?" "So,<br />
Steiner heißt du. Bist du vielleicht mit dem Erich verwandt, der vor einigen Monaten hier verstorben<br />
ist?" Das saß. Erich war mein Vetter. Er war Ende 1945 wegen angeblicher Werwolftätigkeit<br />
zusammen mit 70 Männern und Jungs aus unserer näheren Heimat verhaftet worden. Wir haben<br />
seitdem nie wieder etwas von ihm gehört. Ich saß regungslos auf dem Frisörschemel und schaute<br />
hinaus in den von hohen Mauern umgebenen Innenhof, hinter dem ein großes Gebäude mit einem<br />
massigen, mächtig qualmenden Schornstein hervorragte. Ich wurde den Eindruck eines Krematoriums<br />
nicht los.<br />
Das Zuchthaus Bautzen …<br />
*<br />
*<br />
*
Gerhard Schröter<br />
Fluchthilfe<br />
Unsere gemeinsame Schulzeit mit all den Freuden und Leiden eines Schülers darzustellen, will ich mir<br />
ersparen, weil einige von euch das gewiss in ihrer Vita schon ausführlich beschrieben haben.<br />
Nach dem Abitur machte ich mich im Winter 46/47 aus der ungastlich gewordenen SBZ in Richtung<br />
Westen davon. Dieser Weggang sollte natürlich kein endgültiger sein, denn meine Familie mit Eltern,<br />
Großmutter und Schwestern waren Sonneberger und damit Heimat für mich geblieben. Nach<br />
zweijähriger Praktikantenzeit im hessischen Assenheim und dem Vorexamen in Darmstadt nahm ich<br />
im oberfränkischen Bamberg das Studium der Pharmazie auf. Aber immer wieder zog es mich zur<br />
nahen Grenze hin. Sie zu überwinden, wurde mit fortschreitender Zeit gefahrvoller. Für die russische<br />
Kommandantur war der Student Gerhard Schröter bald kein unbeschriebenes Blatt mehr; immer<br />
wieder erwischte mich die Grenzpolizei, sperrte mich über Nacht in einen nicht gerade komfortabel<br />
eingerichteten Keller ein und zerrte mich zum Verhör durch einen sowjetischen Offizier. Nach der<br />
Abschiebung über die Grenze nach Neustadt glückte dann häufig der nächste Versuch, denn mit jedem<br />
missglückten Übergang gewann ich Erfahrung, den Grenzern ein Schnippchen zu schlagen.<br />
Schließlich wählte ich, aus heutiger Sicht vielleicht mehr aus jugendlichem Leichtsinn denn aus<br />
heldenhaftem Wagemut, eine einfache wie gefährliche Taktik. Mit einem geliehenen Rechen auf dem<br />
Buckel marschierte ich als Landarbeiter verkleidet bei helllichtem Tag über Wiesen und Felder, stellte<br />
beim Bauern Münch in der Müß mein Gerät ab und hatte es dann nicht mehr weit bis zur Stadt und zu<br />
meiner "großen Liebe", die später meine Frau wurde.<br />
Im Winter glitt ich bei ausreichender Schneelage mit Skiern rasch über die Grenzzone, dies allerdings<br />
nur bei Nacht. Es ist verständlich, dass die gefahrvollen Unternehmungen meine Sonneberger stets in<br />
Aufregung versetzten. Aber auch bei der Westpolizei erregten die häufigen Abschiebungen durch die<br />
russische Besatzungsmacht allmählich den Verdacht, vom Osten als Spion auf westliche<br />
Erkundigungen geschickt zu werden.<br />
Im Jahre 1948 wurden meine Eltern ihrer Existenz beraubt, die Adler-Apotheke wurde enteignet, und<br />
zwei Jahre später verstarb mein Vater im Alter von erst 58 Jahren.<br />
Da an der Universität Bamberg mein Fachstudium nur für die beiden Erstsemester möglich war,<br />
wechselte ich nach Frankfurt und übernahm dort Vertretungen, zu denen ich nach dem Vorexamen<br />
berechtigt war. Einen Studienplatz erhielt ich in Mainz, wo ich 1956 das Pharmazieexamen ablegte.<br />
1953 war ich mit Ruth in den Hafen der Ehe eingelaufen; mit ihr lebe ich noch heute glücklich<br />
zusammen.<br />
1960 verschlug mich das Schicksal nach Wissen, einem Städtchen von ca. 10.000 Einwohnern am<br />
Rande des Westerwaldes. Dort richteten wir eine Apotheke ein und betrieben sie 27 Jahre lang. Nach<br />
dem Verkauf zogen wir uns in unser Eigenheim und unser "Privatleben" zurück. Meine Hobbies,<br />
Basteln und Fliegen, lassen den Tag nicht lang werden.<br />
Es war ein unbeschreibliches Gefühl, als ich kürzlich zum ersten Male das heimatliche Sonneberg aus<br />
luftiger Höhe in Augenschein nehmen konnte; noch vor wenigen Jahren hätte man davon nur träumen<br />
können.<br />
Ein persönliches Ereignis, das die Tragik der Spaltung unseres Vaterlandes noch ein<strong>mal</strong> wachruft,<br />
möchte ich nicht der Vergessenheit anheim fallen lassen.<br />
Es war Herbst 1966. Meine in Sonneberg lebende Schwester Ursula suchte dringend um ein<br />
schnellstmögliches Treffen in Berlin nach. Gemeinsam mit meiner inzwischen in Frankfurt lebenden<br />
jüngsten Schwester buchten wir umgehend einen Flug nach Tempelhof. Wenig später saßen wir uns,<br />
mit einem Tagesvisum in der Tasche, in einer Ostberliner Gaststätte gegenüber: Schwester Ursula mit<br />
Mann und wir, die Westler. Unsicherheit und Angst spiegelten sich in ihren Augen wieder, als sie uns<br />
im Flüsterton ihren Plan zur Flucht aus der DDR offenbarten. Da unsere Mutter in Sonneberg<br />
zurückbleiben musste, erbaten sie unsere Zustimmung für ein Unternehmen, das beim Scheitern 10<br />
Jahre Zuchthaus einbringen konnte.<br />
Ein in Oberlind ansässiger, befreundeter Arzt hatte seit langem einen Plan für die Flucht nach dem<br />
Westen entworfen. Unter dem Vorwand, an einem entfernten Ort in der DDR eine andere Stelle mit<br />
eingerichteter Wohnung übernehmen zu wollen, verkaufte er Auto und Möbel. In dem im Sperrgebiet<br />
unmittelbar an der Grenze liegenden Ort Liebau hielt er wöchentlich ein<strong>mal</strong> Sprechstunde ab. So<br />
konnte er mit Sonderausweis bis auf Rufweite an den Grenzzaun heranfahren.
Eine Woche vor dem ins Auge gefassten Termin weihte er nach einem gemeinsam verbrachten feuchtfröhlichen<br />
Abend meine Schwester und meinen Schwager in seinen Plan ein und bot ihnen an, die<br />
Sache gemeinsam zu machen. Zunächst Schrecken und Ratlosigkeit! Aber dann gewann die<br />
Überzeugung Oberhand, wenn nicht jetzt, dann nie, und sie willigten ein, den gefährlichen Weg der<br />
Flucht in die Freiheit zu wagen. Überlegungen, wertvolle Gegenstände aus der Wohnung in Sicherheit<br />
zu bringen, wurden verworfen. Dies hätte das Unternehmen verraten und unsere Mutter in große<br />
Gefahr bringen können.<br />
Wir im Westen wollten das Unsrige tun, bei der Aktion behilflich zu sein, soweit das überhaupt<br />
möglich erschien. Da gerade meine Sonneberger Schwiegereltern bei uns zu Besuch waren, wurde<br />
nicht ein<strong>mal</strong> meine Frau informiert. Um sie nicht in Angst zu versetzen, gab ich vor, mit meinem<br />
Frankfurter Schwager wegen eines unaufschiebbaren Geschäfts in die Schweiz reisen zu müssen.<br />
Indessen fuhren wir gemeinsam nach Fürth am Berg. Dort weihten wir die Beamten des<br />
Bundesgrenzschutzes in den Fluchtplan der Sonneberger ein. Die Wachen wurden daraufhin in<br />
verstärkte Alarmbereitschaft versetzt, der Sprechfunkverkehr der Grenzstellen, der auf der anderen<br />
Seite mitgehört wurde, eingestellt; um keinen Verdacht aufkommen zu lassen, wurden die<br />
Anweisungen der westlichen Posten durch Kurier überbracht.<br />
Was hatte sich inzwischen auf der Ostseite getan?<br />
Der Wagen meines Sonneberger Schwagers wurde mit dem Schild "Fahrbereitschaft" getarnt, die<br />
beiden Frauen, die achtjährige Nichte und das 9 Monate alte Baby des Arztes wurden unter den<br />
Rücksitzen versteckt und das Baby mit Medikamenten ruhiggestellt. So wurde die erste Kontrolle<br />
glücklich überwunden; der Arzt hielt die in Liebau übliche Sprechstunde, während die Frauen und<br />
Kinder im nahegelegenen Pfarrhaus eine Kaffeepause einlegten. Leichter Nebel überzog die<br />
herbstlichen Wiesen, als der schwierigste Teil der Flucht begann.<br />
Wir waren bei Einbruch der Dämmerung bei ausgeschaltetem Licht an die Grenze herangefahren,<br />
konnten auf der anderen Seite deutlich die beleuchteten Fenster von Liebau in Augenschein nehmen<br />
und harrten mit Anspannung und nervenverzehrender Unruhe der Dinge, die nun kommen sollten. Da<br />
entdeckten wir jenseits des Zaunes ein Auto; die Scheinwerfer erloschen; dies war das endgültige<br />
Signal zum letzten Aufbruch. Die Sonneberger rannten und robbten im wahrsten Sinne um ihr Leben.<br />
Wir hörten das Wimmern des Babys, das, in eine Decke eingepackt, nicht wissen konnte, was mit ihm<br />
geschah. Wir hörten auch das Klicken der Drahtschere und waren sicher, dass alles nach Plan verlief.<br />
Als wir nun in die Dunkelheit das befreiende "Hierher"! hinausschrieen, hielten die Sonneberger in<br />
ihrer Aufregung dies für das "Halt"! der Vopos und durchlebten für Sekunden die Schrecken der<br />
geschnappten "Grenzverletzer". Aber dann lagen wir uns glücklich in den Armen.<br />
Der Patrouille der NVA blieb der Wagen meines Schwagers nicht verborgen und schon um 22 Uhr<br />
klingelte die Polizei an der Wohnungstüre meiner Mutter. Zum Verhör wurde sie dann am folgenden<br />
Morgen abgeholt. Noch am gleichen Tag fuhr sie zur Behandlung in die Augenklinik nach Erfurt und<br />
war zunächst für einige Tage weiteren Schikanen entzogen.<br />
Nach ihrer Rückkehr nach Sonneberg fand sie die Wohnung meiner Schwester ausgeräumt; der<br />
gesamte Hausrat war versteigert. Manches wertvolle Erinnerungsstück war verschwunden oder im<br />
Haushalt von Mitbewohnern "untergetaucht".<br />
1969 durfte meine Mutter in den Westen ausreisen und verlebte die ihr noch bleibenden Lebensjahre<br />
im Taunus.<br />
Jetzt wird die Fassade meines Elternhauses wieder instand gesetzt. Wenn ich nun, mich um den<br />
Fortgang der Arbeit kümmernd, des Öfteren vorbeischaue, steigen die Erinnerungen auf an Kontrollen<br />
und Demütigungen, an Leid aber auch an Freude, die mich mit meiner Heimatstadt Sonneberg<br />
verbinden.