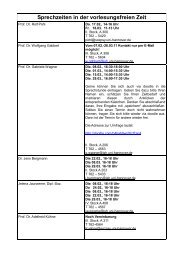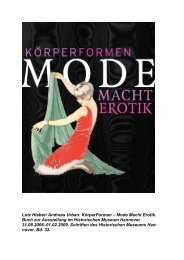Joachim Söder-Mahlmann - Institut für Soziologie
Joachim Söder-Mahlmann - Institut für Soziologie
Joachim Söder-Mahlmann - Institut für Soziologie
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Joachim</strong> <strong>Söder</strong>-<strong>Mahlmann</strong><br />
Soziale Tatsachen und<br />
kollektive Vorstellungen<br />
Zur <strong>Soziologie</strong> des Tauschs<br />
und der Erkenntnis
»So viele Dinge werden geglaubt, nur weil irgendwer sie behauptet.«<br />
(James Aubrey)
Von der Philosophischen Fakultät der Universität Hannover im November<br />
2005 angenommene Habilitationsschrift.
Inhalt<br />
VORWORT .......................................................................................... v<br />
EINLEITUNG ....................................................................................... 1<br />
ERSTER TEIL: DER WERT DER DINGE<br />
1. Kapitel: DAS UNIVERSUM DER GABEN ................................................. 17<br />
Gleichheit und Gegenseitigkeit: Teilen ............................................................. 19<br />
Tausch und Besitz....................................................................................... 22<br />
Verwandtschaft und Verpflichtung .................................................................. 24<br />
Muscheln und Kanus: Der Kula-Wettstreit ........................................................ 28<br />
"Primitiver Handel" ................................................................................... 34<br />
2. Kapitel: VERZICHT UND BEGEHREN .................................................... 42<br />
Norm versus Interesse ................................................................................. 42<br />
Der Geist der gegebenen Sache ...................................................................... 50<br />
Zwang und Tabu ........................................................................................ 54<br />
Das soziale Band ........................................................................................ 61<br />
3. Kapitel: DIE SOZIALE ALS KLASSIFIKATORISCHE ORDNUNG .................... 66<br />
Die Regel der Regeln ................................................................................... 67<br />
Der Wert der Zeichen .................................................................................. 71<br />
Notwendige Beziehungen .............................................................................. 77<br />
Natur und Kultur ........................................................................................ 80<br />
4. Kapitel: GLEICHE UND UNGLEICHE .................................................... 85<br />
Rivalität und Zerstörung: der Potlatch ............................................................. 86<br />
Der Wettstreit der Bigmen ........................................................................... 89<br />
Feindschaft und Ehre ................................................................................... 93<br />
Hierarchie und Umverteilung ........................................................................ 95<br />
Yams und Getreide ..................................................................................... 99<br />
Schichtung und Arbeitsteilung ...................................................................... 102<br />
5. Kapitel: TAUSCH UND EIGENINTERESSE ............................................ 109<br />
Der Wert der Vaygu'a ................................................................................ 110<br />
Norm vs. Interesse revisited ......................................................................... 117<br />
Ursprungsmythen ..................................................................................... 122<br />
6. Kapitel: DIE DINGE DES LEBENS ....................................................... 130<br />
Güter und Werte ...................................................................................... 131<br />
"Survival of the fittest" ............................................................................... 137<br />
Mangel und Bedürftigkeit ............................................................................ 141<br />
Güter– und Bedürfnisproduktion................................................................... 144<br />
Konkurrenz und Distinktion......................................................................... 148<br />
"Gemeinschaft" und Gesellschaft ................................................................... 152<br />
Zwischenresümee ..................................................................................... 161
ZWEITER TEIL: WISSEN UND GEWISSHEIT<br />
7. Kapitel: DIE EVIDENZEN DES FORTSCHRITTS ....................................... 165<br />
Das Segelschiff als Zeitmaschine .................................................................... 166<br />
Die Bürde des weissen Mannes ..................................................................... 168<br />
Das Magische Universum ............................................................................ 173<br />
Magie, Religion und Wissenschaft .................................................................. 178<br />
8. Kapitel: DAS LICHT DER VERNUNFT ................................................. 185<br />
Vernunft und Unvernunft ............................................................................ 185<br />
"Traditionales" und wissenschaftliches Denken .................................................. 187<br />
Wirkung versus Bedeutung? ......................................................................... 191<br />
Die gesellschaftliche Funktion der Magie ......................................................... 199<br />
9. Kapitel: WIRKSAMKEIT UND WIRKLICHKEIT ..................................... 204<br />
Differenz und Differenzierung ...................................................................... 204<br />
Jeder ist in seiner eigenen Welt? ................................................................... 211<br />
Die elementaren Formen der Erkenntnis ......................................................... 213<br />
Wie wirklich ist die Welt? ........................................................................... 221<br />
Magie und Wissenschaft revisited .................................................................... 226<br />
10. Kapitel: DIE SITTEN FREMDER VÖLKER ........................................... 232<br />
Moral und Klassifikation ............................................................................. 233<br />
Geschichte als Reifungsprozess? .................................................................... 237<br />
Kinder, Wilde, Zivilisierte .......................................................................... 240<br />
"Where unknown, there place monsters" ........................................................ 243<br />
Sublime Torheit der Hoffnung? ..................................................................... 249<br />
SCHLUSS ......................................................................................... 252<br />
LITERATUR .................................................................................... 256
VORWORT<br />
Seit den Tagen von Bronislaw Malinowski und Marcel Mauss, genauer gesagt den<br />
zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, sind die ökonomischen Beziehungen in<br />
den sogenannten "primitiven" Gesellschaften, namentlich der dort praktizierte Gabentausch,<br />
Gegenstand des wissenschaftlichen Interesses. Ein trotz gewisser Konjunkturen<br />
allerdings insgesamt eher randständiger Gegenstand, der entweder dem<br />
Bereich des Exotischen und Anekdotischen anzugehören und somit nur <strong>für</strong> den engeren<br />
Bereich der Ethnologie von Interesse zu sein schien, oder dessen Spezifika (gerade<br />
im Hinblick auf die vergesellschaftende Funktion des Tauschs) allzu schnell in einem<br />
umfassenderen und zum Teil hochabstrakten Diskurs aufgelöst wurden. Obwohl<br />
namhafte Autoren sich dem Thema widmeten und sowohl Karl Polanyi als auch<br />
Marshall Sahlins Versuche zur Systematisierung der Tauschformen unternahmen ist<br />
der Gegenstand aus soziologischer Perspektive noch unzureichend ausgeschöpft, eine<br />
umfassende vergleichende Untersuchung der in unterschiedlichen Gesellschaften<br />
praktizierten Formen des Austauschs von Gütern und Dienstleistungen liegt bis zum<br />
heutigen Tage nicht vor. Das ist insofern erstaunlich, als daß Tauschbeziehungen soziale<br />
Beziehungen schlechthin sind und die Behauptung, Gesellschaft realisiere sich<br />
im Tausch, einiges <strong>für</strong> sich hat.<br />
Bezogen auf die Glaubensanschauungen bzw. Weltauffassungen, denen die<br />
Angehörigen einer Gesellschaft anhängen, stellt sich der Sachverhalt etwas anders<br />
dar. Zwar wurde dieser Komplex bereits im Zeitalter der Aufklärung diskutiert, die<br />
neuere wissenschaftliche Auseinandersetzung nahm ihren Ausgang aber primär in<br />
den großen, den ganzen Erdball und die gesamte Menschheitsgeschichte umfassenden<br />
Synthesen der Anthropologie des späten 19. Jahrhunderts, namentlich der<br />
Werke James G. Frazers, welcher die systematischen Differenzen zwischen den Kulturen<br />
mittels der Konstruktion einer evolutionären historischen Abfolge von Magie,<br />
Religion und Wissenschaft erklären wollte. Die Diskussion darüber, in welcher Beziehung<br />
das Denken (und mithin Handeln) der vermeintlichen "Wilden" oder "Barbaren"<br />
zur Weltsicht moderner Industriegesellschaften steht und ob es einen privilegierten<br />
universellen Standpunkt gibt, von dem aus dieses Denken bewertet werden<br />
kann, hatte einen Höhepunkt in der vor allem im angelsächsischen Raum in den 60er<br />
und 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts geführten "Rationalitätsdebatte". Obwohl<br />
diese zu keinem schlüssigen Ergebnis geführt hatte und der Problembereich noch<br />
längst nicht erschöpfend ausgeleuchtet war, versandete die Diskussion in den 80er<br />
Jahren zunehmend. In neueren Beiträgen aus dem Bereich der Ethnologie finden sich<br />
kaum Spuren dieser Debatte, während die Wissenssoziologie andere Schwerpunkte<br />
setzt. Eine zeitgemäße Darstellung der Differenzen zwischen unterschiedlichen<br />
Weltauffassungen aus explizit soziologischer Perspektive steht somit derzeit ebenfalls<br />
noch aus.<br />
Damit sind sowohl die Gegenstände der vorliegenden Arbeit benannt als auch die<br />
Leerstellen, die sie schließen soll. Um sogleich mögliche Mißverständnisse zu vermeiden,<br />
will ich bereits an dieser Stelle betonen, daß es mir keineswegs zwingend
Vorwort vi<br />
notwendig erscheint, die beiden Gegenstandsbereiche in einer einzelnen Studie zusammenzuführen;<br />
ich hielt es lediglich <strong>für</strong> sinnvoll, da ich beide unter einem ähnlichen<br />
Blickwinkel betrachte und die Argumente wechselseitig aufeinander beziehe.<br />
Marktökonomie bzw. Geldwirtschaft und wissenschaftliche Weltauffassung scheinen<br />
zwar die Fundamente zu bilden, auf denen die modernen westlichen Demokratien<br />
ruhen (sie sind nicht nur mögliche Ausprägung, sondern aus der Perspektive eben<br />
dieser Gesellschaften auch universelle Norm), ich bin aber nicht der Auffassung, daß<br />
ein ursächlicher (kausaler) Zusammenhang zwischen beiden existiert, wie ihn einige<br />
Autoren behauptet haben. Wenn eine Beziehung besteht, dann ist sie historischer<br />
und mithin sehr spezifischer, aber nicht systematischer oder formaler Natur.<br />
Meine Absicht ist zunächst, die genannten Themenfelder aktuellen Debatten (wieder)<br />
zugänglich zu machen. Mit der vergleichenden Gegenüberstellung einerseits der<br />
unterschiedlichen Formen des Austauschs (Gabentausch, Redistribution, Marktaustausch)<br />
sowie andererseits von magischer, religiöser und wissenschaftlicher Weltsicht<br />
verfolge ich weiterhin das Ziel, mittels des wechselseitigen Bezugs der Gegenstandsbereiche<br />
und Diskurse die zentralen Differenzen zwischen den sog. "primitiven"<br />
bzw. "vormodernen" Gesellschaften und den "modernen" westlichen Industriegesellschaften<br />
herauszuarbeiten und darzustellen, wie <strong>Institut</strong>ionen und Intentionen<br />
sich durchdringen. Dies betrifft nicht allein die fremden und vergangenen Kulturen,<br />
sondern vor allem auch die Bedingtheiten und Konsequenzen der ökonomischen<br />
Ordnung in den "entwickelten" Gesellschaften, die gesellschaftliche Produktion von<br />
Interessen bzw. Bedürfnissen. Aus dieser Perspektive ist die beispiellose expansive<br />
Dynamik der "Weltwirtschaft" am vermeintlichen "Ende der Geschichte" nicht etwa<br />
das natürliche Ergebnis natürlicher Bedingungen, sondern Resultat einer spezifischen<br />
und durchaus kontingenten historischen Entwicklung. Gerade angesichts der in Zeiten<br />
des Neoliberalismus, der Soziobiologie und eines neuen Sozialdarwinismus weitverbreiteten<br />
Naturalisierung von <strong>Institut</strong>ionen und Bedürfnissen scheint mir dieser<br />
Punkt, auf welchen die vergleichende Untersuchung der in unterschiedlichen Gesellschaften<br />
praktizierten Tauschformen und ihrer Weltauffassungen hinausläuft, von<br />
zentraler Bedeutung <strong>für</strong> die heutige <strong>Soziologie</strong> zu sein.<br />
Ein solches Vorhaben erfordert zunächst die Rekonstruktion derjenigen Diskurslinien,<br />
an die angeknüpft werden soll. Es geht mir dabei nicht primär darum, die geistigen<br />
Wurzeln meiner Argumentation aufzuzeigen; die erneute Lektüre z.B. von<br />
"Klassikern" wie Émile Durkheim (dessen zentrale Qualitäten gerade im deutschen<br />
Sprachraum zu lange durch ein voreilig ausgesprochenes "Positivismus"–Verdikt<br />
weitgehend verkannt blieben) und Marcel Mauss hat keineswegs rein philologischen<br />
Wert, sondern führt über die Präzisierung und Weiterentwicklung dieser Ansätze zu<br />
durchaus originären Einsichten hinsichtlich des komplexen, über kollektive Vorstellungen<br />
vermittelten Verhältnisses von Strukturen und Akteuren.
vii Vorwort<br />
Die vorliegende Arbeit ist schließlich weniger Ergebnis einsamer Schreibtischarbeit<br />
als das Resultat meiner langjährigen Lehrtätigkeit am <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Soziologie</strong> der Universität<br />
Hannover und der damit verbundenen lebhaften und äußerst fruchtbaren<br />
Diskussionen. In diesem Zusammenhang danke ich insbesondere Alfred Krovoza,<br />
Stephan Trinkaus, Christine Schwarz, Helmut Heit, Siebo Siems, Eleonore von Oertzen,<br />
Marva und Peter Karrer, Wolfgang Gabbert und Alexa Stiller <strong>für</strong> Anregungen,<br />
Kritik und fruchtbare Diskussionen.
EINLEITUNG<br />
»Eine wuchernde, überreizte Zivilisation stört <strong>für</strong> immer die Stille<br />
der Meere. Eine Gärung von zweifelhaftem Geruch verdirbt die<br />
Düfte der Tropen und die Frische der Lebewesen, tötet unsere<br />
Wünsche und verurteilt uns dazu, halb verfaulte Erinnerungen zu<br />
sammeln.« (Claude Lévi-Strauss, Traurige Tropen)<br />
Gegenstand des ersten Teils dieser Arbeit sind die gesellschaftlichen Bedingtheiten<br />
und Konsequenzen unterschiedlicher Formen des Tauschs bzw. Austauschs. Der<br />
kurze Rückgriff auf eine alltägliche Episode scheint mir am besten geeignet, der Leserin<br />
und dem Leser diese Thematik nahezubringen: Vor geraumer Zeit zog ein<br />
Freund, den ich seit der Schulzeit kannte und mit dem mich, obwohl wir nicht die<br />
engsten und besten Freunde waren, dennoch einiges verband, innerhalb der Stadt<br />
um. Damals studierten wir beide, und es war üblich, bei einem Wohnungswechsel<br />
möglichst viele Freunde und Bekannte um ihre Mithilfe zu bitten. Ganz anders P.: Er<br />
wickelte seinen Umzug allein mit Hilfe eines einzelnen Kommilitonen ab. Nun sollte<br />
man meinen, daß seine Freunde ihm da<strong>für</strong> hätten dankbar sein sollen, schließlich hatte<br />
er uns Zeit und Mühe erspart. Die Reaktionen gingen aber in genau die andere<br />
Richtung: Kopfschütteln und Empörung statt Dankbarkeit. Dieses Erlebnis hätte<br />
mich wohl kaum sonderlich zum Nachdenken angeregt, wäre ich nicht gerade zu jener<br />
Zeit auf Marcel Mauss' berühmten Essai sur le don (dt. "Die Gabe") gestoßen.<br />
Obwohl Mauss sich in seinem Buch mit fremden und vergangenen Gesellschaften befaßte,<br />
schienen mir seine Ausführungen über den Gabentausch, die Gegenseitigkeit<br />
und das Wesen der wechselseitigen Verpflichtung umstandslos auf meine Alltagserfahrung<br />
übertragbar. P. wollte sich offensichtlich den Verpflichtungen entziehen,<br />
die aus der Inanspruchnahme von Hilfe resultieren. Denn wer sich helfen läßt, der<br />
muß im Gegenzug helfen. P. hingegen hatte uns der Chance beraubt, ihm zur Seite<br />
zu stehen, und damit die Freundschaft ernsthaft in Frage gestellt. Es war, als hätte er<br />
uns nicht zu seiner Geburtstagsfeier eingeladen und uns somit die Gelegenheit genommen,<br />
ihm ein Geschenk zu machen. Freunde helfen sich, und Gefälligkeiten machen<br />
Freunde. Derjenige, mit dem man keine Geschenke austauscht, dem man nicht<br />
hilft, der sich nicht beschenken, helfen läßt, der ist kein Freund. Die Güter und<br />
Dienstleistungen, die zwischen Freunden getauscht werden, sind auch Symbole, die<br />
das Band der Freundschaft zum Ausdruck bringen, und man sollte dessen praktische,<br />
materielle Seite keinesfalls gering schätzen. Schenken und Helfen stehen in deutlichem<br />
Kontrast zum Kaufen, der bei uns üblichen Art und Weise, Güter und Dienstleistungen<br />
gegen Geld mehr oder weniger anonym auszutauschen. Die beiden Sphären<br />
sind nachgerade unvereinbar, was in Sprichwörtern wie "kleine Geschenke erhalten<br />
die Freundschaft" und "Geld zerstört die Freundschaft" ebenso zum Ausdruck<br />
kommt wie in den Begriffen "Freundesdienst" oder "Freundschaftspreis". Das<br />
Schenken ist somit an eine spezifische Form von sozialer Beziehung gebunden, die<br />
sich von derjenigen, die dem Kaufen zugrunde liegt, deutlich unterscheidet. — Die<br />
vorstehenden Sätze hatten vor allem den Zweck, einen ersten Zugang zum Gegenstandsbereich<br />
zu eröffnen. Ich werde im folgenden weitestgehend auf eine Diskus-
2 Einleitung<br />
sion der Bedeutung von Geschenken und wechselseitigen Hilfeleistungen in unserer<br />
Gesellschaft verzichten. Dies liegt nicht primär daran, daß eine Reihe deutschsprachiger<br />
Arbeiten zu diesem Thema vorliegen (Berking 1996, Rost 1994, Schmied<br />
1996), es hat seinen Grund vor allem darin, daß mein Anknüpfungspunkt ein anderer<br />
ist. Um zentrale Spezifika der westlichen Industriegesellschaften herauszuarbeiten<br />
werde ich mich im Rahmen einer vergleichenden Untersuchung nicht mit verschiedenen<br />
Formen des Tauschs in dieser Gesellschaft, sondern mit den in unterschiedlichen<br />
Gesellschaften jeweils vorherrschenden Tauschmustern befassen.<br />
Im Unterschied zu Raub (d.h. gewaltsamer Aneignung) ist Tausch stets ein reziproker,<br />
wechselseitiger Akt. Man gibt, um im Gegenzug zu empfangen, umgehend oder<br />
nach Ablauf einer gewissen Frist, dies ist die Minimaldefinition, von der ich ausgehe.<br />
Der Begriff verweist zuvorderst auf eine ökonomische Bestimmung der Tauschakte:<br />
»Jeder, der einem anderen irgendeinen Tausch anbietet, schlägt vor: Gib mir, was<br />
ich wünsche, und du bekommst, was du benötigst.« (Smith 1776: 17) Da ein derartiger<br />
Austausch beiden Parteien einen materiellen Vorteil verschafft, ging Adam<br />
Smith von »einer natürlichen Neigung des Menschen, zu handeln und Dinge gegeneinander<br />
auszutauschen« (Ibid.: 16) aus, die <strong>für</strong> ihn mit einer ebenso "natürlichen"<br />
Tendenz zur gesellschaftlichen Teilung der Arbeit, Spezialisierung, korrespondierte:<br />
»Wie das Verhandeln, Tauschen und Kaufen das Mittel ist, uns gegenseitig mit fast allen nützlichen<br />
Diensten, die wir brauchen, zu versorgen, so gibt die Neigung zum Tausch letztlich auch<br />
den Anstoß zur Arbeitsteilung. Unter Jägern oder Hirten stellt beispielsweise ein Mitglied des<br />
Stammes besonders leicht und geschickt Pfeil und Bogen her. Häufig tauscht er sie bei seinen<br />
Gefährten gegen Vieh oder Wildbret ein, und er findet schließlich, daß er auf diese Weise<br />
mehr davon bekommen kann, als wenn er selbst hinausgeht, um es zu jagen. Es liegt deshalb in<br />
seinem Interesse, daß er das Anfertigen von Pfeil und Bogen zur Hauptbeschäftigung macht.«<br />
(Ibid.: 17)<br />
Wenn es zutrifft, daß der Tausch innerhalb eines Gemeinwesens dergestalt ursächlich<br />
der Arbeitsteilung bedarf und vice versa, 1 ist nur schwer vorstellbar, daß in Abwesenheit<br />
arbeitsteiliger Produktion getauscht wird — angesichts der Annahme, daß<br />
es keinen Anreiz zum Tausch gibt, wenn alle über das gleiche verfügen und jeder mit<br />
seiner Hände Arbeit alle notwendigen Dinge selbst herstellen kann. Dennoch sind<br />
und waren alle uns bekannten menschlichen Gesellschaften, auch und gerade jene, in<br />
denen keine Form der Arbeitsteilung mit Ausnahme der geschlechtlichen existiert,<br />
von einem beständigen Geben und Nehmen durchdrungen.<br />
Angesichts einer überwältigenden ethnographischen und historischen Evidenz,<br />
die eine fast unüberschaubare Vielfalt unterschiedlichster Tauschakte dokumentiert,<br />
ist man geneigt, vom Menschen als einem tauschenden Wesen zu sprechen. Man<br />
kann sogar noch weiter gehen und mit einigem Recht behaupten, die menschliche<br />
Gesellschaft gründe im Tausch, denn Tauschbeziehungen sind in jeder Kultur ein<br />
1 Auch wenn die ersten, "ursprünglichen" Tauschakte zufällige gewesen sein mögen — zufällig in dem<br />
Sinne, daß der eine gerade über dies, der andere über jenes verfügte.
Einleitung 3<br />
zentrales Mittel der Vergesellschaftung. Ein systematischer Vergleich der in unterschiedlichen<br />
Gesellschaften praktizierten Tauschformen ist meines Erachtens unverzichtbar,<br />
will man die Differenzen zwischen unterschiedlichen Gesellschaftstypen<br />
(und damit auch die Spezifika unserer eigenen Gesellschaft) angemessen darstellen<br />
und erfassen.<br />
Mit diesem Unterfangen knüpfe ich an ein von Marcel Mauss vor mehr als 70 Jahren<br />
formuliertes Programm an. Mauss war der erste bedeutende Theoretiker, der<br />
Tauschbeziehungen in fremden Kulturen 2 , das »System der wirtschaftlichen Leistungen<br />
zwischen den verschiedenen Sektionen oder Untergruppen, aus denen sich die<br />
sogenannten primitiven Gesellschaften und auch jene Gesellschaften zusammensetzen,<br />
die wir archaische nennen könnten« (Mauss 1925: 17), zu seinem Gegenstand<br />
machte. Die Tauschbeziehungen in diesen "primitiven" Gesellschaften 3 bilden<br />
im Rahmen einer idealtypischen Konstruktion den Gegenpol zu den bei uns vorherrschenden<br />
Tauschakten: Nicht Waren werden dort gegen Geld getauscht, sondern<br />
Gaben gegen Gaben. Der Gabentausch, Mauss' primärer Gegenstand, ist im Unterschied<br />
zum Warenaustausch typischerweise ein Tausch von Gleichem gegen Gleiches<br />
(d.h. qualitativ und quantitativ identischer Güter), dem kein offensichtlicher ökonomischer<br />
Nutzen entspringt: im Minimum gibt man einen Korb Yams, um im Gegenzug<br />
einen Korb Yams zu empfangen. Ich muß wohl kaum ausdrücklich hervorheben,<br />
daß derartige Praktiken aufgrund ihrer Fremdheit, ihrer (in unseren Augen)<br />
ökonomischen Sinnlosigkeit, als besonders erklärungsbedürftig erscheinen. 4<br />
2 Ich verwende hier und im weiteren "Kultur" und "Gesellschaft" weitgehend synonym; sowohl im<br />
Singular (die menschliche Kultur, Gesellschaft) als auch im Plural (Kulturen und Gesellschaften).<br />
Gesellschaftliche und kulturelle Aspekte sind im Rahmen dieser Untersuchung nicht sinnvoll zu trennen,<br />
da es mir in erster Linie um die normativen und befähigenden und weniger um die expressiven und<br />
schöpferischen Aspekte der Kultur geht. Jegliche Verwendung des Begriffs "Kultur" im (normativen)<br />
Sinne von "Geisteskultur" liegt mir folglich ebenso fern wie die Reduktion des Gesellschaftsbegriffs auf<br />
"bürgerliche Gesellschaft".<br />
3 "Primitiv" meint zunächst "einfach" oder "ursprünglich" und ist per se kein abwertender Begriff,<br />
wiewohl er von fragwürdigen Annahmen ausgeht: Sie sind, was wir nicht (mehr) sind bzw. was wir<br />
glauben, nicht zu sein. Wenn ich im folgenden von "den Primitiven" oder gar "den Wilden" spreche, so<br />
tue ich dies in Ermangelung einer besseren Begrifflichkeit zur pauschalen Bezeichnung der schriftlosen<br />
Stammens– bzw. segmentären Gesellschaften als Negativfolie, und nicht ohne ironischen Unterton. Ich<br />
will diese Menschen weder abwerten noch idealisieren. Im Zweifelsfall sind die "Primitiven" nicht<br />
primitiver als wir, und die "Wilden" nicht wilder; die Bezeichnung unterstellt zudem eine<br />
Einheitlichkeit dieser Gesellschaften, die nicht existiert (siehe auch oben, S.8f.). Es ist zudem wichtig,<br />
darauf hinzuweisen, daß die jeweilige Position gegenüber diesen Gesellschaften primär von der Einschätzung<br />
der eigenen bestimmt ist (vgl. z.B. Kohl 1979).<br />
4 Der Gabentausch wird häufig auch als "Geschenkaustausch" bezeichnet, da engl. gift bzw. frz. don<br />
sowohl mit "Gabe" als auch mit "Geschenk" übersetzt werden kann. Letzteres ist durchaus problematisch,<br />
man darf "Geben" keinesfalls umstandslos mit "Schenken" gleichsetzen. Zwar ist auch das<br />
Geschenk eine Gabe, als "Nicht-Ware" ist es aber häufig affektiv überdeterminiert, es hat einen hohen<br />
"Gefühls-Wert". Nach David Cheal ist die »Spannung zwischen Marktbeziehungen und persönlichen<br />
Beziehungen ein distinktives Merkmal des sozialen Lebens in kapitalistischen Gesellschaften. Offensichtlich<br />
findet sich diese Spannung nicht in den einfachsten Gesellschaften, wo eine institutionalisierte<br />
Marktökonomie nicht existiert.« (1988: 4) Ich komme im 6. Kapitel darauf zurück.
4 Einleitung<br />
Die Auseinandersetzung mit diesem Gegenstand, die Frage nach dem Daseinsgrund<br />
des Gabentauschs, war <strong>für</strong> Mauss kein Selbstzweck, er verfolgte im Essai ein doppeltes<br />
Ziel: erstens wollte er zu »mehr oder weniger archäologischen Schlußfolgerungen<br />
hinsichtlich der Natur menschlicher Transaktionen in den Gesellschaften [gelangen],<br />
die uns umgeben oder den unseren unmittelbar vorausgegangen sind«<br />
(1925: 19), zum anderen "moralische" Schlußfolgerungen ziehen »bezüglich einiger<br />
der Probleme ..., vor die uns die Krise unseres Rechts und unserer Wirtschaft<br />
stellt.« (Ibid.) Damit hält Mauss der bürgerlichen Gesellschaft sozusagen "den Spiegel<br />
vor", erteilt ihr eine moralische Lektion mittels einer vergleichenden Studie, in<br />
welcher der eine Pol — Ware, Warenaustausch, Marktökonomie — kaum jemals<br />
ausdrücklich benannt wird. Die Ware erscheint als Nicht-Gabe, d.h., das "Eigene"<br />
wird vom "Fremden" her expliziert und kritisiert. Obwohl Mauss durchaus an einer<br />
sehr spezifischen und höchst fragwürdigen evolutionistischen Perspektive festhält,<br />
die im Gabentausch eine historische Vorform des Warenaustauschs sieht, zeichnet<br />
den Essai vor allem aus, daß schließlich der Warenaustausch, gespiegelt im Gabentausch<br />
als defizitär erscheint. 5 Bestimmte Eigenschaften, die die Gabe auszeichnen<br />
(wie rückständig <strong>für</strong> ihn der Gabentausch auch immer sein mag), sind <strong>für</strong> Mauss in<br />
der Warenökonomie beklagenswert abwesend, einer der Gründe <strong>für</strong> die von ihm diagnostizierte<br />
"Krise unseres Rechts und unserer Wirtschaft" (die aber an keiner Stelle<br />
des Buches genauer spezifiziert wird). Mauss führt uns also nach einer Reise durch<br />
die Zeit und um den Erdball zurück in die Straßen unserer Städte, und genau dorthin<br />
muß man ihm folgen. Ich werde im folgenden Mauss' Programm aufgreifen und radikalisieren,<br />
und hoffe, dabei vor allem drei Schwächen des Essai zu vermeiden: die<br />
mangelnde Präzisierung dessen, was es zu kritisieren gilt, die teilweise unreflektierten<br />
anthropologischen und evolutionistischen Vorannahmen und schließlich<br />
die Opazität seiner Ausführungen, die ein adäquates Verständnis des Essai sur le don<br />
häufig behindert haben.<br />
Andere Gesellschaften, andere Tauschformen: Gaben– und Warentausch,<br />
korrespondieren mit jeweils spezifischen Formen von Vergesellschaftung bzw. sozialer<br />
Differenzierung: während unsere Waren-Gesellschaft arbeitsteilig differenziert<br />
ist, sind die "primitiven" (Gaben–) Gesellschaften in der Regel segmentär differenziert,<br />
d.h. in Abstammungsgruppen wie Clans, Lineages usw. untergliedert. Die Differenz<br />
entspricht derjenigen zwischen Émile Durkheims "mechanischer" und "organischer"<br />
Solidarität; nach Durkheim erwächst die "mechanische" Solidarität aus der<br />
"Ähnlichkeit" der sozialen Segmente (Clans, Lineages), die "organische" hingegen<br />
aus der arbeitsteiligen Differenzierung. 6 Diese grobe idealtypische Gegenüber-<br />
5 Mauss hebt den aus unserer Perspektive in ökonomischer Hinsicht defizitären Charakter des Gabentauschs<br />
zwar nicht explizit hervor, stellt ihn aber auch nicht in Frage.<br />
6 Um möglichen Mißverständnissen vorzubeugen ist bereits an dieser Stelle hervorzuheben, daß<br />
"Solidarität" einen rein deskriptiven Gehalt hat und von Durkheim nicht im Sinne von "<strong>für</strong>einander<br />
einstehen" oder "Zusammengehörigkeitsgefühl" gebraucht wird. Er »versteht unter "Solidarität" einen<br />
Relationierungsmodus, eine Form der Soziabilität, die den Zusammenhang zwischen der Struktur und<br />
Funktionsweise einer Gesellschaft — ihrer sozialen Organisation — und ihrem Regel– und Wertsystem
Einleitung 5<br />
stellung soll an dieser Stelle vorläufig genügen um einen ersten Zugang zum Topos<br />
"Tausch und Gesellschaft", den engeren Gegenstandsbereich dieser Studie, zu eröffnen.<br />
Ich werde mich im ersten Kapitel eine Inventarisierung und Klassifizierung der<br />
unterschiedlichen Tauschakte vornehmen und diese in Beziehung zu jeweils damit<br />
korrespondierenden sozialen Beziehungstypen setzen, wobei der Schwerpunkt auf<br />
dem (Gaben-)Tausch in den "primitiven" Gesellschaften liegt. 7<br />
Da das Fremde stets das erklärungsbedürftige ist, lautet im Anschluß daran die<br />
erste und wichtigste Frage ganz schlicht: Warum werden überhaupt Gaben getauscht?<br />
Das bezieht sich sowohl auf den konkreten Tauschakt als auch auf die Begründung<br />
der Existenz der <strong>Institut</strong>ion des Gabentauschs. Warum wird im je konkreten<br />
Fall gegeben und angenommen, inwiefern unterscheiden sich die "rückständigen"<br />
oder "archaischen" Gesellschaften in diesem Punkt von der unseren, wie<br />
ist schließlich die historische und systematische Beziehung von Ware und Gabe beschaffen?<br />
Im Gegensatz zum Gabentausch erscheint uns der Warenaustausch als<br />
selbstverständlich und ganz und gar nicht erklärungsbedürftig: erstens ist evident,<br />
daß wir tauschen müssen, weil eine wechselseitige ökonomische Abhängigkeit besteht,<br />
und zweitens ermöglicht diese Form des Austauschs scheinbar ein Maximum<br />
an ökonomischer Effizienz und damit an Wohlstand — womit sich tiefschürfende<br />
Reflexionen über die Bestimmungen der spezialisierten Warenproduktion offenbar<br />
von vornherein erübrigen. Aus dieser Perspektive erscheint der Gabentausch zudem<br />
notwendig als defizitär, rückständig, gehemmt. Wenn Warentausch und Spezialisierung<br />
sich wechselseitig bedingen und beide in dem vermeintlich ewigen Streben der<br />
Menschen nach einer Steigerung ihres materiellen Wohlergehens (d.h. ihren "Bedürfnissen")<br />
wurzeln (mit der Entstehung von Märkten und Geld als vermeintlich<br />
zwangsläufiger Konsequenz), stellt sich zudem die Frage, wie Gesellschaften dauerhaft<br />
bestehen können, die nicht wie die unsere arbeitsteilig organisiert sind — denn<br />
müssen die Menschen nicht unausweichlich erkennen, daß ihnen die Spezialisierung<br />
zum materiellen Vorteil gereicht? Man wundert sich, warum nicht alle Menschen zu<br />
allen Zeiten dies einsahen, bzw. fragt sich, was sie daran hinderte, so zu verfahren<br />
wie wir. Mit diesen Fragen und den gängigen Chiffren zum Topos "Tausch und Gesellschaft"<br />
werde ich mich im zweiten Kapitel befassen.<br />
Wie immer auch die Antworten auf die eben gestellten Fragen ausfallen, unstrittig<br />
scheint mir, daß der Gabentausch in eine gesellschaftliche und kulturelle Totalität<br />
eingebettet ist, die sich grundlegend von der unseren unterscheidet. Im dritten<br />
Kapitel arbeite ich im Anschluß an Claude Lévi-Strauss die soziale Logik des Ga-<br />
— d.h. ihrer Moral — bezeichnet. Ein hohes Maß an adaptivem Zusammenhalt oder Solidarität ergibt<br />
sich, wenn soziale Organisationsformen und Moraltypen harmonisch aufeinander abgestimmt sind; wo<br />
diese Korrespondenz fehlt, existieren keine sozialen Bande, und die Gesellschaft verfällt in Anomie.<br />
Diese analytische, "relationale" Verwendungsweise der Kategorie "Solidarität" gilt es festzuhalten, da<br />
wir gemeinhin mit Solidarität einen zentralen moralischen Kampfbegriff der Arbeiterbewegung assoziieren<br />
und daher leicht dazu verführt werden, dem "Moralisten" Durkheim eine entsprechende<br />
normative Konnotation seiner Begriffswahl zu unterstellen.« (Müller/ Schmid 1987: 489f.)<br />
7 Das "Schenken" erscheint aus dieser Perspektive als sehr spezieller Sonderfall des "Gebens" — jedes<br />
Geschenk ist Gabe, aber nicht jede Gabe Geschenk.
6 Einleitung<br />
bentauschs heraus um diese Differenz zwischen Gaben– und Warenökonomien im<br />
Rahmen einer zunächst rein formalen Gegenüberstellung adäquat darstellen zu können.<br />
Da es sich bei der vorliegenden Arbeit um eine komparative Studie handelt,<br />
dürfen neben den Unterschieden die Gemeinsamkeiten nicht aus dem Auge verloren<br />
werden. Die Untersuchung der "primitiven" und archaischen Tauschformen enthüllte<br />
Marcel Mauss auch allgemeinste Bedingtheiten des Tauschs zu allen Zeiten und in<br />
allen Kulturen, eine überzeitlich gültige und irreduzible Moral, »Felsen ... auf denen<br />
unsere Gesellschaften ruhen.« (Mauss 1925: 19). Einer dieser Felsen ist die universelle<br />
Norm der Reziprozität als Bedingung der Möglichkeit des Tauschs. Tauschen<br />
heißt nach Mauss stets: Geben, Nehmen, Erwidern. Würde eine gegebene Sache<br />
nicht zwangsläufig und angemessen erwidert, wäre kein Tausch möglich; der Tausch<br />
ist aber zentrales Element des sozialen Leben aller Gesellschaften. 8 Die universelle<br />
Geltung der Reziprozitätsnorm, d.h. der Vorschrift, ein empfangenes Gut (oder eine<br />
Dienstleistung) angemessen zu erwidern, sollte keinesfalls zu der Annahme verführen,<br />
es würde stets unter Gleichen getauscht. Allzu oft ist das genaue Gegenteil der<br />
Fall. Aus diesem Grund befasse ich mich im vierten Kapitel mit dem in unterschiedlichen<br />
Formen des Tauschs bzw. Austauschs zum Ausdruck kommenden Verhältnis<br />
der gesellschaftlichen Ungleichheit bzw. Ungleichwertigkeit der Tauschenden.<br />
Im fünften Kapitel greife ich schließlich die Diskussion der raison d'être des<br />
Gabentauschs erneut auf und spitze sie zu. In diesem Zusammenhang will ich zeigen,<br />
daß eine sich an den begrifflichen Oppositionen "Norm versus Interesse" und "Verzicht<br />
versus Begehren" orientierende holzschnittartige Kontrastierung von Gaben–<br />
und Warenökonomie dem Gegenstand vollkommen unangemessen ist und mehr verschleiert<br />
denn erhellt. Die "Primitiven" handeln ebenso bedürfnisorientiert und interessengeleitet<br />
wie wir, ihre Ökonomie gründet nicht mehr und nicht weniger in der<br />
Unterdrückung des Eigeninteresses (im Dienste des gesellschaftlichen Zusammenhalts)<br />
als unsere. Nur ist dieses Eigeninteresse weistestgehend (d.h. jenseits der elementarsten<br />
Grundbedürfnisse) nicht naturgegeben und invariabel, es ist vielmehr die<br />
Gesellschaft, welche Handlungsorientierungen präformiert und Bedürfnisse produziert.<br />
Um diesen Sachverhalt in aller Deutlichkeit herauszustellen, nehme ich hinsichtlich<br />
der Vergleichsebene einen Paradigmenwechsel vor. Anders als bei der von<br />
Marcel Mauss vorgegebenen Perspektive wird nicht der phänotypische Gabentausch,<br />
d.h. der vermeintlich interesselose Tausch von Gleichem gegen Gleiches als zentrale<br />
Referenz dienen, ich werde vielmehr in Anlehnung an vor allem Marshall Sahlins den<br />
eindeutig von ökonomischen Motiven geleiteten und in arbeitsteiliger Spezialisierung<br />
gründenden sogenannten "primitiven Handel" dem Marktaustausch in Industriegesellschaften<br />
gegenüberstellen. Der Vergleich von oberflächlich sehr ähnlichen Formen<br />
des Austauschs erscheint mir zur Herausarbeitung der zentralen Differenzen<br />
8 Diese Aussage ist tatsächlich wenig mehr als ein Gemeinplatz; aber die <strong>Soziologie</strong> führt, wenn sie auf<br />
das Allgemeinste zielt, also die Verfaßtheit des Menschen, zwangsläufig zu recht banalen Aussagen —<br />
was wiederum eine wichtige Einsicht ist. Zielt sie allerdings auf das Konkrete, d.h. eine spezifische<br />
Gesellschaft, sollte sie sich vor vorschnellen Verallgemeinerungen hüten.
Einleitung 7<br />
besser geeignet als die Erzeugung eines maximalen Kontrasteffekts zwischen Gabe<br />
und Ware; die von mir nicht vertieften Aspekte des Gabentauschs werden in Maurice<br />
Godeliers "Das Rätsel der Gabe" (1996) auf vorzügliche Weise behandelt.<br />
Wie bereits erwähnt, gilt mein Erkenntnisinteresse letztlich weniger der Verfaßtheit<br />
der segmentären Gesellschaft als den Spezifika und der beispiellosen Eigendynamik<br />
der Markt– bzw. Warenökonomie. Es geht mir folglich im abschließenden<br />
sechsten Kapitel um die Skizzierung der historischen, sozialen und funktionalen Bedingtheit<br />
unserer gesellschaftlichen und ökonomischen Ordnung. Der Vergleich von<br />
Tausch– und Vergesellschaftungsformen ist letztlich nur auf sehr umfassender Ebene<br />
möglich und sinnvoll, die Dynamik unserer Ökonomie kann nicht allein aus dem<br />
formalen Prozeß heraus erklärt werden. Die gesellschaftliche Wirklichkeit wird gedacht,<br />
gelebt, erfahren und gefühlt; eine Gesellschaft ist kein abstraktes sondern ein<br />
höchst konkretes (und durchaus auch widersprüchliches) Geflecht, mit den formalen<br />
korrespondieren "inhaltliche" Differenzen, diese betreffen die Ziele und Befindlichkeiten<br />
der Menschen. Die Marktwirtschaft wird von der vorherrschenden Ideologie<br />
letztlich auf die Natur des Menschen zurückgeführt. Kritische Autoren wie Sahlins<br />
und Sidney W. Mintz wiesen aber sehr zu recht darauf hin, daß die vermeintlich naturgegebene<br />
Basis dieser Wirtschafts– und Gesellschaftsordnung (grenzenlose Bedürfnisse<br />
der Menschen und unzureichende Mittel zu deren Befriedigung angesichts<br />
beschränkter Ressourcen) erst im ökonomischen Prozeß selbst, der durch einen systematischen<br />
Zusammenhang von expansiver Warenproduktion und gleichermaßen<br />
expansiven Konsum gekennzeichnet ist, erzeugt wird. Unsere Wirtschaftsordnung<br />
bringt also jene Fundamente hervor, auf die ihre Apologien rekurrieren und die sie<br />
in den Rang von Naturgesetzen erheben. Auch unser Wollen ist also weitgehend gesellschaftlich<br />
kodifiziert. — Diese Einsicht ist zwar weder neu noch sonderlich originell,<br />
es war mir aber wichtig, sie in aller Schärfe zu pointieren, denn sowohl unser<br />
Alltagsbewußtsein als auch die Wissenschaft sind immer noch durchdrungen von einem<br />
Blick auf Mensch und Gesellschaft, der die bei uns vorherrschende Praxis des<br />
Austauschs als allen anderen Formen notwendig überlegenes Produkt einer zwangsläufigen<br />
historischen Entwicklung erscheinen läßt. Genau diese Auffassung gilt es zu<br />
kritisieren.<br />
Die fachkundige Leserschaft wird den vorstehenden Ausführungen entnommen<br />
haben, daß ich eine relativistische bzw. partikularistische Auffassung vertrete.<br />
Eine solche Position einzunehmen heißt <strong>für</strong> den Bereich der <strong>Soziologie</strong> zunächst lediglich,<br />
die Rede von universellen Bewegungsgesetzen, denen der kulturelle Prozeß<br />
bzw. die gesellschaftliche Entwicklung angeblich folgt, zurückzuweisen. Die Kritik<br />
betrifft nicht nur den soziologischen "Evolutionismus" im überkommenen Sinn, sondern<br />
jeglichen Ansatz, der (explizit oder implizit) unterstellt, menschliches Streben<br />
und Handeln sei seit Entstehen der Gattung an invariablen, auf die Maximierung des<br />
materiellen Nutzens gerichteten Parametern orientiert. Ich will in diesem Zusammenhang<br />
nochmals auf die Geschichte dieser Studie zurückkommen. Vor nunmehr<br />
zehn Jahren schrieb ich meine Magisterarbeit zum Gabentausch. Sie trug den Titel
8 Einleitung<br />
"Die Macht der Gabe". Dort vertrat ich (grob gesprochen) die Auffassung, daß ein<br />
Streben nach selbstgenügsamer Autarkie, nach einem Leben, das des anderen nicht<br />
bedarf, dem Menschen eigen ist, und daß dieses Streben eine der Substrukturen des<br />
Lebens aller Gesellschaften bildet. Die Menschen wollen sich demnach jener Bindungen<br />
und Abhängigkeiten entledigen, die irreduzibler Bestandteil unserer Existenz<br />
als gesellschaftliche Wesen sind, aber offenbar als unlustvoll erlebt werden. Eine solche<br />
Lesart setzt voraus, daß Menschen in der Gesellschaft Gewalt angetan wird oder<br />
sie sich Gewalt antun müssen, um ihre angeborenen egoistischen Strebungen zu unterdrücken<br />
(oder zu "sublimieren") und gesellschaftliche Wesen zu werden. Die<br />
Rücksichtnahme auf den anderen, die Kooperation mit ihm, erscheint aus einem derartigen<br />
Blickwinkel dem Menschen äußerlich zu sein und in Widerspruch zu seiner<br />
inneren, "wölfischen" Natur zu stehen. Eine derartige Perspektive erscheint mir<br />
heute als unhaltbar. Menschen sind nicht gefangen in der unauflöslichen Diskrepanz<br />
zwischen ihren Bedürfnissen (Trieben) auf der einen und gesellschaftlichen Anforderungen<br />
auf der anderen Seite. Dies ist nur die Art und Weise, wie wir uns sehen.<br />
Wie weiter unten deutlich werden wird, stellt man sich die Natur (auch die eigene<br />
"innere") offensichtlich so vor, wie man die Gesellschaft wahrnimmt. 9 Die vorliegenden<br />
Ausführungen sind also auch eine neue Variation des alten Streits Relativismus<br />
(resp. Partikularismus) versus Universalismus. Da ich diesbezüglich bemüht<br />
war, mittels einer präziseren Gegenstandsbestimmung und über den Rückgriff auf<br />
empirische Evidenzen die Debatte solider zu fundieren, sollte die vorliegende Arbeit<br />
geeignet sein, erstens ein klareres Bild der Problematik zu vermitteln, zweitens den<br />
Weg aus Sackgassen und unproduktiven Debatten zu weisen und darüber schließlich<br />
drittens neue diesbezügliche Einsichten zu gewinnen.<br />
Da sich meine Argumentation vor allem aus dem Rückgriff auf ethnographische Untersuchungen<br />
speist, muß ich an dieser Stelle zudem einige methodische Anmerkungen<br />
zum Umgang mit diesem Material machen. Die Dichotomie "Wir/Sie", d.h. die<br />
schematische Gegenüberstellung der eigenen und fremder Kulturen wird von mir als<br />
erkenntnisleitendes Prinzip übernommen, dieses hat aber seine Grenzen. Vor allem<br />
sollte es nicht zu der Annahme verführen, die "primitiven" und fremden Gesellschaften<br />
seien erstens umstandslos gleichzusetzen und stellten jeweils einen homogenen<br />
Korpus dar. Die "Anderen" sind keine Restkategorie, der einzige gemeinsame Nenner<br />
dieser Kulturen ist, daß sie sich bezüglich der Abwesenheit einiger Merkmale<br />
(im Minimum des Zusammenhangs von expansiver Güter– und Bedürfnisproduktion)<br />
von den westlichen Industriegesellschaften unterscheiden. In diesem Zusammenhang<br />
ist auch die Rede von einem "okzidentalen Sonderweg" irreführend, suggeriert<br />
sie doch, daß alle anderen Kulturen sich auf mehr oder weniger dem gleichen Weg<br />
befinden, den nur wir verlassen haben. 10 Dies ist keineswegs der Fall; jede Kultur<br />
9 In diesem Sinne ist z.B. die Soziobiologie auch eine Variation über die "Gesetze" der Marktökonomie<br />
und ihr "egoistisches Gen" eine Chiffre <strong>für</strong> das egoistische Individuum.<br />
10 Deshalb sind auch Begriffe wie "vormodern", "vorindustriell" oder "vorkapitalistisch" ungeeignet,
Einleitung 9<br />
kann (und wird) im Zweifelsfall ihre Einzigartigkeit behaupten. Die "klassischen"<br />
Ethnologien täuschen zudem z.T. darüber hinweg, daß es sich bei keiner Gesellschaft<br />
um einen monolithischen und mehr oder weniger statischen Korpus handelt. in allen<br />
Kulturen treten Konflikte auf, bestehen divergierende Ansichten, werden Handlungen<br />
und Behauptungen kritisch hinterfragt. Anders gesagt: jede Gesellschaft besteht<br />
aus Individuen, die sich ebenso unterscheiden wie die Menschen in unserer Gesellschaft.<br />
Die Möglichkeit zur Kritik (und zur Abweichung von Normen) ist allerdings<br />
beschränkt, die elementaren handlungs– und erkenntnisleitenden Klassifikationsschemata<br />
(die "Weltsicht") sind nur sehr eingeschränkt kritisierbar; dies gilt selbst<br />
<strong>für</strong> die moderne westliche Kultur, wenngleich eine hochdifferenzierte pluralistische<br />
Gesellschaft wie die unsere mehr Handlungsoptionen bietet als eine Jäger-Sammler-<br />
Kultur.<br />
Schließlich ist in den vergangenen Jahrzehnten die traditionelle ethnographische<br />
Evidenz angezweifelt worden (vgl. z.B. die Beiträge in Berg/ Fuchs 1993).<br />
Selbstverständlich ist es legitim und notwendig, einen allzu naiven "Realismus" zu<br />
kritisieren, ich denke aber daß die neueren Beiträge zu diesem Thema in ihrer z.T.<br />
sehr fundamentalen Kritik über das Ziel hinaus schießen. Wenn auch die "klassischen"<br />
Ethnologen in ihren Texten Allegorien erschaffen haben mögen, die Sinn nur<br />
bezogen auf unsere Gesellschaft machen, und sie die Bedeutungszusammenhänge, in<br />
denen bestimmte fremde Praktiken stehen, verkannt haben, nicht erkennen konnten,<br />
mißverstanden oder fehlinterpretierten, so sind doch die Beschreibungen der<br />
von ihnen beobachteten <strong>Institut</strong>ionen damit keineswegs hinfällig. Es gibt keinen begründeten<br />
Anlaß, die Existenz jener in fremden Kulturen beobachteten Tauschmuster,<br />
die ich darstellen und diskutieren werde, anzuzweifeln. 11<br />
Mir geht es im folgenden aber nicht allein um eine Übung in allgemeiner und<br />
vergleichender <strong>Soziologie</strong>, sondern — darauf aufbauend — auch um die Kritik der<br />
heute vorherrschenden Auffassungen bezüglich unserer Gesellschaft und Ökonomie<br />
mittels ethnographischen und historischen Materials. Auch angesichts der Anpassungsleistungen,<br />
welche die sich zunehmend beschleunigende "Globalisierung" der<br />
Ökonomie beständig von uns fordert, haben wir offenbar zunehmend weniger Zeit<br />
und Neigung, innezuhalten und über die Bedingtheiten und Konsequenzen unserer<br />
ökonomischen Ordnung und unseres Handelns innerhalb dieser Ordnung nachzudenken.<br />
Angesichts der vermeintlichen Alternativlosigkeit der Marktwirtschaft stel-<br />
fremde und vergangene Kulturen zu etikettieren. Die Termini können sinnvoll nur zur Bezeichnung<br />
europäischer Gesellschaften der frühen Neuzeit verwendet werden.<br />
11 Vielleicht ist tatsächlich, wie James Clifford (1986) behauptet, jede Beschreibung einer fremden<br />
Kultur eine Allegorie auf unsere eigene. Cliffords These ist nicht von der Hand zu weisen, denn die<br />
außereuropäischen Völker »wurden im 18. Jahrhundert zu Vexierspiegeln, in denen die zeitgenössische<br />
europäische Gesellschaft versuchte, sich selbst zu begreifen« (Kohl 1979: 29), und diese Funktion haben<br />
sie bis heute. Wesentlich schwerer noch wiegt m.E. die Tatsache, daß die Kategorien, die uns <strong>für</strong> diese<br />
Beschreibung zur Verfügung stehen, als integraler Bestandteil unserer eigenen Kultur vorn vornherein<br />
Deutungen transportieren und damit vielleicht per se ungeeignet sind, das Fremde adäquat abzubilden<br />
(vgl. z.B. Winch 1964). Das alles sollte aber kein grundsätzliches Problem sein, solange man sich<br />
derartiger Beschränkungen bewußt ist und weiß, was man tut und worauf dieses Tun abzielt.
10 Einleitung<br />
len wir uns die Frage nicht, ob wir das alles so gewollt haben. Das Ansinnen, sich<br />
dem Prozeß der Globalisierung und dem damit einher gehenden verschärften Konkurrenzkampf<br />
zu verweigern, erscheint als schlicht irrational, also "unvernünftig"<br />
und beinahe schon "widernatürlich"; scheinbar ohne Handlungsalternativen sind wir<br />
dem Ausleseprozeß der zunehmend globalisierten Ökonomie des "freien" Marktes<br />
ebenso ausgeliefert wie die letzten Stammesgesellschaften, deren Lebensgrundlage<br />
durch unserer rastloses Streben nach Profit <strong>für</strong> immer zerstört werden. Viviane Forrester<br />
schreibt in einem Buch mit dem deutschen Titel "Der Terror der Ökonomie":<br />
»Uns bringt weniger die augenblickliche Situation in Gefahr — sie wäre durchaus zu ändern<br />
— als unsere blinde Zustimmung und allgemeine Resignation gegenüber all dem, was völlig<br />
undifferenziert <strong>für</strong> unausweichlich gehalten wird. [...] Man beklagt die Nebeneffekte (die Arbeitslosigkeit<br />
z.B.), dringt aber nicht bis zur eigentlichen Ursache, der Globalisierung vor, deren<br />
Entwicklung man nicht anklagt, weil man sie <strong>für</strong> schicksalhaft hält: Ihre Geschichte geht<br />
angeblich bis an die Anfänge der Zeit zurück, ihr Beginn ist nicht zu datieren, und ihr Wirken<br />
scheint alles <strong>für</strong> immer zu beherrschen.« (1996: 61f.)<br />
Wir halten die Gaben tauschenden "primitiven" Gesellschaften nicht nur <strong>für</strong> ökonomisch<br />
sondern, wegen ihrer magischen Praktiken, auch <strong>für</strong> kognitiv rückständig —<br />
was jedoch den "blinden aber festen Glauben" an die Imperative der Weltwirtschaft<br />
betrifft, so verharren wir ebenso wie diejenigen, die magische Rituale abhalten oder<br />
sich vor Gottkönigen in den Staub werfen in einer Art selbstverschuldeter Unmündigkeit.<br />
12 Mit anderen Worten: die Preisgabe des Politischen, d.h. der aktiven Gestaltung<br />
der gesellschaftlichen Ordnung durch mündige Bürger, zugunsten der Unterwerfung<br />
unter die scheinbar unhintergehbaren "Gesetze" der Marktwirtschaft widerspricht<br />
dem Selbstverständnis unserer Gesellschaft als kritisch–aufgeklärte zutiefst.<br />
Gegenstand des zweiten Teils der vorliegenden Studie ist die geläufige Entgegensetzung<br />
von wissenschaftlicher und magischer sowie religiöser Weltauffassung. Das gerade<br />
angesprochene Selbstverständnis ist das Scharnier, welches hier den Tausch mit<br />
dem Denken verbindet; nicht die historische Beziehung, in welcher Marktökonomie<br />
und Wissenschaft zueinander stehen (oder gar die Frage, ob diese Beziehung auch<br />
systematischer Natur sein könnte). Aus der Perspektive der westlichen Zivilisation<br />
erscheint die Menschheitsgeschichte als kontinuierlicher Aufstieg aus den dämmrigen<br />
Niederungen des Aberglaubens in das klare Licht der Vernunft; erst die Überwindung<br />
magisch-religiöser Anschauungen ließ uns demnach der Segnungen einer entfesselten<br />
(im wahrsten Wortsinn) Wissenschaft und Technologie teilhaftig werden.<br />
Wir halten uns anderen Kulturen <strong>für</strong> überlegen und von daher <strong>für</strong> legitimiert, ihnen<br />
zumindest die kognitiven Standards vorgeben zu können, an denen sie sich zu orien-<br />
12 »Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit<br />
ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen.<br />
Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes,<br />
sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen.«<br />
(Immanuel Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?)
Einleitung 11<br />
tieren haben. 13 Aber verfügen wir tatsächlich über einen privilegierten Standpunkt,<br />
welcher uns befähigt, auf Grundlage universell gültiger Maßstäbe Werturteile über<br />
andere Lebensweisen zu fällen? Bezogen auf den Grad der Naturbeherrschung (und<br />
Naturzerstörung), die Effizienz von Landwirtschaft und Industrie, den materiellen<br />
Lebensstandard, ist unsere Gesellschaft allen anderen fraglos weit überlegen. 14<br />
Reicht dies aus, um ganz allgemein deren kognitive Überlegenheit zu behaupten?<br />
Vielleicht ist, wie gerade angedeutet, auch unsere "wissenschaftliche" Weltsicht lediglich<br />
ein Glaubenssystem, welches nur sehr beschränkt Anspruch auf universelle<br />
Geltung erheben kann.<br />
Um diese Fragen wenigstens im Ansatz beantworten zu können, werde ich im<br />
siebten Kapitel zunächst kurz den materialen Kontext skizzieren, auf welchen ich<br />
mich in den darauf folgenden Ausführungen beziehe. Die Auseinandersetzung mit<br />
der eigenen Vergangenheit und mit fremden Kulturen (sowie die Gleichsetzung beider)<br />
ist offenbar bereits seit der Antike zentrales Element des Diskurses der um ihr<br />
Selbstverständnis bemühten okzidentalen Gesellschaft. Das vielleicht wichtigste Einzelmerkmal<br />
dieses Diskurses ist insbesondere seit der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts<br />
die Hervorhebung der Differenz zwischen Mythos und Logos, d.h. "Glauben" und<br />
"Wissen": Hier will ich anknüpfen und einige gängige Ansätze präsentieren, welche<br />
mit der mittlerweile "klassischen" Gegenüberstellung von Magie, Religion und Wissenschaft<br />
operieren. Nun fungiert zwar "Magie" bei vielen Autoren als zentrales Paradigma,<br />
es wird aber häufig nicht recht deutlich, worum es sich dabei überhaupt<br />
handeln soll. Um einige diesbezügliche Klarheit zu schaffen, werde ich Beispiele <strong>für</strong><br />
magische Vorstellungen und Praktiken präsentieren, welche der Leserin und dem<br />
Leser die Beurteilung der theoretischen Auseinandersetzung erleichtern sollen. Folgt<br />
man den gängigen Chiffren, so ist der magische Akt ein wirkungsloser technischer<br />
Eingriff, der auf irrigen Annahmen beruht. Damit drängt sich vor allem die Frage<br />
auf, warum denn die Menschen dies nicht bemerken. Mit der Diskussion dieser Frage<br />
und der Darlegung einiger "konventioneller" Antworten endet dieses Kapitel.<br />
Thema des achten Kapitels ist die im weitesten Sinne "funktionalistische" Kritik<br />
der Auffassung von der rein instrumentellen Bestimmung magischer Rituale. Diese<br />
Kritik betrifft zunächst die Hervorhebung der "Bedeutung", d.h. des symbolischen<br />
oder explanativen Charakters magischer Akte und mythischer Vorstellungen.<br />
Da sich derartige Ansätze am besten über einen Rekurs auf Émile Durkheim erläutern<br />
lassen, skizziere ich kurz dessen soziologischen "Funktionalismus". Demnach<br />
kann eine auf den ersten Blick "irrationale" Handlung auf den zweiten Blick durchaus<br />
"rational" sein, weil sie bestimmte nichtintendierte Zwecke erreicht. Mit einem<br />
13 Und nicht nur diese, auch in ethischer, politischer und ökonomischer Hinsicht sind wir geneigt,<br />
ihnen Vorschriften zu machen, sie zwangsweise zu entwickeln.<br />
14 Zumindest auf den ersten Blick. Die Effizienz einer Wirtschaftsweise, die ihre eigenen Grundlagen<br />
zerstört, ist durchaus in Zweifel zu ziehen. Was das Verhältnis von Input zu Output (in Kalorien) betrifft,<br />
ist bzw. war beispielsweise die Landwirtschaft vorindustrieller Gesellschaften alles andere als<br />
ineffizient.
12 Einleitung<br />
Satz: Rituale vergesellschaften. Diese Feststellung trifft zwar fraglos zu, eine derartige<br />
ultima ratio ist in ihrer undifferenzierten Pauschalität aber letztlich unbefriedigend.<br />
Der magische Akt hat (ebenso wie der Gabentausch) Aspekte, die sich einem aus "instrumentellem<br />
Nutzen" und "gesellschaftlicher Notwendigkeit" konstruierten (vermeintlichen)<br />
Spannungsfeld entziehen; er ist im Minimum bedeutungsvoll.<br />
Um die Perspektive zu erweitern, greife ich im neunten Kapitel erneut das<br />
Problem auf, warum die "Primitiven" die Wirkungslosigkeit ihrer Magie nicht erkennen,<br />
und stelle in diesem Zusammenhang die einigermaßen provokante Frage, ob<br />
nicht ein magischer Akt in seiner eigenen Wirklichkeit durchaus wirksam sein könnte.<br />
Da ich allerdings nicht daran glaube, daß Regenzauber tatsächlich Regen verursacht<br />
— was die Eingeborenen auch nicht unbedingt tun 15 —, gilt mein Augenmerk<br />
eher dem, was der Begriff "Wirklichkeit" meint. Die Antwort auf die zentrale Frage,<br />
ob Wahrheitskriterien kontextgebunden sind oder nicht, hängt vor allem davon ab,<br />
mit welchen Konzepten von Wahrheit und Wirklichkeit man operiert. Ein längerer<br />
Rückgriff auf Durkheims <strong>Soziologie</strong> der Erkenntnis scheint mir an dieser Stelle geeignet,<br />
einiges an Konfusion zu klären. Letztlich verschiebt sich damit die Ebene von<br />
der Frage nach der objektiven Übereinstimmung von Konzepten mit der Wirklichkeit<br />
auf diejenige nach der Interessengebundenheit unterschiedlicher Wirklichkeitskonstruktionen;<br />
schließlich geht es mir nicht um die naturwissenschaftliche Aussagen<br />
(und deren Validität), sondern um bedeutungsvolle normative Konstrukte, die Annahmen<br />
hinsichtlich der Natur des Menschen, der Gesellschaft, der Geschichte und<br />
der Natur beinhalten.<br />
Im zehnten Kapitel wende ich mich schließlich dem Zusammenhang von Moral<br />
und Erkenntnis, und damit unseren eigenen zentralen Gewißheiten, zu. Was diese<br />
betrifft, unterscheiden wir uns wie gesagt vielleicht nur wenig von anderen Völkern;<br />
auch unsere Weltauffassung ist (zumindest teilweise) von einem blinden und<br />
festen Glauben an vermeintlich unhintergehbare Gesetzmäßigkeiten durchdrungen.<br />
Möglicherweise hat unser Selbstverständnis eine ebenso irreduzible vergesellschaftende<br />
Funktion wie die Glaubenssysteme anderer Kulturen, und gründet von<br />
daher notwendig auch in Mystifizierungen. Die angeprangerte "Konfusion von Natur<br />
und Kultur", die Vermischung des normativen und des deskriptiven Diskurses ist<br />
kein Wesensmerkmal allein des "primitiven" Denkens, sondern kennzeichnet z.B.<br />
auch die Doktrinen der Soziobiologie bzw. des neuen Sozialdarwinismus, die zwar<br />
geeignet sein mögen, eine partikulare Realität zu beschreiben (diejenige der westlichen<br />
Industriegesellschaften) aber nicht <strong>für</strong> die Geschichte transzendierende Verallgemeinerungen<br />
taugen.<br />
Weltauffassungen, und das gilt ausdrücklich auch <strong>für</strong> das in den modernen Industriegesellschaften<br />
vorherrschende Bild von der menschlichen Natur und den Triebkräf-<br />
15 »Eine band von !Kung-Buschmännern hatte ihre Regenrituale gerade beendet, da erschien eine kleine<br />
Wolke am Horizont, wuchs an und verfinsterte sich. Dann setzte der Regen ein. Als die Ethnologen die<br />
Buschmänner daraufhin fragten, ob sie glaubten, daß der Ritus den Regen bewirkt habe, wurden sie<br />
jedoch schallend ausgelacht« (Lorna Marshall nach Douglas 1966: 79)
Einleitung 13<br />
ten der Geschichte, sind keine reinen Phantasiegebilde, sondern korrespondieren<br />
mit einer gesellschaftlich erzeugten Wirklichkeit — einer Wirklichkeit, die nicht<br />
nur die Art und Weise betrifft, wie Menschen die umgebende Natur und ihre Mitmenschen<br />
wahrnehmen, sondern auch die Interessen, Bedürfnisse und Handlungsorientierungen<br />
der Individuen. Das komplexe Verhältnis von einerseits (gesellschaftlichen)<br />
<strong>Institut</strong>ionen und andererseits (individuellen) Interessen und Dispositionen<br />
ist der entscheidende Sachverhalt, dem der wissenschaftliche Diskurs — indem er<br />
letztere weitgehend der menschlichen Natur zuschlägt — in aller Regel nicht angemessen<br />
Rechnung trägt, und den ich im Anschluß an die Darstellung der Differenzen<br />
zwischen unterschiedlichen Kulturen herausarbeite und diskutiere. Die vorliegende<br />
Studie soll neue Einsichten und Argumente (einschließlich deren empirischer Fundierung)<br />
hinsichtlich dieses Problembereichs liefern und mit den auf Grundlage der<br />
Arbeiten insbesondere von Émile Durkheim, Marcel Mauss und Marshall Sahlins<br />
entwickelten Grundlinien einer <strong>Soziologie</strong> des institutionalisierten Interesses, d.h.<br />
der gesellschaftlichen Produktion von Bedürfnissen und Handlungsorientierungen,<br />
ein Instrumentarium skizzieren, welches sich <strong>für</strong> die weitere Untersuchung nicht nur<br />
der auf den folgenden Seiten behandelten Gegenstände als hilfreich erweist, weil es<br />
einen schärferen Blick auf sowohl kulturelle Differenzen als auch historische Kontinuitäten<br />
und Diskontinuitäten ermöglicht.
ERSTER TEIL<br />
DER WERT DER DINGE
1. Kapitel<br />
DAS UNIVERSUM DER GABEN<br />
Jeder Versuch, die Vielfalt der in menschlichen Gesellschaften praktizierten Tauschakte<br />
zu systematisieren, muß dem Faktum Rechnung tragen, daß Tauschbeziehungen<br />
soziale Beziehungen sind. Wie getauscht wird, bzw. werden muß oder kann, hängt<br />
davon ab, in welcher Relation die Tauschenden zueinander stehen. Auf Gesellschaften<br />
bezogen heißt das: die jeweils bevorzugten, vorherrschenden oder vorgeschriebenen<br />
Typen des Tauschs korrespondieren mit je spezifischen Formen von Vergesellschaftung<br />
(sozialer "Solidarität" im Sinne Durkheims). Ich werde im folgenden beispielhaft<br />
beschreiben, wie und was in bestimmten Gesellschaften auf welcher Grundlage<br />
getauscht wird (Fragen nach dem "warum" werden dabei zwangsläufig auftauchen,<br />
sollen aber zunächst zurückgestellt bleiben). 16<br />
Bei der Klassifikation gesellschaftlicher Tauschprozesse knüpft man am besten<br />
an das Schema Karl Polanyis an, der zwischen Reziprozität (d.h. Gabentausch), Redistribution<br />
("Umverteilung") und Marktaustausch (d.h. Warenaustausch) als<br />
Grundformen der Distribution unterscheidet, wobei »Reziprozität ... Beziehungen<br />
zwischen einander entsprechenden Punkten symmetrischer Gruppierungen [bezeichnet];<br />
Redistribution verweist auf übernehmende Bewegungen auf ein Zentrum hin<br />
und wieder heraus; Austausch bezieht sich hier auf hin– und hergehende Bewegungen,<br />
so wie zwischen Händen in einem Marktsystem.« (Polanyi 1957b: 250) Der Begriff<br />
"Reziprozität" ist allerdings nicht besonders glücklich gewählt, da er eine zweifache<br />
Bedeutung hat: »Jenseits der Reziprozität als Austauschmuster [...] gibt es ein<br />
weiteres Element: eine generalisierte moralische Norm der Reziprozität, die bestimmte<br />
Handlungen und Verpflichtungen als Rückzahlungen <strong>für</strong> empfangene Leistungen<br />
definiert.« (Gouldner 1973: 96f.) Diese unterschiedlichen Aspekte gilt es<br />
deutlich zu trennen, da die Norm der Reziprozität, d.h. die Verpflichtung, empfangene<br />
Güter und Dienstleitungen zu erwidern, fundamentale und minimale Bedingung<br />
jeglichen Tauschs ist. Ich verwende deshalb — im Unterschied zu einigen der<br />
von mir zitierten Autoren — anstelle von "Reziprozität" oder "reziprokem Tausch"<br />
stets den Terminus "Gabentausch", um diese spezifische Form des Tauschs begrifflich<br />
klar von der universellen Norm der Reziprozität zu scheiden. 17 — Dies nur als<br />
notwendige Anmerkung. Polanyi bezieht sich bei seiner Einteilung der Tauschformen<br />
auf deren jeweilige gesellschaftliche Grundlagen. Die Grundformen der Dis-<br />
16 Eine derart typisierende Darstellung führt zwangsläufig zu einem eher groben schwarz-weißen Raster,<br />
dem es an Zwischentönen mangelt und das die Vielfalt der Kulturen, denen die Beispiele entnommen<br />
sind, nicht einmal ansatzweise widerzugeben vermag. Diesbezüglich verweise ich auf die zitierten<br />
Ethnographien, bei deren Lektüre allerdings die oben in der Einleitung erwähnten Vorbehalte in Rechnung<br />
gestellt werden sollten.<br />
17 Auch die von manchen verwendeten Termini "Gegenseitigkeit" oder "Wechselseitigkeit" sind keine<br />
geeigneten Alternativen zu "Reziprozität", da diese Begriffe z.B. eine hierarchische Beziehung der<br />
Tauschenden nicht per se ausschließen.
18 Das Universum der Gaben<br />
tribution sind demnach gebunden an jeweils spezifische gesellschaftliche <strong>Institut</strong>ionen:<br />
Soziale Segmente (Clans, Lineages usw.) als »symmetrisch angeordnete Gruppierungen«<br />
(Ibid.) an der Basis des Gabentauschs, Zentralinstanzen (vom Häuptling<br />
über den "Gottkönig" bis hin zum modernen Staat) als Grundlage der Redistribution,<br />
den preisbildenden Markt schließlich als Basis des Marktaustauschs. Damit besteht<br />
eine gewisse Entsprechung zwischen den unterschiedlichen Tauschformen und<br />
den "Elementarformen" sozialer Differenzierung: Segmentierung, Stratifizierung<br />
und Spezialisierung; respektive sozialer Solidarität: mechanischer, hierarchischer und<br />
organischer. 18 Diesen Korrespondenzen ist aber durchaus mit Vorsicht zu begegnen,<br />
sie sind keinesfalls als starre Entsprechungen zu verstehen. Gleiches gilt <strong>für</strong> den Zusammenhang<br />
zwischen Produktion und Distribution. Da auch Produktionsverhältnisse<br />
gesellschaftliche (und nicht rein ökonomische) Verhältnisse sind, besteht fraglos<br />
ein Zusammenhang zwischen der Art und Weise, wie in einer Gesellschaft getauscht<br />
wird und ihrer Produktionsweise. 19 So könnte man eine Verbindung zwischen Gartenbau<br />
(d.h. Stecklingswirtschaft) und Gabentausch, Ackerbau (d.h. Getreideanbau)<br />
und Redistribution, schließlich industrieller Produktion und Marktaustausch unterstellen,<br />
was angesichts der empirischen Evidenzen sicherlich eine gewisse Berechtigung<br />
hätte. Ob ein derartiges Unterfangen sinnvoll ist, erscheint mir allerdings mehr<br />
als fraglich, da sich die meisten Gesellschaften derart simplen klassifikatorischen Rastern<br />
entziehen (und unterschiedliche Tauschformen in der Regel koexistieren). Deshalb<br />
sollen und können die angedeuteten kategorialen Entsprechungen lediglich einen<br />
ersten Orientierungspunkt liefern. Ich werde mich im folgenden zunächst ausführlich<br />
mit dem Gabentausch befassen.<br />
Die Gabe ist allzu oft als "Nicht-Ware", der Gabentausch als Negativfolie des<br />
Warentauschs konzipiert oder besser: konstruiert worden. Eine derartige Bestimmung<br />
des Gegenstands führt zwangsläufig dazu, daß Differenzen, die zwischen den<br />
"primitiven" respektive "vormodernen" Tauschformen bestehen, eingeebnet werden<br />
18 Die entscheidende These, die Durkheim in der Arbeitsteilung vertritt, hat den Übergang von der<br />
mechanischen zur organischen Solidarität zum Gegenstand. Im ersten Fall entspringt die Solidarität aus<br />
Ähnlichkeiten, im anderen Fall aus Unterschieden: Die mechanische Solidarität ist »eine Solidarität sui<br />
generis, die, aus Ähnlichkeiten erwachsend, das Individuum direkt an die Gesellschaft bindet« (Durkheim<br />
1902: 156) Sie ist charakteristisch <strong>für</strong> jene von Durkheim als sociétés primitives, also "einfache"<br />
Gesellschaften bezeichnete Formationen. "Organische Solidarität" bezieht sich hingegen auf die<br />
arbeitsteilige Differenzierung der "Organe" in "höheren" Gesellschaften. Die Einführung des Begriff der<br />
hierarchischen Solidarität, den ich bei Marshall Sahlins entlehnte, ist eine notwendige Ergänzung von<br />
Durkheims Schema, das nicht ausreicht, um hierarchische Beziehungen zu fassen. Sahlins bezieht den<br />
Terminus zunächst auf die gemeinsame Unterordnung unter eine herrschende Macht, welche die Beziehung<br />
der Menschen untereinander vermittelt: »In den heroischen Gesellschaften ist der Zusammenhalt<br />
der Mitglieder oder Untergruppen nicht so sehr durch ihre Ähnlichkeit ... oder ihre Komplementarität<br />
... bedingt als vielmehr durch ihre gemeinsame Unterordnung unter die herrschende Macht.« (1985:<br />
57) Im alten Hawaii (auf das Sahlins sich hier bezieht) war »das wichtigste, umfassende Organisationsprinzip<br />
... die Hierarchie, die sich im wechselseitigen, aber ungleichen aloha zwischen den einfachen<br />
Menschen und dem Häuptling ausdrückte ... Über die unmittelbaren Verwandten hinaus waren die<br />
Beziehungen der Menschen zueinander durch die regierenden Häuptlinge vermittelt.« (Ibid.: 135)<br />
19 Und auch mit der Art und Weise, wie in dieser Gesellschaft konsumiert wird, dies wird sich noch als<br />
außerordentlich bedeutsames Faktum erweisen!
Das Universum der Gaben 19<br />
— Unterschiede, die sich als höchst gravierend und bedeutungsvoll erweisen könnten.<br />
So muß man beim Gabentausch, Polanyis "Reziprozität", zwischen zumindest<br />
vier Ausprägungen differenzieren: erstens dem "Teilen", zweitens der sog. ausgeglichenen<br />
Reziprozität, drittens dem wettstreitenden Tausch und viertens dem "primitiven<br />
Handel", 20 wobei die jeweiligen Formen mit einer je unterschiedlichen "sozialen<br />
Distanz" der Tauschenden korrespondieren, die im ersten Fall am geringsten, im<br />
dritten und vierten Fall am größten ist (vgl. Abbildung 1). In dieser Reihenfolge<br />
werde ich die einzelnen Typen des Gabentauschs behandeln.<br />
Abbildung 1: Tauschformen und soziale Distanz<br />
GLEICHHEIT UND GEGENSEITIGKEIT: TEILEN<br />
Nähert man sich dem Gegenstand einigermaßen unbedarft, so ist die Annahme naheliegend,<br />
daß die ursprünglichsten und einfachsten Formen des Tauschs in den ursprünglichsten<br />
und einfachsten Gesellschaften aufzufinden sind. Dieser Satz bedarf<br />
sogleich einer wichtigen Anmerkung: auch wenn man eine historische Abfolge der<br />
drei Grundformen der Distribution konstatieren kann (von der Reziprozität über die<br />
Redistribution zum Marktaustausch), ist damit noch keine evolutionistische Position<br />
impliziert, welche diese Abfolge als zwangsläufige deklariert. Es ist bei der Lektüre<br />
meiner Ausführungen wichtig, dies im Gedächtnis zu behalten, da sich an Typologien<br />
wie diejenige Polanyis leicht vorschnell evolutionistische Konnotationen knüpfen.<br />
Dennoch: das wissenschaftliche Interesse an den nach ihrer "aneignenden" (im<br />
Unterschied zur "planenden" oder "vorausschauenden") Wirtschaftsweise mit dem<br />
Begriff "Jäger und Sammler" oder "Wildbeuter" bezeichneten Gesellschaften ist<br />
nicht zuletzt in ihrer vermeintlichen "Ursprünglichkeit" begründet, einer spezifischen<br />
Verbindung von "urtümlicher" Wirtschaftsweise, Sozialorganisation und Dis-<br />
20 Diese Klassifikation knüpft an die von Marshall Sahlins' in seinem Aufsatz "On the Sociology of Primitive<br />
Exchange" (1972: 185-276) gelieferte an.
20 Das Universum der Gaben<br />
tributionsform, der ihnen eigentümlich ist: 21 die Menschen leben in auf den ersten<br />
Blick als einigermaßen "amorph" erscheinenden, nichtseßhaften Horden ohne differenzierte<br />
Sozialorganisation, kennen keine Arbeitsteilung mit (der gewichtigen)<br />
Ausnahme der geschlechtlichen und keine Unterordnung außer derjenigen der Kinder<br />
unter ihre Eltern, der Frauen unter die Männer. 22 Das in diesen Gesellschaften<br />
dominierende "egalitäre Ethos" (James Woodburn spricht von "konkurrenzfreiem<br />
Egalitarismus") macht sie zudem zu einem bevorzugten Objekt des Diskurses über<br />
soziale Gleichheit.<br />
Der Zusammenhang von Gleichheit und Gegenseitigkeit manifestiert sich in<br />
der offenbar allen diesen Gesellschaften eigenen Praxis des "Teilens" ("sharing"). So<br />
schreibt z.B. J. Dawson 1881 über die australischen Ureinwohner:<br />
»Es gibt strenge Vorschriften, die die Verteilung der Nahrung regeln. Wenn ein Jäger Wild ins<br />
Lager bringt, gibt er alle Rechte an ihm auf und muß beiseite stehen und gestatten, daß die besten<br />
Teile weggegeben werden und sich selbst mit den schlechtesten begnügen. Wenn ein Bruder<br />
anwesend ist, wird dieser ebenso behandelt und verspeist mit dem Jäger die armseligen<br />
Stücke, welche ihnen zugeworfen werden ... Der Erzähler dieses Brauchs erwähnte, daß er, als<br />
er sehr jung war, murrte, weil sein Vater die besten Stücke ... weggab, aber ihm wurde gesagt,<br />
daß dies eine Regel sei und befolgt werden mußte. Diese Sitte wird yuurka baawhaar genannt,<br />
was "Tausch" bedeutet.« (zit. nach Altman/Peterson 1988: 76) 23<br />
Für die südwestafrikanischen !Kung ist »die Vorstellung, alleine zu essen und nicht<br />
zu teilen, beunruhigend und erschreckend, sie läßt sie ängstlich, besorgt und verwundert<br />
lächeln. Löwen könnten das tun, sagen sie, aber doch nicht Menschen.«<br />
(Marshall 1961: 236) Auch die !Kung teilen, nicht nur Fleisch, sondern jegliche gesammelte<br />
oder erbeutete Nahrung.<br />
21 Schon 1968 insistierte der Archäologe L. Freeman allerdings darauf, daß zeitgenössische<br />
Jäger/Sammler-Gesellschaften, die geographisch, politisch, und sozial marginalisiert sind, nicht als<br />
Dokument einer universellen historischen Lebensweise genommen werden konnen, sondern eine eigene<br />
Geschichte haben.<br />
22 Um keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen, ist sogleich hervorzuheben, daß in jeder Gesellschaft<br />
zumindest drei Formen der Ungleichheit anzutreffen sind: diejenige zwischen den Geschlechtern,<br />
den Generationen und zwischen Stammesangehörigen und Fremden. Zumindest die erwachsenen<br />
Männer erscheinen in diesen Kulturen aber tatsächlich als ausgesprochen "gleich", auch wenn<br />
Statusunterschiede bestehen können, die in unterschiedlichen Leistungen und Fähigkeiten gründen. Wo<br />
die <strong>Institut</strong>ion des Häuptlings existiert, ist dessen Macht in der Regel äußerst beschränkt (Vgl. hierzu<br />
z.B. Pierre Clastres Bemerkungen zum indianischen Häuptlingstum, 1974: Kap. 2 und 7).<br />
23 In Gesellschaften mit aneignender Wirtschaftsweise findet sich nicht durchgängig jenes "egalitäre"<br />
Ethos. Um den seiner Meinung nach bestehenden Kausalzusammenhang zwischen der spezifischen<br />
Wirtschaftsweise eines Gesellschaftstypus und ihrer egalitären Ausrichtung — die die Herausbildung von<br />
Reichtum, Macht und Status verhindert — hervorzuheben, nimmt Woodburn (1982) eine genauere<br />
kategoriale Unterscheidung vor. Er differenziert zwischen den egalitären immediate-return foraging<br />
societies, d.h. Wildbeutergesellschaften die sozusagen "von der Hand in den Mund" leben, und den nichtegalitären<br />
delayed-return foraging societies, also ebenfalls "Wildbeuter", bei denen auf die eine oder andere<br />
Art und Weise vorausschauend geplant wird, bei der Produktion und/oder auf dem Feld des Sozialen. In<br />
die zweite Kategorie fallen <strong>für</strong> Woodburn z.B. die australischen Aborigines — die über komplexe<br />
Heiratsordnungen und Verwandtschaftssysteme, verbunden mit Transferleistungen zwischen Schwägern<br />
("affinal payments") und entwickelter Polygynie, verfügen — und die seßhaften und stratifizierten<br />
Gesellschaften der amerikanischen Nordwestküsten-Indianer.
Das Universum der Gaben 21<br />
»Nicht allein Familienangehörige legen ihre Tagesausbeute an Nahrung zusammen, sondern die<br />
gesamte Lagergemeinschaft ... teilt die zur Verfügung stehende Gesamtmenge an Nahrung zu<br />
gleichen Teilen auf. So setzt sich das Abendessen jeder einzelnen Familie aus Speiseportionen<br />
zusammen, die sie von allen anderen Familien erhielt. Die Nahrung wird entweder roh verteilt<br />
oder erst von den Sammlerinnen gekocht und dann verteilt. Nüsse, Beeren, Wurzeln und Melonen<br />
wandern solange von Familienfeuerplatz zu Familienfeuerplatz, bis jeder Lagerbewohner<br />
eine gleich große Portion wie alle übrigen erhalten hat.« (Lee 1969: 58)<br />
Die Hadza »haben ähnliche Regeln, die verlangen, daß das Fleisch großer Tiere ohne<br />
Erwartung einer Gegenleistung geteilt, d.h. nicht als Gabe gegeben wird, <strong>für</strong> welche<br />
man eine reziproke Erwiderung erwartet. [...] Obwohl das getötete Tier dem Jäger<br />
gehört, ist er nicht berechtigt, mit ihm nach Belieben zu verfahren. Tatsächlich spielt<br />
er häufig kaum eine Rolle bei der Zerlegung des Tieres und der Zuteilung der<br />
Fleischstücke.« (Barnard/Woodburn 1988: 17) Der Jäger erhält den gleichen Anteil<br />
wie alle anderen, ihm wird nur minimale soziale Anerkennung zuteil.<br />
Kirk Endicott hebt die gesellschaftliche Dimension derartiger Praktiken am<br />
Beispiel der in Malaysia lebenden Batek hervor: »Das Teilen von Fleisch ist <strong>für</strong> die<br />
Batek eine absolute normative Verpflichtung und liegt nicht im Ermessen des Jägers.<br />
Wie ein Jäger sagte: "Wenn ich das Fleisch nicht ins Lager zurückbrächte, wären alle<br />
wütend auf mich."« (1988: 117) Von einer Person wird erwartet, daß sie teilt; versäumt<br />
sie das, zögern die anderen nicht, ihr Recht einzufordern. Die Nahrungsverteilung<br />
wird von keinem Wort und keiner Geste der Dankbarkeit begleitet; was auch<br />
schwer denkbar ist, würde es doch ein Recht des Gebenden implizieren, die Gabe<br />
zurückzubehalten. In manchen Gesellschaften ist dem Jäger sogar explizit untersagt,<br />
von seiner eigenen Beute zu essen.<br />
So liegt nach Pierre Clastres der Fleischverteilung bei den südamerikanischen<br />
Aché (Guayaki) nicht nur eine Verhaltensvorschrift, sondern auch ein striktes Tabu<br />
zugrunde:<br />
»Nie ißt ein Mann von seinem eigenen Wild, so will es das Gesetz, das bei den Aché die Nahrungsmittelverteilung<br />
regelt. Ich töte ein Tier, meine Frau zerteilt es, mir ist es verboten. Sie<br />
behält einige Stücke <strong>für</strong> sich und die Kinder zurück, der Rest wird unter die Gefährten verteilt:<br />
zuerst an die Verwandten, die Brüder und Schwäger, dann an die anderen. Keiner wird bei der<br />
Verteilung ausgelassen, und wenn nur wenig Fleisch da ist, nun, dann sind die zugeteilten Stücke<br />
eben kleiner, doch jeder bekommt seins. Da<strong>für</strong> bekomme ich von den anderen eine Portion<br />
des Wildes, das sie mitgebracht haben. Ich ernähre sie mit meiner Beute, sie handeln an mir<br />
ebenso. Ein Jäger verbringt also letztlich sein Leben damit, Tiere <strong>für</strong> die anderen zu erlegen<br />
und da<strong>für</strong> deren Wild zu verzehren. Seine Abhängigkeit ist vollkommen, ebenso die der Gefährten<br />
von ihm. Es herrscht Ausgewogenheit, keiner wird benachteiligt, da alle Männer<br />
gleichwertige Fleischmengen "produzieren". Das nennt man pepy, den Tausch.« (1972: 187)<br />
Die Verpflichtung, Nahrung zu teilen, ist verknüpft mit der Erwartung, daß alle Mitglieder<br />
der Gruppe ihr Bestes geben, einen möglichst reichhaltigen Ertrag zu erzielen.<br />
Eine Erwartung, der nicht immer alle entsprechen. Dieses System läßt Schmarotzern<br />
einigen Freiraum, worüber die Batek nicht unbedingt glücklich sind. Aber<br />
auf die Frage des Ethnologen, warum sie nicht einfach einen Mann, dessen offensichtliche<br />
Faulheit <strong>für</strong> einige Mißstimmung in der Gruppe sorgte, auffordern, diese
22 Das Universum der Gaben<br />
zu verlassen, anworteten die Batek nur: "Weil er ein Batek ist." — was <strong>für</strong> Endicott<br />
bedeutet, »daß sie einem Batek etwas derart Gefühlloses einfach nicht antun könnten,<br />
was auch immer seine Verfehlungen sein mochten.« (Ibid.: 118) 24<br />
TAUSCH UND BESITZ<br />
In Wildbeutergesellschaften hat man, um zu geben. F. Myers, der die australischen<br />
Pintupi untersuchte, beschreibt eindrucksvoll, inwieweit das Gebot des Teilens auch<br />
heutzutage noch das gesellschaftliche Leben der Eingeborenen und ihre Beziehungen<br />
zueinander durchwaltet:<br />
»Männer schnorren fast völlig gedankenlos Tabak und Zigaretten. Ich war keineswegs der einzige<br />
Raucher, und obwohl meine Pintupi-Gefährten mir gegenüber großzügig waren, war<br />
mein Vorrat [an Zigaretten] oft allzu schnell aufgebraucht. Da ich selbst viel häufiger angeschnorrt<br />
wurde als umgekehrt, wurde ich manchmal ziemlich ärgerlich, wenn mir die Zigaretten<br />
ausgingen. In einer solchen Situation kam einmal ein junger Mann in mein Lager und<br />
fragte, ob ich Zigaretten hätte. Betrübt antwortete ich, mit einigem Ärger in der Stimme, daß<br />
die Leute alle genommen hätten, und rechnete ihn mehr oder weniger zu denen, die mich ausgenutzt<br />
hatten. Anstatt mir das übelzunehmen ... bot er mir einige von seinen Zigaretten an.<br />
Er machte sich darüber hinaus die Mühe, mir zu erklären, daß ich meine Sachen nicht so<br />
schnell weggeben sollte. Statt dessen sollte ich verstecken, was ich hatte — er zeigte mir, wie<br />
er ein Päckchen Zigaretten in den Socken unter seiner Hose verbarg — und dann könnte ich<br />
den Leuten einfach sagen, daß ich unglücklicherweise keine Zigaretten hätte... Jimmy gab mir<br />
ein ganzes Päckchen und erzählte mir, daß er einige nahe dem Lager vergraben hätte. Dieses<br />
Beispiel spricht einige geläufige Themen des Umgangs der Pintupi mit Teilen, Besitzen und<br />
Erbitten an. Ich interpretierte Jimmy so, daß er auf seine Weise sagen wollte, ich dürfe niemanden<br />
offen abweisen. Eine Bitte offen abzuschlagen ... ist etwas sehr Problematisches <strong>für</strong> die<br />
Pintupi, ob sie es nun selbst tun oder akzeptieren müssen. Anteilnahme und Mitgefühl ist die<br />
angemessene und moralische Antwort Verwandten oder anderen Mitgliedern des Camps gegenüber.<br />
Direkte Verweigerung führt im Gegensatz dazu zu einer offenen Ablehnung des Anspruchs<br />
des anderen auf eine wechselseitige Beziehung: im sozialen Leben der Pintupi ist ein<br />
dem anderen ins Gesicht gesagtes "Nein" etwas sehr Ungewöhnliches und Gefährliches. Die so<br />
Abgewiesenen könnten mit Zorn und Gewalt antworten. Aber wenn Jimmys vergrabene Zigaretten<br />
von anderen genommen würden, wäre er bestimmt ärgerlich — in ähnlichen Fällen reden<br />
die Leute von "Diebstahl". [...] Obwohl er aufgrund ihrer Beziehung hätte verpflichtet<br />
sein können, dem Dieb Zigaretten zu geben, würde er die Tatsache, daß sie genommen wurden<br />
ohne zu fragen, als Verletzung seines persönlichen Anrechts betrachten.« (Myers 1988:<br />
56)<br />
Wer nimmt, ohne zu fragen, tut mehr als nur ein neutrales Ding zu nehmen, er<br />
verweigert dem Besitzer die Möglichkeit zu geben um darüber das soziale Band zu<br />
24 Endicott sieht einen engen Zusammenhang zwischen der Obligation, alle komsumierbaren Güter zu<br />
teilen sowie der kulturellen Identität und der Wirtschaftsweise der Batek: »Die traditionelle Vorstellung<br />
der Batek, ... daß jeder Nahrungsüberschuß mit den anderen Familien geteilt werden muß, erscheint<br />
einem nomadischen Leben gut zu entsprechen, ist aber dem bäuerlichen Leben, zu dem man sie nun<br />
zwingen will, gänzlich unangemessen. Ihr Ideensystem aufzugeben, würde <strong>für</strong> sie psychologisch sehr<br />
schwierig werden, da die Verpflichtung, die Nahrung zu teilen, eine der fundamentalen Komponenten<br />
der Identität der Batek und eines der wichtigsten Bande, das die Familien zu einer Gesellschaft<br />
verbindet, darstellt.« (Ibid.: 126f.)
Das Universum der Gaben 23<br />
erneuern (und eine Verpflichtung zu schaffen) — das ist die Quintessenz von Myers<br />
Argumentation. Die Praxis des Teilens sollte also nicht zu dem Schluß verführen,<br />
daß diesen Gesellschaften die Scheidung von "Mein" und "Dein" fremd ist. 25<br />
Barnard und Woodburn stellen kurz und bündig fest: »Besitzrechte existieren ... in<br />
allen Gesellschaften, obwohl in keiner Gesellschaft alles jemandem gehört.« (1988:<br />
13) Was in Jäger/Sammler-Gesellschaften (und nicht nur in diesen) allerdings abwesend<br />
ist, ist das Konzept des Eigentums als "absolute Verfügungsmacht" über eine<br />
Sache. Es besteht keine Möglichkeit, mit Eigentumsrechten zu operieren um materielle<br />
Vorteile zu erzielen oder Abhängigkeiten zu schaffen (vgl. z.B. Woodburn 1982:<br />
445). 26 Der Zugang zu sämtlichen natürlichen Ressourcen ist folgerichtig in der Regel<br />
<strong>für</strong> alle Angehörigen der Gruppe frei und unbeschränkt, niemand besitzt den<br />
Wald, die Tiere, die Fische — solange die Bäume nicht gefällt, die Tiere nicht getötet<br />
sind.<br />
Persönlicher Besitz entsteht nach Barnard und Woodburn, indem mittels Arbeit Natur<br />
in Kultur transformiert wird, 27 und ein Grundsatz scheint in allen Gesellschaften<br />
explizit oder implizit zu gelten: Was ein Mensch in der Natur sammelt oder erbeutet,<br />
was er selbst herstellt, wird als sein "Besitz" betrachtet — solange nicht ein anderer<br />
Grundsatz dieses Prinzip außer kraft setzt und dem Menschen das Produkt seiner<br />
Tätigkeit entzieht, wie im Fall der Sklaverei oder der Lohnarbeit. »Was ich als<br />
Individuum erbeute oder herstelle — die Beeren, die ich pflücke, den Grabstock,<br />
den ich verfertige — ist meines aufgrund des offenbar universell anerkannten<br />
Grundsatzes, daß Arbeit ... materielle Dinge in Eigentum verwandelt.« (Barnard/-<br />
Woodburn 1988: 24) Das Wild "gehört" folglich demjenigen, der es erbeutet hat. 28<br />
Folgt man diesen Autoren, dann ist den Wildbeutergesellschaften das Konzept des<br />
gemeinschaftlichen Besitzes fremd, »Einzelbesitz ist die Norm« (Ibid.: 25).<br />
Aber der Jäger kann über diesen Besitz nicht verfügen, besser: er darf nicht<br />
darüber verfügen können: er muß geben, um empfangen zu können. Der Tausch<br />
wird von einer gesellschaftlichen Norm, die Besitzrechte festlegt, ermöglicht und<br />
von einer anderen, scheinbar widerstreitenden, die das Teilen vorschreibt, erzwungen.<br />
Die Existenz von persönlichem Besitz ist dergestalt Bedingung der Möglichkeit<br />
25 Diese Feststellung »steht im Widerspruch zu der von einigen Theoretikern des 18. und 19.<br />
Jahrhunderts vertretenen These, derzufolge in den "primitiven" Gesellschaften "alles allen gehörte" und<br />
das Eigentum — man könnte ebensogut vom Fehlen jedes Eigentums sprechen — allein auf dem Prinzip<br />
des sogenannten "Urkommunismus" beruhte.« (Godelier 1984: 85) Vgl. auch Lee (1988).<br />
26 Es ist ganz und gar nicht unproblematisch, unsere Begriffe bzw. Konzepte von "Besitz" und<br />
"Eigentum" auf fremde Kulturen zu übertragen, da uns aber keine anderen Termini zur Verfügung<br />
stehen, hat man keine andere Wahl, um die Zuordnung von Dingen zu Personen zu bezeichnen.<br />
27 Maurice Godelier weist darauf hin, daß sich eine derartige Auffassung z.B. auch bei John Locke findet,<br />
<strong>für</strong> den dieses Prinzip die Quelle des Privateigentums war: »Die Arbeit gehört jedem "zu eigen" und<br />
"hat die Dinge aus dem Gemeinbesitz heraustreten lassen".« (Godelier 1984: 79f.).<br />
28 Wenn mehrere Personen an der Jagd beteiligt waren, "gehört" die Jagdbeute meist dem Besitzer des<br />
Pfeils (nicht dem Schützen!), der es tötete; waren es mehrere Pfeile, dann dem Besitzer des ersten, der<br />
traf.
24 Das Universum der Gaben<br />
des Gabentauschs. 29 Tim Ingold spielt auf eben diesen Punkt an, wenn er fragt, warum<br />
eine Gesellschaft überhaupt der Vorstellung von persönlichem Besitz bedürfe.<br />
»Die Antwort ... hat mit seiner Funktion bei der Herstellung und Aufrechterhaltung<br />
der Unterscheidung zwischen Kategorien der Geber und Empfänger ... zu tun. [...]<br />
Um zu geben, muß ich haben« (1986: 228) 30<br />
Diesen Sachverhalt hebt auch Myers hervor. Vom Pintupi-Jäger wird erwartet,<br />
das erlegte Känguruh anderen zur Zubereitung zu überlassen, aber er hat sowohl<br />
das Recht als auch die Verpflichtung, die Verteilung des zubereiteten Tieres zu leiten.<br />
Für seine Dienste erhält der Koch den wegen seines hohen Fettgehalts gepriesenen<br />
Schwanz, anschließend weist der Jäger den Koch an, wie die Teile des gekochten<br />
Tieres zu verteilen sind und behält den Kopf (und möglicherweise andere Teile) <strong>für</strong><br />
sich. »Der Erfolg bei der Jagd versorgt den Jäger mit Fleisch, aber darin erschöpft<br />
sich seine Bedeutung nicht. Der Erfolg sichert besondere Rechte am Tier, schafft die<br />
Gelegenheit zu geben — in einen ... Austausch einzutreten, der eine Art moralischer<br />
Identität mit den Empfängern schafft oder befördert.« (Myers 1988: 58)<br />
Es besteht also ein fundamentaler Zusammenhang zwischen individuellem Besitz und<br />
Tausch. Ohne "Besitz", was im Minimum tatsächlich nicht mehr heißt als die Zuordnung<br />
von Personen zu Dingen, ist kein Tausch möglich. Wer nichts hat, kann auch<br />
nicht geben. Dies gilt nicht nur <strong>für</strong> die Jäger und Sammler, sondern <strong>für</strong> alle Gesellschaften<br />
und jeglichen Tausch.<br />
VERWANDTSCHAFT UND VERPFLICHTUNG<br />
Das Teilen wird von Marshall Sahlins als generalisierte Reziprozität bezeichnet. Geteilt<br />
wird in der Jäger/Sammler-Horde, aber auch innerhalb des engeren oder weiteren<br />
Familienverbandes. Aus E.B. Tylors Diktum "kindred goes with kindness" folgt <strong>für</strong><br />
Sahlins, daß nahe Verwandte dazu neigen zu teilen, ohne auf der Ausgewogenheit<br />
des Tausch zu beharren, dies gilt <strong>für</strong> alle Gesellschaften, auch dort, wo das Gebot<br />
29 Gebrauchsgegenstände wie selbst verfertigte oder im Tausch bzw. als Geschenk erworbene Waffen<br />
und Werkzeuge usw. sind im Unterschied zur Jagdbeute tatsächlich persönliches "Eigentum". Aber auch<br />
dieses kann nicht beliebig angehäuft werden: »Für einen Hadza ist es unwahrscheinlich, daß eine zweite<br />
Axt oder ein zweites Hemd länger als wenige Stunden oder höchstens einige Tage in seinem Besitz<br />
bleibt. [...] Die moralische Verpflichtung, zu teilen, hat verschiedene wichtige Konsequenzen. Die erste<br />
ist offensichtlich. Insofern beweglicher Besitz Reichtum repräsentiert, hindert sie die Menschen daran,<br />
sich nach der Menge an Besitz zu unterscheiden. Zweitens vermittelt sie Außenseitern den Eindruck, daß<br />
die Hadza besitzlos und verarmt sind und führt dazu, die Vorurteile ihnen gegenüber zu verstärken.<br />
Drittens beschränkt sie in hohem Maße die Möglichkeit, Besitz gesellschaftlich zu nutzen, um darüber<br />
Bande zu knüpfen, Verpflichtungen zu genügen oder Schulden zu zahlen. Viertens führt sie zur<br />
Einschränkung der Produktion von Waffen und anderem beweglichen Besitz über den direkten persönlichen<br />
Bedarf hinaus.« (Ibid.: 16)<br />
30 Für Barnard und Woodburn sind die Prinzipien des persönlichen Eigentums und des Teilens jeweils<br />
universell, es besteht kein ursächlicher Zusammenhang zwischen beiden. »So wichtig Konzepte des<br />
individuellen Eigentums sind, um eine Basis <strong>für</strong> den reziproken Gabentausch ... zu bilden, ist es<br />
zweifelhaft, ob sie aus dieser Funktion hergeleitet werden können.« (1988: 26f.)
Das Universum der Gaben 25<br />
des Teilens nicht (mehr) die zentrale vergesellschaftende Bedeutung hat, die ihm in<br />
den Wildbeuter-Horden zukommt. 31 Ausgeglichene Reziprozität ist nach Sahlins im<br />
Unterschied dazu, »der gleichzeitige Austausch der gleichen Art von Gütern in gleichen<br />
Mengen.« (1972: 194). Auf diese Art und Weise realisiert sich der Tausch zwischen<br />
den Clans oder Lineages einer segmentären Gesellschaft. Eine derartige Gesellschaft<br />
ist in funktional identische (d.h. nicht arbeitsteilig differenzierte) Abstammungsgruppen<br />
gegliedert, zwischen denen genau definierte Rechte und Pflichten<br />
bestehen. 32<br />
Von besonderer Bedeutung sind dabei die durch die Heirat geknüpften Bande.<br />
Es sind vor allem anderen Verwandtschaftsbeziehungen, welche segmentäre Gesellschaften<br />
strukturieren. Der Begriff "Verwandtschaft" bezeichnet in diesem Zusammenhang<br />
sowohl die genealogischen Beziehungen innerhalb der Segmente als auch<br />
die schwagerschaftlichen zwischen ihnen. 33 In Jäger/Sammler-Gesellschaften scheint<br />
die Heirat eine recht formlose Angelegenheit zu sein, die keine nennenswerten Verpflichtungen<br />
nach sich zieht; ist eine Gesellschaft aber in Abstammungsgruppen, d.h.<br />
"Hälften", Clans oder Lineages, gegliedert, ruhen die Bande, welche diese in gemeinsamer<br />
Deszendenz gründenden sozialen Einheiten verbinden, vor allem in der<br />
Ehe, der dort eine zentrale Bedeutung bei der sozialen Integration zukommt. Der<br />
Zusammenhalt und die wechselseitige Durchdringung der Segmente wird nach<br />
Claude Lévi-Strauss durch das universelle, allen menschlichen Kulturen gemeinsame<br />
Inzesttabu sichergestellt. Dieses (und das mit ihm notwendig verknüpfte Exogamiegebot)<br />
zwingt die Individuen, ihre Gatten außerhalb der eigenen Abstammungsgruppe<br />
zu suchen. 34<br />
In einer Vielzahl von Gesellschaften ist die Wahl der Gatten sogar dahingehend<br />
reguliert, daß bestimmte Personen als Ehegatten entweder vorgeschrieben oder<br />
bevorzugt sind (im ersten Fall spricht man von präskriptiven, im zweiten von<br />
präferentiellen Formen). Die Clans und Lineages verbinden sich über diese präskriptiven<br />
oder präferentiellen Heiraten von Generation zu Generation stets auf die<br />
31 Im Falle der generalisierten Reziprozität ist »die Erwartung einer direkten materiellem Gegenleistung<br />
unziemlich. Sie wird höchstens stillschweigend mitgedacht. Die materielle Seite der Transaktion ist der<br />
sozialen untergeordnet: die Berechnung ausstehender Schulden kann nicht offen erfolgen und wird<br />
typischerweise außer acht gelassen. Das heißt nicht, daß die Weitergabe von Dingen in dieser Form,<br />
auch an nahestehende Personen, keine Verpflichtung erzeugt. Aber die Erwiderung wird nicht in<br />
Zeitpunkt, Menge oder Qualität bestimmt: die Erwartung der Reziprozität ist unbestimmt.« (Sahlins<br />
1972: 194)<br />
32 Für Durkheim war der Klan »eine Horde, die nicht länger unabhängig ist, um statt dessen zum<br />
Element einer erweiterten Gruppe zu werden«, er bezeichnet als »segmentäre Gesellschaften auf der<br />
Grundlage von Klanen jene Völker, die aus der Assoziation zwischen Klanen gebildet sind. Wir nennen<br />
diese Gesellschaften segmentäre, um aufzuzeigen, daß sie aus der Wiederholung von untereinander<br />
ähnlichen Aggregaten gebildet sind...« (1902: 230)<br />
33 Beide stehen in komplementärem Verhältnis zueinander (vgl. Godelier 1993: 1194f..).<br />
34 Das Inzesttabu bezieht sich aber weniger auf die biologische denn auf die durch Abstammungsregeln<br />
definierte soziale Verwandtschaft. (So sind z.B. in matrilinearen Gesellschaften die Väter und in<br />
patrilinearen Gesellschaften die Mütter nicht mit den eigenen "biologischen" Kindern verwandt!)
26 Das Universum der Gaben<br />
gleiche Art und Weise. Wenn eine Gesellschaft z.B. in drei Abstammungsgruppen<br />
gegliedert ist, kann das Muster folgendermaßen aussehen: Die Frauen aus Segment X<br />
heiraten Männer aus Segment Y, die Frauen aus Segment Y Männer aus Segment Z,<br />
die Frauen aus Segment Z Männer aus Segment X. Die Ehen werden stets auf diese<br />
Art und Weise geschlossen, und diesem Muster folgt auch der Gabentausch zwischen<br />
den Segmenten.<br />
In derartigen Gesellschaften zieht die Heirat zudem eine endlose Reihe von<br />
Verpflichtungen und Tauschakten zwischen den verbundenen Familien und sozialen<br />
Segmenten nach sich, 35 das Band der Verwandtschaft — welches der Kitt ist, der die<br />
segmentäre Gesellschaft dauerhaft zusammenhält — wird immer wieder im Transfer<br />
von Gütern und Dienstleistungen aktualisiert. 36 Die Einsicht, daß Verwandtschaftsbeziehungen<br />
die "primitive Ökonomie" durchwalten, gehört zum klassischen Korpus<br />
anthropologischer Lehren. 37 W.H.R. Rivers, einer der Väter der modernen Ethnologie,<br />
der bei seinen manchmal nur recht kurzen Begegnungen mit melanesischen<br />
Eingeborenen so viel Informationen wie irgend möglich sammeln wollte, begann das<br />
Gespräch stets mit der folgenden Frage: »Angenommen, Du hättest das Glück, eine<br />
Guinea 38 zu finden, mit wem würdest Du sie teilen?« Der oder die Befragte lieferte<br />
als Antwort üblicherweise eine Reihe von Namen, woraufhin Rivers sich diese Namen<br />
in Verwandtschaftsbezeichnungen "übersetzen" ließ. Von diesem Punkt aus<br />
konnte er sich nahezu jedem Aspekt ihrer Gesellschaft nähern (vgl. Barker 1995:<br />
118). 39 Man hat insgesamt den Eindruck, daß in den segmentären Gesellschaften<br />
verwandtschaftliche Verpflichtungen den primären Anreiz (oder Zwang) zur Produktion<br />
darstellen — wie auch die Sphäre der Produktion von derjenigen der Verwandtschaft<br />
zumindest durchdrungen, wenn nicht determiniert ist. 40 George Dalton<br />
zitiert eine Studie von Schapera und Goodwin über die Bantu, in der die Autoren<br />
zunächst das Netzwerk des obligatorischen Tauschs von Arbeit und Gütern unter<br />
35 Die <strong>Institut</strong>ion der Ehe wurzelt also nicht in gegenseitiger Liebe oder Anziehung sondern in einer<br />
gesellschaftlichen Notwendigkeit.<br />
36 Für Lévi-Strauss gründet allerdings schon die Eheschließung in einem Tausch: Frauentausch. Auf diese<br />
höchst problematische Auffassung werde ich im 3. Kapitel eingehen.<br />
37 Richard Thurnwald wies bereits sehr früh auf diese Zusammenhänge hin. 1936 schreibt er rückblickend:<br />
Eine Heiratsordnung die »durch nicht abreißende Erwiderungen des Gleichen mit Gleichem<br />
verbunden ist, lernte ich bei den Bánaro in Neu-Guinea kennen. Sie war die erste Anregung, die<br />
Bedeutung der Gegenseitigkeit zu erfassen. Die Geschenke, die bei der Hochzeit und im Zusammenhang<br />
damit nachher gegeben werden, stellen Leistungen dar, die im Geiste des künftigen Zusammenlebens<br />
die Kette von Leistungen und Gegenleistungen anzetteln. Irrtümlich wurden sie oft als "Kauf" gedeutet.<br />
Die primitiveren Formen sind sicher weit entfernt vom "Kauf" in unserem Sinne. Auf Buin<br />
(Bougainville) werden in einigen Gegenden Muschelgeldfäden von den Angehörigen des Bräutigams<br />
aufgehängt, die in gleicher Zahl und Länge von den Eltern der Braut erwidert werden.« (1936: 85)<br />
38 Antiquierte engl. Währungseinheit, £ 1,05.<br />
39 Daß ich nicht in der Lage war, diese einem Roman ("The Ghost Road" von Pat Barker) entnommene<br />
Information zu verifizieren, ändert wohl kaum etwas an ihrem illustrativen Wert.<br />
40 Genau aus diesem Sachverhalt ergeben sich nach Sahlins die großen Probleme, die Marx'schen<br />
Analysen auf segmentäre Gesellschaften zu übertragen (1976, insbes. Kap. 1 und 2).
Das Universum der Gaben 27<br />
Verwandten und "Freunden" beschreiben, um anschließend die Bedeutung dieser<br />
reziproken Tauschakte hervorzuheben:<br />
»Bei relativer Abwesenheit arbeitsteiliger Spezialisierung und daraus resultierender wirtschaftlicher<br />
Unabhängigkeit dient Verwandtschaft dazu, größeren sozialen Zusammenhalt innerhalb<br />
der Gemeinschaft zu schaffen und die Aktivitäten zu einer weitergehenderen Kooperation zu<br />
integrieren als innerhalb der Grenzen des Haushalts. Das sogenannte "kommunale System" der<br />
Bantu ist weitgehend eine Manifestation dieser engen Bande von Solidarität und Reziprozität,<br />
die aus der Verwandtschaft erwachsen und so gut wie jeden Aspekt des Alltagslebens betreffen.«<br />
(nach Dalton 1962: 72)<br />
Bronislaw Malinowski liefert in seiner berühmtem Monographie über die Trobriand-<br />
Insulaner ("Argonauten des westlichen Pazifik") ein berühmtes Beispiel <strong>für</strong> derartige,<br />
aus der Eheschließung resultierende Obligationen: Ein Trobriander muß einen<br />
Großteil seiner Yamsernte (d.h. des wichtigsten Grundnahrungsmittels) an seine<br />
weiblichen Blutsverwandten abtreten.<br />
»Diese regelmäßigen und verläßlich dargebotenen Gaben sind so ansehnlich, daß sie den<br />
Hauptteil des Einkommens eines Mannes an Lebensmitteln bilden. Soziologisch gesehen stellen<br />
sie die vielleicht stärkste Faser im Gewebe des Stammesaufbaus bei den Trobriandern dar. Sie<br />
erlegen jedem Mann die lebenslange Verpflichtung auf, <strong>für</strong> seine weiblichen Blutsverwandten<br />
und deren Familien zu arbeiten. Beginnt ein Junge mit dem Gartenbau, so tut er dies <strong>für</strong> seine<br />
Mutter. Wachsen seine Schwestern heran und heiraten, so arbeitet er <strong>für</strong> sie. Hat er weder<br />
Mutter noch Schwestern, so wird seine nächste weibliche Blutsverwandte den Ertrag seiner<br />
Arbeit beanspruchen.« (Malinowski 1922: 220f.)<br />
Ein Mann versorgt also seine Schwester und damit auch deren Gatten, während er<br />
wiederum vom Bruder seiner Ehefrau Nahrung erhält. Damit besteht keine Beziehung<br />
direkter Reziprozität zwischen den Schwägern, die Bewegung des Yams geht<br />
immer nur in eine Richtung — von einem Mann zum Gatten seiner nächsten weiblichen<br />
Verwandten —, sie beschreibt einen Kreis, der sich notwendig schließt, weil<br />
jeder Mann von einem Verwandten seiner Frau Yamswurzeln erhält. In derartigen<br />
Fällen, wo man im idealtypischen Fall empfängt, was man gab, aber nicht von demjenigen,<br />
dem man gab, spricht man von verallgemeinertem Tausch.<br />
Mit der Bewegung des Yams korrespondiert eine zweite: Wenn ein Mann<br />
stirbt, erstatten die Frauen die Yamsgaben symbolisch mit großen Mengen von Bananenblatt-Bündeln<br />
zurück, die im Gegensatz zum Yams weiblicher Reichtum sind.<br />
Immer, wenn ein Verwandter der Frau (ein Mitglied ihrer matrilinearen Abstammungsgruppe,<br />
Matrilineage) stirbt, muß sie große Mengen dieser Bündel beschaffen,<br />
die anschließend zeremoniell an die Trauernden verteilt werden. »Wenn Männer ihren<br />
Schwestern und deren Ehemännern Yams geben, schaffen sie eine Schuld, die<br />
nur in weiblichem Reichtum zurückgezahlt werden kann.« (Weiner 1988: 121) Eine<br />
Frau kann die Unterstützung ihres Gatten bei der Beschaffung der Bündel nur einfordern,<br />
weil dieser von ihrem Bruder Yamswurzeln erhielt. Umgekehrt wird ein<br />
Mann, wenn der Gatte seiner Schwester diese nicht bei der Beschaffung der Bündel<br />
unterstützt, keinen großen Yamsgarten <strong>für</strong> das Ehepaar anlegen, denn seine Gartenarbeit<br />
wird nach Weiner daran gemessen, inwieweit sie den Bedarf der Abstam-
28 Das Universum der Gaben<br />
mungsgruppe bei einem Todesfall befriedigt. Zwischen beiden Bewegungen, der des<br />
Yams und derjenigen der Bündel, besteht also eine untrennbare Verbindung, es handelt<br />
sich um zwei verallgemeinerte Tauschmuster, die in Relation zueinander gesetzt<br />
sind. 41<br />
Die vorstehenden Ausführungen sollen vorerst genügen, um die aus der Eheschließung<br />
resultierenden wechselseitigen Verpflichtungen und Abhängigkeiten zu skizzieren.<br />
Diesbezügliches ethnographisches Material liegt in Hülle und Fülle vor, da dieses<br />
aber nur den bekannten Mechanismus in einer endlichen Zahl von lokalen Variationen<br />
aufzeigt, will ich darauf verzichten es zu präsentieren; das Prinzip des Tauschs<br />
zwischen verwandtschaftlich verbundenen Segmenten sollte hinreichend deutlich<br />
geworden sein. 42 Wie jenseits der Grenzen der durch Eheschließung konstituierten,<br />
auf Exogamieregeln beruhenden Gesellschaft getauscht wird, werde ich im folgenden<br />
skizzieren.<br />
MUSCHELN UND KANUS: DER KULA-WETTSTREIT<br />
Es ist ein weiter Weg von der größten sozialen Nähe, dem Teilen unter Angehörigen<br />
einer Horde, zur größten durch die Gabe überwindbaren sozialen Distanz, dem<br />
Tausch zwischen Angehörigen unterschiedlichster Ethnien im Rahmen des wettstreitenden<br />
Tauschs oder des "primitiven Handels". Der Ruhm von Bronislaw Malinowskis<br />
Argonauten des westlichen Pazifik gründet nicht allein darin, daß dieses Buch<br />
in der Genealogie der Ethnologie als erste Feldstudie im "modernen" Sinn gilt.<br />
Marcel Mauss beeindruckte und inspirierte insbesondere die Beschreibung des berühmten<br />
Kula-Tauschs. 43 Immer noch und immer wieder ist das Kula das Beispiel<br />
<strong>für</strong> den Gabentausch, eine Leitmetapher im Bereich der ökonomischen Anthropologie,<br />
die bis zum heutigen Tage immer neue Untersuchungen und Interpretationen<br />
herausforderte. Das Kula ist, in Malinowskis Worten, eine Form des Tauschs<br />
41 Der Kausalzusammenhang zwischen Yams und Bananenblatt-Bündeln, zwischen weiblichen und<br />
männlichen Gütern ist nicht nur ein herausragendes Beispiel <strong>für</strong> die Tauschbeziehungen zwischen den<br />
durch Heirat verbundenen Segmenten; er illustriert auch, daß der Tausch mitnichten, wie es häufig<br />
scheint, reine Männersache ist. Malinowski übersah entweder die von Weiner beschriebene Praktik<br />
völlig, oder sie schien ihm bedeutungslos zu sein, "women's business", und somit nicht erwähnenswert.<br />
42 Aufgrund der fehlenden Segmentierung von Wildbeutergesellschaften, in denen sich zudem die<br />
Zusammensetzung der Horden (bzw. Lokalgruppen) von einem Tag auf den anderen ändern kann,<br />
existieren dort praktisch keine präferentiellen Heiratsmuster. Allerdings schreibt auch dort das<br />
Exogamiegebot in der Regel vor, außerhalb der eigenen Horde zu heiraten. So entstehen "offene"<br />
Verbände (wie Brian M. Fagan sie bezeichnet) »aus mehreren familienzentrierten Lokalgruppen, die sich<br />
innerhalb eines regionalen Zusammenhangs kennen und untereinander heiraten. Das Exogamiegebot ....<br />
sorgt <strong>für</strong> weitgespannte verwandtschaftliche Vernetzung, die in Notzeiten, bei Unfällen oder unter dem<br />
Zwang zu kooperativem Handeln Solidarität und soziale Geborgenheit stiftet.« (Fagan 1991: 118)<br />
43 »Außer im alten germanischen Recht [...] wird man .. schwerlich einer Praxis des Gabentauschs<br />
begegnen, die klarer, vollständiger, bewußter und zudem von dem sie aufzeichnenden Beobachter besser<br />
verstanden worden wäre als diejenige, die Malinowski auf den Trobriand-Inseln gefunden hat.« (Mauss<br />
1925: 65)
Das Universum der Gaben 29<br />
»zwischen den Stämmen eines großen Gebiets; es wird von Gemeinschaften betrieben, die einen<br />
weiten Inselring bewohnen, der einen geschlossenen Kreislauf bildet [...] Auf diesem Weg<br />
reisen beständig zwei Arten von Gegenständen und nur diese in entgegengesetzten Richtungen.<br />
Im Uhrzeigersinn wandert unablässig die eine, lange Halsketten aus roten Muscheln,<br />
"soulava" genannt. In entgegengesetzter Richtung wandert die andere Art, Armreifen aus weißen<br />
Muscheln, "mwali" genannt. Jeder dieser Gegenstände trifft auf seiner Reise in dem geschlossenen<br />
Kreislauf auf Gegenstände der anderen Art und wird ständig gegen diese getauscht.<br />
Jede Bewegung der Kula-Gegenstände, jede Einzelheit der Transaktionen ist durch<br />
eine Reihe traditioneller Regeln und Konventionen festgelegt, und einige der Handlungen des<br />
Kula werden von einem ausführlichen Ritual und von öffentlichen Zeremonien begleitet. Auf<br />
jeder Insel und in jedem Dorf nimmt eine mehr oder weniger begrenzte Anzahl von Männern<br />
am Kula teil, das heißt: nimmt Güter an, behält sie kurze Zeit und gibt sie dann weiter. Daher<br />
erhält jeder, der sich im Kula befindet, von Zeit zu Zeit, wenn auch nicht regelmäßig, eine oder<br />
mehrere mwali oder eine soulava und muß sie dann einem seiner Partner übergeben, von<br />
dem er im Austausch die entgegengesetzte Ware bekommt. Somit hält keiner irgendeinen der<br />
Gegenstände längere Zeit in seinem Besitz. Mit einer Transaktion endet die Kula-Verbindung<br />
nicht, denn die Regel lautet, "einmal im Kula, immer im Kula", und die Partnerschaft zweier<br />
Männer besteht auf Dauer, ein Leben lang. Auch geht jede vorhandene mwali oder soulava<br />
immer wieder von Hand zu Hand und wandert, und es kommt gar nicht in Frage, daß sie jemals<br />
an einem Ort bleiben könnten, so daß der Grundsatz, "einmal im Kula, immer im Kula",<br />
sich auch auf die Wertgegenstände selbst beziehen läßt.« (Malinowski 1922: 115)<br />
Um Kula treiben zu können, benötigt ein Mann (das Kula ist in aller Regel Männersache)<br />
also zumindest zwei Partner. Dem einen übergibt er einen Armreif und erhält<br />
im Austausch da<strong>für</strong> eine Halskette, die er an den zweiten Partner weiterreicht, da<strong>für</strong><br />
erhält er einen Armreif, den er wiederum dem ersten Partner aushändigt. Armreif<br />
oder Halskette müssen zwangsläufig weitergereicht werden, da ansonsten die Gabe<br />
nicht erwidert werden könnte; um eine empfangene Halskette zu vergelten, benötigt<br />
man einen Armreif, den man nur erhält, wenn man eine Halskette gibt. Dieser Zyklus<br />
ist unumkehrbar: Halsketten können nur mit Armreifen, Armreifen nur mit<br />
Halsketten vergolten werden; die Richtung, in die sie zu "reisen" haben ist festgelegt.<br />
Allein die geographische Position eines Kula-Teilnehmers bestimmt, ob er in<br />
Beziehung zu einem anderen Mann Halskettengeber oder –Nehmer, Armreifnehmer<br />
oder –Geber ist. Man hat es also auch beim Kula mit zwei (Ring–)Tauschbewegungen<br />
zu tun, die dadurch verknüpft sind, daß Halsketten und Armreife in einem<br />
Verhältnis der Entsprechung zueinander stehen.<br />
Der Tausch der Kula-Wertgegenstände (Vaygu'a genannt) stellt eine unserem<br />
Verständnis nach "ökonomisch" vollkommen sinnlose Transaktion dar — das machte<br />
ihn zu einem bevorzugten Gegenstand des wissenschaftlichen Interesses. Warum<br />
verwenden Menschen soviel Zeit und Energie darauf, setzen sogar wegen einiger<br />
Muscheln — die sie noch nicht einmal behalten dürfen, wollen sie die Regeln des<br />
Kula nicht verletzen — ihr Leben aufs Spiel? Derjenige, welcher Vaygu'a "hortet",<br />
schadet seinem Ansehen, er wird im Ruf stehen, "hart im Kula" zu sein. Wer andererseits<br />
im Ruf der Großzügigkeit steht, wird eher entsprechend wertvolle Gegenstände<br />
erhalten, sein Partner kann sich einer adäquaten Gegengabe sicher sein; dem<br />
Freigiebigen, dem Mann von Ehre, wird vertraut. »Das Grundprinzip des Moralkodex<br />
der Eingeborenen in diesen Dingen veranlaßt einen Mann ..., sich redlich an den
30 Das Universum der Gaben<br />
Kula-Transaktionen zu beteiligen, und je bedeutender er ist, desto mehr wird er sich<br />
wünschen, durch seine Großzügigkeit zu glänzen. Noblesse oblige heißt ... die soziale<br />
Norm, die ihr Verhalten bestimmt.« (Ibid.: 130)<br />
Das ist das vordergründige Paradox des Kula: die Vaygu'a sind Objekte der<br />
Begierde, die Eingeborenen betreiben großen Aufwand, um sie zu erlangen, und<br />
dennoch entgleiten ihnen diese Dinge notwendig immer wieder. Auch im Kula hat<br />
bzw. empfängt man, um zu geben. Es wäre aber ein grobes Mißverständnis, wollte<br />
man das Kula etwa als Allegorie auf die Vergänglichkeit allen menschlichen Tuns und<br />
Trachtens begreifen. »Obwohl sie nur auf bestimmte Zeit in Verwahrung genommen<br />
und niemals zu irgendwelchen Zwecken benutzt werden, vermittelt dennoch die<br />
einfache Tatsache ihres Besitzes und die damit verbundene Auszeichnung ihren Inhabern<br />
eine besondere Art von Freude.« (Ibid.: 127) Diese "Freude" gründet nicht zuletzt<br />
darin, daß sich der Name eines Mannes mit derjenigen Halskette oder dem<br />
Armreif verbindet, den er empfing und weitergab; es scheint gerade so, als würde<br />
sein Wesen sich mit dem Wertgegenstand verbinden. 44 Wie Marcel Mauss schrieb:<br />
Etwas zu geben heißt, etwas von sich zu geben (1925: 35). Ohne diesen Satz kann<br />
man gewisse zentrale Aspekte des Kula nicht begreifen. Es geht beim Kula nicht um<br />
die Anhäufung von Gütern, sondern um den Erwerb von Prestige — man macht sich<br />
einen Namen im Kula.<br />
Abbildung 2: Papua-Neuguinea und West-Melanesien<br />
44 Obschon theoretisch Schmuckstücke, sind die Wertgegenstände in dieser Funktion nur von geringem<br />
Wert, sie werden kaum jemals zu diesem Zweck verwendet (und sind auch häufig schlicht ungeeignet<br />
dazu), sondern lediglich zeremoniell zur Schau gestellt.
Das Universum der Gaben 31<br />
Das Kula-Gebiet 45 (vgl. Abbildung 2) ist derart groß, die Wege der Wertgegenstände<br />
so verschlungen (etliche Männer haben eine Vielzahl von Partnern), daß kein<br />
Teilnehmer den Kula-Ring vollkommen überblicken kann. Die direkten Partner sind<br />
persönlich bekannt, aber man weiß auch um weitere Glieder der Kette. Wie ein<br />
Trobriander über seine entfernten Partner sagt: »They never see my face, but they know<br />
my name.« (Weiner 1988: 143) Der Ruhm eines Kula-Mannes beruht auf der Verbindung<br />
seines Namens mit den wertvollsten Muscheln, die durch seine Hände wanderten<br />
— und vice versa: »So wie ein Mann Ansehen dadurch gewinnt, daß sein<br />
Name zusammen mit bestimmten Muscheln zirkuliert, gewinnen auch die Muscheln,<br />
während sie sich von einem Partner zum anderen bewegen, auf ähnlich Weise an<br />
Wert durch ihre Verbindung mit bestimmten Männern.« (Ibid.: 144) 46 Die wertvollsten<br />
Armreife und Halsketten tragen Namen, und weil sie dies tun, können sich<br />
Geschichten an sie knüpfen — in einer (vermeintlich) geschichtslosen Gesellschaft.<br />
Ich will die raison d'etre des Kula hier nicht eingehender diskutieren (ich komme darauf<br />
an späterer Stelle zurück), sondern, um ein plastischeres Bild zu liefern, kurz<br />
den Ablauf einer Kula-Expedition anhand von Malinowskis Beschreibung skizzieren.<br />
Dieser zeichnet die Reise der Kanus von Sinaketa (einem berühmten Kula-Ort im<br />
Süden der Hauptinsel des Trobriand-Archipels, Boyowa) zu den Dobu im Süden der<br />
Fergusson-Insel (die zur D'Entrecasteaux-Gruppe gehört) nach. Die Strecke beträgt<br />
ca. 70 Seemeilen, und auch wenn ständig Land in Sicht ist, also nicht "blind" navigiert<br />
werden muß, ist die Fahrt doch in jedem Fall als Wagnis anzusehen, und dies in<br />
zweifacher Hinsicht. Zum einen sind die Kanus der Trobriander nicht in der Lage,<br />
gegen den Wind zu kreuzen, sollte also dieser in unvorhergesehener Weise drehen<br />
(in der Regel sind die Windverhältnisse während der Jahreszeit, in die die Expeditionen<br />
fallen, stabil), kann eine ganze Flotte von Kanus auf Nimmerwiedersehen in den<br />
freien Ozean abgetrieben werden; die "Erzählung vom Schiffbruch" ist allgegenwärtig.<br />
Zum anderen gelten die Dobu bei ihren Nachbarn als gefährliche Kannibalen,<br />
die vermeintlich allein die Macht der Vaygu'a davon abhalten kann, über die friedfertigen<br />
Trobriander herzufallen. Die Kanus führen als Fracht einige Handelsgegenstände<br />
wie geflochtene Armbänder, Kämme, Kalktöpfe, Betelnüsse; weiterhin<br />
Nahrungsmittel, solche, die <strong>für</strong> den Verzehr auf der Reise bestimmt sind, und andere,<br />
besonders ausgewählte, die später den Kula-Partnern angeboten werden. Auf<br />
keinen Fall aber irgendwelche Kula-Wertgegenstände, die Reise dient allein dem<br />
Erwerb der Vaygu'a.<br />
45 Es bezieht Malinowski zufolge »in seinen Verästelungen nicht nur die Inseln vor der Ostspitze<br />
Neuguineas [ein], sondern auch den Louisiade-Archipel, die Insel Woodlark, die Trobriand-Inseln, und<br />
die D'Entrecasteaux-Inseln. Es reicht bis in das Inland Neuguineas hinein und übt einen indirekten<br />
Einfluß auf verschiedene andere Gebiete aus, z.B. die Rossel-Insel und einige Teile der Nord– und<br />
Südküste Neuguineas.« (Ibid.: 24)<br />
46 Auf den Trobriand-Inseln hängt die Anzahl der Kula-Partner vom Rang eines Mannes ab: »Ein<br />
Gemeiner ... wird nur wenige Partner besitzen, wohingegen ein Häuptling hunderte von ihnen hat.«<br />
(Ibid.: 124)
32 Das Universum der Gaben<br />
Die Flotte steuert zunächst die Amphlett-Inseln an, ebenfalls um Kula zu treiben. 47<br />
Dem Kula mit den Bewohnern dieser Inseln kommt aber bei weitem nicht die Bedeutung<br />
zu, die dasjenige mit den Dobu haben wird; der Besuch dient hauptsächlich<br />
dem Tausch von Handelswaren gegen Tongefäße. Die Reise geht dann weiter zu den<br />
Dobu. Kurz vor dem Ziel hält die Flotte noch einmal inne, um bestimmte Riten abzuhalten,<br />
deren wichtigstes Element die sogenannte "Schönheitsmagie" ist: sie soll<br />
den Mann unwiderstehlich machen und seinen Kula-Partner dazu bewegen, ihm die<br />
größten und schönsten Vaygu'a auszuhändigen. Der letzte Teil der Strecke wird gepaddelt,<br />
die Trobriander führen »ihre blattförmigen Paddel mit langen, energischen<br />
und raschen Schlägen, wobei sie das Wasser über sich sprühen und die glitzernden<br />
Ruderblätter in dem Sonnenlicht blitzen lassen.« (Malinowski 1922: 378) — ein<br />
wohl recht beeindruckendes Schauspiel, das dazu dient, sich Mut zu machen. Denn<br />
in den Herzen der Trobriander ist Scheu und Furcht: die Dobu sind, wie erwähnt,<br />
Kannibalen und potentielle Feinde. Tatsächlich werden die Trobriander mit zurschaugestellter<br />
Feindseligkeit empfangen, die allerdings bald völlig verschwindet.<br />
Das eigentliche Kula beginnt mit Pari genannten Eingangsgaben, welche die Trobriander<br />
ihren Partnern überreichen, »kleine Dinge, wie etwa einen Kamm, einen<br />
Kalktopf oder ein Kalkstäbchen. Darauf erwarten sie, daß man ihnen einige Kula-<br />
Gaben überreicht.« (Ibid.: 305) Die Halsketten, die Objekte der Begierde, werden<br />
bei der Übergabe kaum eines Blickes gewürdigt, weder der Gebende noch der Empfänger<br />
»schenken den Vorgängen große Beachtung; Gleichgültigkeit beim Geben und<br />
Nehmen ist die korrekte Haltung, die von den guten Sitten verlangt wird.« (Ibid.:<br />
329) Die eigentliche Transaktion ist also denkbar kurz und unspektakulär, frei von<br />
allen offen zur Schau gestellten Affekten.<br />
Wie bereits erwähnt, besteht eine Kula-Transaktion stets aus Gabe und Gegengabe,<br />
erstere wird als Vaga (Eröffnungsgabe), letztere als Yotille (Schluß– oder Ausgleichsgabe)<br />
bezeichnet. Ein Mann tritt in der Regel in das Kula ein, indem er vom<br />
Mutterbruder (oder vom Vater: dies ist in der matrilinearen Gesellschaft der Trobriander<br />
die einzige Möglichkeit eines Mannes, seinem Sohn etwas von seinem Status zu<br />
vererben) einen Armreif oder eine Halskette erhält, er verfügt damit über eine Eröffnungsgabe,<br />
mit der er eine Kula-Transaktion initiieren kann. 48 Vaga werden in<br />
47 Die Unternehmung beginnt mit dem vom Toliwaga in Auftrag gegebenen Bau eines Kanu. Der<br />
Toliwaga (wörtlich übersetzt bedeutet das "Besitzer des Kanu"; vgl. Malinowski 1922: 154) ist so etwas<br />
wie der "Expeditionsleiter", der Wortführer der Gemeinschaft, die im Kanu segeln wird: in der Regel<br />
ein Häuptling oder ein Mann von hohem Rang. Der Kanubau ist eine hochkomplizierte Angelegenheit,<br />
die mit aller zu Gebot stehenden Sorgfalt unter Beachtung der Tabus und Heranziehung verschiedener<br />
Arten von Magie durchgeführt wird. Der zeremonielle Stapellauf des Kanu ist begleitet von einer<br />
Vielzahl ritueller Handlungen, zu denen Lebensmittelverteilungen, aber auch regelrechte Regatten<br />
zählen. In diesem Zusammenhang ist vielleicht zu erwähnen, daß es auf den Trobriand-Inseln den<br />
"Beruf" des Kanubauers gibt, eines Spezialisten, der <strong>für</strong> seine Arbeit vom Toliwaga regelrecht entlohnt<br />
wird und mit der eigentlichen Kula-Gemeinschaft nichts zu tun hat.<br />
48 Malinowski schreibt nichts darüber, ob eine Eröffnungsgabe abgelehnt werden kann. Wahrscheinlich<br />
ist diese Fragestellung rein theoretischer Art, da jede Gelegenheit, in den Besitz der Vaygu'a zu
Das Universum der Gaben 33<br />
der Regel freiwillig und spontan gegeben, anläßlich des Besuchs eines (potentiellen)<br />
Kula-Partners. Die Ausgleichsgabe wird im Unterschied dazu »unter dem Druck einer<br />
bestimmten Verpflichtung gegeben. Wenn ich einem meiner Partner vor, sagen<br />
wir, einem Jahr ein Vaga gegeben habe und nun während eines Besuchs feststelle,<br />
daß er einen entsprechenden Vaygu'a besitzt, so halte ich es <strong>für</strong> seine Pflicht, ihn mir<br />
zu geben. Tut er dies nicht, bin ich zornig auf ihn, und dies aus gutem Grund.«<br />
(Ibid.: 388) Ist eine Halskette Gegengabe, hat der Empfänger zu akzeptieren, was<br />
sein Partner ihm aushändigt, die "Gleichwertigkeit" der Yotille kann niemals erzwungen<br />
werden. Trotzdem besteht bei den am Kula Teilnehmenden ein ausgeprägtes<br />
Gefühl <strong>für</strong> die Angemessenheit der Ausgleichsgabe. Und auch wenn die Ansicht,<br />
die Gegengabe sei inadäquat, dem Tauschpartner gegenüber nie konkret zum Ausdruck<br />
gebracht würde, wird sie doch in anderen Zusammenhängen artikuliert, was<br />
dem Ansehen des Partners abträglich ist. Haben die Trobriander ihre Halsketten von<br />
den Dobu erhalten, segeln sie nach einer gewissen Zeit zurück.<br />
Irgendwann werden die Dobu nach Sinaketa kommen, um Armreifen zu empfangen.<br />
Das Kula darf niemals Zug um Zug erfolgen, manchmal — vor allem bei<br />
Übersee-Transaktionen — kann zwischen Gabe und Gegengabe ein Jahr und mehr<br />
verstreichen. Hat ein Trobriander, der bei einem Dobu in der Schuld steht, es bis zu<br />
dessen Besuch nicht vermocht, eine angemessene Gegengabe in seinen Besitz zu<br />
bringen, so wird er seinem Partner eine Basi genannte "Zwischengabe" überreichen.<br />
»Eine solche Gabe ist ... keine Ausgleichsgabe <strong>für</strong> das sehr wertvolle Vaga, sondern<br />
eine Gabe, die die Lücke füllen soll.« (Ibid.: 390) Die Zwischengabe muß später<br />
durch eine kleine, gleichwertige Gabe quasi "zurückerstattet" werden. Sie symbolisiert<br />
lediglich das bestehende Schuldverhältnis und stellt so etwas wie dessen Bekräftigung<br />
dar. 49 Die Kula-Transaktion ist erst mit der angemessen Gegengabe abgeschlossen<br />
— wobei "abgeschlossen" ein rein technischer Terminus ist, denn die<br />
empfangene Gegengabe wird entweder eher früher denn später dazu genutzt, eine<br />
neue Kula-Transaktion anzubahnen, oder man schuldet sie ohnehin einem Partner<br />
auf der Gegenseite. 50 Auch wenn ihr Besitzer scheinbar frei über eine Yotille verfügen<br />
kann, werden seine Partner ungehalten sein, sollte er den Wertgegenstand "horten".<br />
Der bereits zitierte Satz "einmal im Kula, immer im Kula" bezieht sich nicht<br />
nur auf den Mann, sondern auch auf alle Vaygu'a, die sich in seinem Besitz befinden.<br />
gelangen, begierig wahrgenommen wird. Außerdem ist davon auszugehen, daß mit der Ablehnung der<br />
vaga auch die Kula-Partnerschaft erlischt.<br />
49 Das Prinzip von Gabe und gleichwertiger Gegengabe wird auch hier streng gewahrt. Die Basi sind<br />
keinesfalls eine Art "Verzugszins".<br />
50 Die überseeischen Expeditionen sind die auffälligste und spektakulärste Art von Kula-Transaktionen.<br />
Sie machen insgesamt gesehen jedoch nur einen kleinen Teil der gesamten Tauschakte aus. Kula-Partner<br />
kann der Nachbar, der Mann aus dem Nachbardorf, oder jemand aus einer entfernteren Ansiedlung sein.<br />
Wenn die Sinaketaer mit ihren Halsketten von den Dobu zurückkehren, so löst dieses eine rege Geschäftigkeit<br />
aus, und die meisten Vaygu'a werden sehr schnell an die inländischen Kula-Partner<br />
weitergereicht, denn schließlich geht es darum, nun Armreifen zu erhalten im Austausch <strong>für</strong> die<br />
mitgebrachten Halsketten, um <strong>für</strong> den Gegenbesuch der Dobu gerüstet zu sein. Doch die Grundzüge<br />
sind bei diesem "Inland-Kula" die gleichen wie bei den überseeischen Expeditionen.
34 Das Universum der Gaben<br />
Ob er verpflichtet ist, zu erwidern, oder ob man von ihm erwartet, zu geben: im<br />
Kula besitzt man die Dinge nur, um sie an einen Partner weiterzureichen, und die<br />
Vaygu'a existieren allein, um gegeben zu werden. 51<br />
"PRIMITIVER HANDEL"<br />
Wie in den vorstehenden Ausführungen bereits angedeutet, sind die Kula-<br />
Expeditionen von Handelsaktivitäten begleitet. Es wäre aber verfehlt, den Zweck<br />
des Kula darin zu sehen, daß es diesen Handel ermöglicht, eine Art "Handelsfrieden"<br />
stiftet. Wie eine Vielzahl von Beispielen belegt, bedarf der sog. "primitive Handel"<br />
nicht derartiger <strong>Institut</strong>ionen, weder in Melanesien noch anderswo.<br />
Mit der Diskussion des "primitiven Handels" habe ich mich scheinbar weit<br />
entfernt vom "eigentlichen" Gabentausch, der ausgeglichenen Reziprozität, dem<br />
Tausch von Gleichem gegen Gleiches: ein Korb Yams gegen einen Korb Yams. War<br />
das Kula noch einigermaßen erklärungsbedürftig, scheint der "primitive Handel" in<br />
direkter Linie auf den "entwickelten" Marktaustausch (auf Grundlage industrieller<br />
Produktion) zu verweisen. Deshalb mag es auch verwundern, daß ich ihn als Gabentausch<br />
klassifiziere. Aber erst der Vergleich von Austauschbeziehungen, die unter<br />
nichtkapitalistischen Bedingungen zum wechselseitigen ökonomischen Nutzen der<br />
Beteiligten betrieben werden, mit der Ökonomie "bürgerlicher" Gesellschaften ist<br />
geeignet, die Spezifika der Warenökonomie herauszuarbeiten und den allzu starren<br />
Schematismus aufzubrechen, der dem gängigen idealtypischen Vergleich von Gabe<br />
und Ware ansonsten innewohnt.<br />
Auch wenn es etliche Beispiele <strong>für</strong> den sog. "stummen Tausch" gibt, 52 bestehen<br />
"primitive" Handelsbeziehungen in der Regel zwischen Handelspartnern aus<br />
z.T. weit entfernten (und "ethnisch" verschiedenen) Gemeinwesen, die dauerhafte<br />
Kontakte pflegen. Der Handel wird zum wechselseitigen ökonomischen Nutzen der<br />
Tauschenden betrieben. Er wurzelt in erster Linie in einer regional unterschiedlichen<br />
Ressourcenverteilung und dem Bestreben oder der Notwendigkeit, sich in den<br />
Besitz knapper und begehrter Güter zu setzen. Eines ist dabei vor allem hervorzuheben:<br />
"Primitiver Handel" hat (fast) stets eine die Subsistenz lediglich ergänzende<br />
Funktion. Niemand produziert allein <strong>für</strong> den Austausch, auch wenn dieser, wie z.B.<br />
51 Es ist möglich, sich um einen bestimmten Kula-Wertgegenstand mittels einer Pokala bzw. Kaributu<br />
genannten Bittgabe zu "bewerben". Diese kann allerdings abgelehnt werden.<br />
52 Hierbei hinterlegt eine Person (oder Gruppe) an einem bestimmten Ort Güter, welche später von<br />
dem Tauschpartner begutachtet und mit einer als gleichwertig empfundenen Menge vergolten werden.<br />
Nach einer gewissen Zeit kehrt die erste Person zurück und holt die Erwiderung ab. Sind beide Seiten<br />
mit dem Tausch zufrieden, wiederholt er sich; ist das nicht der Fall, ändert man beim nächsten Mal die<br />
Quantität oder bricht die Tauschbeziehung ab. Etwas anders beschaffen ist der intertribale "Handel" bei<br />
den Nomlaki-Indianern: »Wenn Feinde sich begegnen, rufen sie einander an. Ist die Szene freundlich,<br />
kommen sie sich näher und breiten ihre Güter aus.« Bei dem folgenden Tausch wird nicht gefeilscht. Ein<br />
Mann wirft einen Gegenstand in die Mitte und einer der anderen Seite wirft etwas im Austausch da<strong>für</strong><br />
hin. (Goldschmidt nach Sahlins 1972: 220)
Das Universum der Gaben 35<br />
in Neu-Guinea und Melanesien, aufgrund der ungleichen Verteilung natürlicher Ressourcen<br />
von bemerkenswert großer Bedeutung ist. Richard Thurnwald bemerkt, der<br />
Handel bei den papuanischen Gesellschaften sei<br />
»zwar — absolut betrachtet — gering, und man kann mit Recht von geschlossener Wirtschaft<br />
... reden. Produktion und Verbrauch erschöpfen sich im wesentlichen innerhalb der Sippe.<br />
Aber doch nicht ausschließlich. Fast überall, selbst bei den primitivsten Stämmen, gibt es Dinge,<br />
die sie von auswärts beziehen und gegen eigene Erzeugnisse eintauschen. Dazu gehört nicht<br />
allein der sich über weite Strecken ausdehnende Handel mit Töpfereiprodukten von Stellen,<br />
wo Töpfererde gewonnen wird und die Technik bekannt ist, sondern auch der Handel mit Naturprodukten,<br />
wie rohen und bearbeiteten Muscheln als Schmuck, und Beilklingen nach dem<br />
Inneren, ebenso wie umgekehrt aus dem groben Schotter der Oberläufe der Flüsse die Klingen<br />
<strong>für</strong> Steinbeile geholt und nach den steinarmen Gebieten der Mittel– und Unterläufe sowie der<br />
Sumpfgebiete verhandelt werden. Auch Nahrungs– und Genußmittel spielen eine Rolle; so<br />
werden Muscheln und geräucherte Fische von der Küste nach dem Innern verhandelt, während<br />
in entgegengesetzter Richtung Tabak, Yams, Sago und Schweine gebracht werden, die man<br />
gegen Muschelschmuck in Tausch gibt. Diese Aufzählung ist keineswegs erschöpfend. Sie soll<br />
nur zur Illustrierung dienen. Der Handel ist bei den primitiven Stämmen viel erheblicher, als<br />
die doktrinäre Konstruktion ihn anzunehmen geneigt ist. Ja, wenn man die relative Armut an<br />
Gegenständen des Gebrauchs und des Genusses in Betracht zieht, wird man zu dem Ergebnis<br />
gelangen, daß er sogar mitunter einen überraschenden Prozentsatz ausmacht. Allerdings ist<br />
dieser Handel "Außenhandel", also Handel mit fremden Stämmen, gewöhnlich mit solchen,<br />
die unter anderen Naturbedingungen leben oder bei denen sich besondere Fertigkeiten, z.B.<br />
das Knüpfen von großen Fischnetzen, das Flechten von Reusen, das Knoten der Netzbeutel<br />
oder auch die Verfertigung von Pfeilen und Bogen, entwickelt haben. Hier kann man also von<br />
"lokalen Hausindustrien" sprechen, die ihre Erzeugnisse tauschen. Innerhalb der Sippe selbst<br />
erübrigt sich der Handel ebenso wie von Sippe zu Sippe im Dorfe.« (1919: 44)<br />
Die eben zitierte Passage sollte hinreichend die Vielfalt, aber auch die Beschränkungen<br />
des Handels unter "primitiven" Lebensumständen illustrieren, <strong>für</strong> den<br />
ich im folgenden einige Beispiele präsentieren will. Ich hatte oben bereits erwähnt,<br />
daß die Trobriander bei ihrer Kula-Reise nach Dobu auf den Amphlett-Inseln Station<br />
machen, um dort Tontöpfe zu tauschen. Die Amphlett-Insulaner waren zu Malinowskis<br />
Zeiten die einzigen Hersteller von Tontöpfen in weitem Umkreis. 53 Im Gegenzug<br />
<strong>für</strong> die "exportierten" Töpferwaren bezogen sie Sago, Schweine, Kokosnüsse,<br />
Betelnüsse, Taro und Yams aus diversen Richtungen und waren bei der Versorgung<br />
mit Holzgeschirr, Ebenholztöpfen <strong>für</strong> Kalk und Körben ganz auf die Trobriander<br />
angewiesen. Bei verschiedenen Gütern fungierten die Amphlett-Insulaner aufgrund<br />
ihrer vielfältigen Kontakte zudem als eine Art "Zwischenhändler".<br />
Eine ähnliche Form der lokalen Spezialisierung findet sich im Bereich des<br />
Huon-Golf (im Südwesten Neu-Guineas, siehe Abbildung 2). Das von Ian Hogbin<br />
(1951: 81-95) beschriebene Austausch-Netzwerk verbindet 54 in einem ausgedehnten<br />
53 Obwohl sich bemerkenswerterweise auf den von ihnen bewohnten Inseln nicht einmal der Ton <strong>für</strong><br />
ihre Töpferarbeit findet. Diesen mußten sie sich an der Nordküste der Fergusson-Insel beschaffen (vgl.<br />
Malinowski 1922: 317-326).<br />
54 Da die von mit zitierten Ethnographen in der Gegenwartsform über die von ihnen untersuchten<br />
Gesellschaften schreiben, tue ich es ihnen weitgehend nach, obwohl davon auszugehen ist, daß die<br />
beschriebenen Lebensweisen in keinem Fall heute noch so vorzufinden sind und von daher die
36 Das Universum der Gaben<br />
Gebiet eine Vielzahl lokal spezialisierter Gemeinwesen. Die örtlichen Variationen<br />
bei der Produktion von Nahrungsmitteln und Gebrauchsgegenständen sind nach Hogbin<br />
in den natürlichen Unterschieden in der Ressourcenverteilung begründet. Jedes<br />
einzelne Dorf oder eine Gruppe benachbarter Dörfer erzeugt einen Überschuß eines<br />
bestimmten Produkts. Zentral gelegene Gemeinwesen fungieren als Mittler bei der<br />
Verteilung der an den äußeren Enden des Golfs erzeugten Güter.<br />
Die Busama z.B. verhandeln die an der Nordküste hergestellten Matten,<br />
Schüsseln und anderen Güter nach Süden und senden die in den dortigen Dörfern<br />
hergestellten Tontöpfe nach Norden. »Denjenigen, die dazu neigen, die praktische<br />
(oder "ökonomische") Bedeutung des primitiven Handels geringzuschätzen, erteilt<br />
das Huon-Golf-Netzwerk eine heilsame Lektion.« (Sahlins 1972: 288) Im südlichen<br />
Bereich des Huon-Golf sieht sich der Landbau mit natürlichen Schwierigkeiten konfrontiert,<br />
Sago und Taro müssen aus den Distrikten von Buakap und Busama beschafft<br />
werden. Nach Hogbin könnten die Töpfer im Süden ohne diesen Handel in<br />
ihrer gegenwärtigen Umgebung nicht lange überleben (1951: 94). Gleiches gilt <strong>für</strong><br />
die Tami-Insulaner im Norden, die ebenfalls Nahrung "importieren" müssen, die sie<br />
gegen hölzerne Töpfe unterschiedlichster Größe austauschen. Fruchtbare Gebiete<br />
wie Busama "exportieren" dagegen große Mengen an Nahrungsmitteln: während sie<br />
selbst 28 Tonnen Taro im Monat verbrauchen, liefern sie bis zu 5 Tonnen an südliche<br />
Dörfer. Diese Menge reicht nach Sahlins aus, um 84 Menschen zu ernähren<br />
(1972: 288f.).<br />
Der Handel im Bereich des Huon-Golf wird in der Regel innerhalb fester Handelspartnerschaften<br />
abgewickelt. Die Handelspartner sind häufig durch Eheschließungen<br />
verbunden; ihr Handel dient auch der Pflege der guten Beziehungen zwischen ihnen<br />
und ihren Gemeinwesen. Die Spezifika dieser Art von Handelspartnerschaft, die keineswegs<br />
nur in den Gartenbaugesellschaften Melanesiens existiert, sondern auch in<br />
der Arktis, beschreibt E.S. Burch am Beispiel des Niuviq genannten Güteraustauschs<br />
bei den Innuit:<br />
»Dieser Typ von Transaktion spielte sich nur zwischen Personen ab, die in einer bestimmten,<br />
niuviriik genannten Beziehung zueinander standen, was gemeinhin mit "Handelspartner" übersetzt<br />
wird; sie waren normalerweise Mitglieder unterschiedlicher Gesellschaften. Das Wesen<br />
dieser Beziehung bestand darin, den Partner um ein spezifisches Ding zu bitten — Rohmaterial<br />
oder hergestelltes Gut — das man brauchte, woraufhin der Partner versuchte, das Bedürfnis<br />
zu befriedigen. Üblicherweise folgten die Tauschakte einem Muster. Wenn zum Beispiel eine<br />
Person weit im Hinterland lebte, konnte er ständig Fischöl benötigen, während sein Partner an<br />
der Küste vielleicht Schwierigkeiten hatte sich Bisam– oder Nerzfelle zu beschaffen.« (Burch<br />
1988: 103f.)<br />
Die Transaktionen fanden üblicherweise anläßlich von "Handelsmessen" oder Festen<br />
statt. Aber die Beziehung beinhaltete mehr als den Austausch zum wechselseitigen<br />
Nutzen. »Wenn in einem Distrikt Hungersnot herrschte, konnte jemand von einem<br />
Vergangenheitsform angemessen ist — trotz der teilweise erstaunlichen Widerständigkeit der fraglichen<br />
Gesellschaften. Eine gewisse Konfusion der Zeitformen läßt sich dennoch nicht vermeiden.
Das Universum der Gaben 37<br />
Partner, dessen Region nicht betroffen war, Hilfe erbitten und auch erwarten. Dies<br />
war in traditionellen Zeiten die Hauptform zwischengesellschaftlicher Allianz.«<br />
(Ibid: 104)<br />
Ein durchgängiges Merkmal des "primitiven Handels" scheint zu sein, daß »Partnerschaft<br />
nicht allein das Privileg, sondern auch die Pflicht zur reziproken Erwiderung<br />
[ist]. Sie beinhaltet die Verpflichtung anzunehmen ebenso wie diejenige zu erwidern.«<br />
(Sahlins 1972: 309) Am Ende einer Transaktion kann man mit einer größeren<br />
Menge eines bestimmten Gutes dastehen, als man brauchte, erwartete oder überhaupt<br />
erhalten wollte. Von einem Handelsfreund wird auch erwartet, daß er Dinge<br />
annimmt, <strong>für</strong> die er keine Verwendung hat; und er muß die "Gabe" erwidern. So<br />
nehmen die auf der Huon-Halbinsel im Osten Neu-Guineas lebenden Sio häufig Güter<br />
an, »die sie gerade nicht brauchen. Als ich einen Sio fragte, warum er vier Bögen<br />
hatte (die meisten Männer haben mehr als einen), antwortete er: "Wenn ein Busch–<br />
[d.h. Handels–]Freund mit einem Bogen kommt, mußt Du ihm helfen."« (Harding<br />
nach Ibid.) Dieser Aspekt unterscheidet die "primitiven" Handelsbeziehungen drastisch<br />
von Marktbeziehungen in westlichen Industriegesellschaften. So berichtete<br />
z.B. ein ebenfalls in Neuguinea tätiger Missionar dem Ethnographen,<br />
»daß Eingeborene, die mit ihm Handel getrieben hatten und sich nun in einer Notsituation befanden,<br />
mit Gegenständen zur Missionsstation kamen, die keinen materiellen Wert besaßen<br />
und <strong>für</strong> den Missionar nicht von Nutzen waren. Die Eingeborenen suchten diese Gegenstände<br />
gegen von ihnen benötigte Dinge zu tauschen. Nach seiner Weigerung machten ihm die Eingeborenen<br />
klar, daß sein Verhalten unredlich sei, denn aus ihrer Sicht ist er ihr Freund und sollte<br />
Dinge die er nicht benötigt annehmen um ihnen zu helfen, wenn sie Unterstützung benötigen.<br />
Sie sagten ihm: "Du kaufst unsere Nahrungsmittel, wir verkaufen Dir unsere Schweine, unsere<br />
Jungen arbeiten <strong>für</strong> Dich. Deshalb solltest Du dieses Ding kaufen, von dem Du behauptest, es<br />
nicht zu brauchen, und es ist nicht recht von Dir, Dich zu weigern, es zu erwerben."« (Gitlow<br />
nach Ibid.: 309f.)<br />
Auf die persönliche Bindung zwischen Handelspartnern verweist auch E.E. Evans-<br />
Pritchard: Wenn die im Sudan lebenden Nuer etwas von einem arabischen Händler<br />
erwerben, ist das<br />
»<strong>für</strong> sie keine unpersönliche Transaktion, und sie haben keine der unseren entsprechende Vorstellung<br />
von Preis und Währung. Ihre Vorstellung vom Kauf ist diejenige, daß man etwas einem<br />
Händler gibt, der dadurch verpflichtet ist, einem zu helfen. Zur gleichen Zeit bittet man<br />
ihn um etwas aus seinem Warenbestand, das man braucht, und er muß es geben, weil er mit<br />
Annahme der Gabe in eine wechselseitige Beziehung eintrat. Folglich bedeutet kok "kaufen"<br />
oder "verkaufen". Beide Handlungen sind Ausdruck einer einzigen Beziehung der Reziprozität.<br />
Da ein arabischer Händler die Transaktion anders wahrnimmt, tauchen Mißverständnisse auf.<br />
Aus der Perspektive der Nuer geht es bei einer derartigen Transaktion eher um ein Verhältnis<br />
zwischen Personen als zwischen Dingen. Mehr als seine Güter ist es der Händler, welcher "gekauft"<br />
wird.« (Evans-Pritchard 1956: 223f.)<br />
Damit sollte auch deutlich geworden sein, warum ich den "primitiven Handel" als<br />
Gabentausch klassifiziere. Wie Elizabeth Cashdan bemerkt, ist es »sowohl auf der<br />
theoretischen als auch der empirischen Ebene schwierig, eine klare Unterscheidung
38 Das Universum der Gaben<br />
zwischen Gabentausch und Handel zu treffen. In den meisten Fällen wird der Austausch<br />
sowohl wegen der Güter selbst als auch wegen der zwischen den Tauschpartnern<br />
gepflegten sozialen Beziehung geschätzt.« (1989: 43)<br />
Der "primitive Handel" wird häufig über Zwischenglieder abgewickelt, wie das Beispiel<br />
des Huon-Golf bereits zeigte. Dort allerdings ziehen die Zwischenhändler keinen<br />
zusätzlichen Nutzen aus ihrer Funktion, die Tauschraten sind im gesamten Bereich<br />
des Netzwerks uniform. Anders verhält es sich bei den Berg-Arapesh in Neuguinea.<br />
Diese sind, was ihre Werkzeuge, Waffen und Kochutensilien angeht, gänzlich<br />
auf den Import angewiesen. Sie erzeugen aber weder einen Überschuß an Nahrungsmitteln<br />
noch gibt es bei ihnen spezialisierte "Handwerker", deren Produkte in<br />
den Tausch eingehen könnten. Deshalb sind Handelsreisen ihre einzige Möglichkeit,<br />
sich die benötigten Güter zu beschaffen: Ein Mann aus den Bergen unternimmt z.B.<br />
eine eintägige Reise in eine Richtung, empfängt von einem Handelspartner ein lokales<br />
Erzeugnis als Gabe, reist zwei Tage in die entgegengesetzte Richtung und präsentiert<br />
die empfangenen Güter, die dort selten sind und folglich hohen Wert haben,<br />
einem Handelsfreund. Mit der Gegengabe kehrt er zu dem ersten Handelspartner<br />
zurück, der denjenigen Teil davon erhält, der ihm als angemessene Erwiderung seiner<br />
ursprünglichen Gabe gilt. Der verbleibende Rest ist sein Ertrag. Bei ihren Reisen<br />
bewegen sich die Arapesh durch fremdes Territorium auf Pfaden, die sie kraft eines<br />
erblichen "Wegerechts" nutzen und deren Sicherheit jeweils von ihrem Handelspartner,<br />
den sie "Bruder" nennen, gewährleistet wird (Mead 1937a: 21f.)<br />
Auch bei den Arapesh hat der Handel nur eine die Subsistenz ergänzende<br />
Funktion. Andere "primitive" Gesellschaften Melanesiens bestreiten hingegen ihren<br />
gesamten Lebensunterhalt mit dem Handel. Diese Gruppen leben inmitten einer<br />
großen Zahl Gartenbau treibender Gesellschaften, von denen einige auf die Herstellung<br />
bestimmter Güter spezialisiert sind. Sie bewohnen häufig Plattformen innerhalb<br />
irgendeiner Lagune, und verfügen über kein bebaubares Land oder andere nennenswerte<br />
Ressourcen, mit Ausnahme derjenigen, welche ihnen die See liefert. Ihnen<br />
fehlen sogar das Holz zum Kanubau und die Fasern <strong>für</strong> ihre Fischnetze. Dennoch sind<br />
diese Händler üblicherweise die "reichsten" Menschen in ihrer Umgebung.<br />
Die von Thomas Harding (1967) untersuchten, im Bereich der Vitiaz-Straße<br />
(im Westen Neuguineas, siehe Abbildung 2) lebenden Siassi z.B. verfügen nur über<br />
1/300 des Landes im Umboi-Subdistrikt, aber sie stellten 1967 ein Viertel der Bevölkerung.<br />
(Ibid: 119) Ihr "Reichtum" resultiert aus dem Handel mit umliegenden<br />
Dörfern und Inseln:<br />
»Die Siassi tauschten regelmäßig Fisch gegen Wurzelgemüse mit den benachbarten Dörfern auf<br />
Umboi; sie waren <strong>für</strong> viele Menschen in der Vitiaz-Region die einzigen Lieferanten <strong>für</strong> Töpferwaren,<br />
die sie von den wenigen Herstellungsorten im nördlichen Neuguinea heranschafften.<br />
Auf gleiche Art und Weise kontrollierten sie die Distribution von Obsidian ... Aber wenigstens<br />
ebenso bedeutsam war die Tatsache, daß die Siassi <strong>für</strong> ihre Handelspartner eine ... exklusive<br />
Quelle von matrimonalen und Prestigegütern waren — Dingen wie gewundene Eberhauer,<br />
Hundezähne und Holzschalen. In den benachbarten Gegenden Neuguineas, Neu-Britanniens
Das Universum der Gaben 39<br />
oder auf Umboi konnte ein Mann ohne vorherigen direkten oder indirekten Handel mit den<br />
Siassi keine Frau nehmen.« (Sahlins 1972: 284)<br />
Die Siassi verbanden mit ihren Handelsreisen Gemeinwesen, die keinen unmittelbaren<br />
Kontakt zueinander hatten, ihr Handel war daher "konkurrenzlos". »Den<br />
Mangel an Kommunikation zwischen entfernten Gemeinwesen ausnutzend, und stets<br />
den Blick auf eine Verbesserung der Tauschraten gerichtet, gefielen sich die Siassi in<br />
traditionellen Zeiten darin, phantastische Geschichten über die Ursprünge der von<br />
ihnen beförderten Güter zu verbreiten.« (Ibid., vgl. auch Harding 1967: 139f.) 55<br />
Die Handelsbeziehungen der Siassi waren relativ "unpersönlich" im Vergleich zu anderen<br />
Formen "primitiver" Handelspartnerschaften. Wenngleich die Transaktionen<br />
sich an mehr oder weniger feststehenden Tauschraten orientierten und innerhalb<br />
feststehender Partnerschaften, d.h. zwischen "Handelsfreunden", abgewickelt wurden,<br />
versuchten die Siassi — sicher in ihrer Position als Mittelsmänner und <strong>für</strong> ihre<br />
"Freunde", denen gegenüber sie sich nicht unbedingt entgegenkommend zeigen<br />
mußten, unentbehrlich — im gegebenen Rahmen soviel wie möglich aus dem Handel<br />
herauszuschlagen. 56 So konnten sie ein Dutzend Kokosnüsse in ein Schwein und<br />
dieses Schwein wiederum in 5 Schweine "verwandeln". 57<br />
Tauschsysteme wie das von den Siassi betriebene, bei denen der "primitive<br />
Händler" seinen Lebensunterhalt vor allem aus dem Ertrag des Handels bestreitet,<br />
stellen unter "primitiven" Lebensumständen allerdings eine Besonderheit dar, die in<br />
dieser Form nur in Melanesien aufzufinden ist, sie sind eine seltene Ausnahme und<br />
nicht die Regel. Man sollte auch die Ähnlichkeiten zu "modernen" Formen des Austauschs<br />
nicht überbewerten, da die Transaktionen innerhalb fester Partnerschaften<br />
abgewickelt wurden, existierte kein preisbildender Markt <strong>für</strong> die gehandelten Güter.<br />
Wie das Beispiel der Innuit bereits andeutete, wäre es verfehlt, den Aufbau von<br />
Handelsbeziehungen als Privileg oder Errungenschaft seßhafter Gartenbau-Gesellschaften<br />
betrachten zu wollen. Der "primitive Handel" ist ein nahezu universelles<br />
Phänomen, und Tauschbeziehungen zum wechselseitigen Nutzen bestanden bereits<br />
in grauer Vorzeit. 58 Ich will mich hier nur auf ein Beispiel beschränken, die norda-<br />
55 In diesen Geschichten übertrieben die Siassi vor allem die Anstrengungen bei der Herstellung dieser<br />
Dinge, »dem örtlichen Prinzip folgend, wonach "big-fella work" "big-fella pay" wert ist.« (Sahlins 1972:<br />
285)<br />
56 Um ihre Monopolstellung abzusichern, gingen die auf den Admiralitäts-Inseln ansässigen Manu so<br />
weit, andere Gruppen in ihrer Umgebung davon abzuhalten, seetüchtige Kanus zu besitzen oder zu<br />
unterhalten. Gelegentlich hatten sie Zusammenstöße mit einer anderen Gruppe von Händlern (Mead<br />
1937b: 210).<br />
57 Und sich vielleicht <strong>für</strong> 4 Schweine Yams verschaffen, der <strong>für</strong> ein halbes Jahr als Nahrung ausreichte,<br />
um dann mit dem verbliebenen Schwein den Zyklus neu zu beginnen.<br />
58 Der Grad der lokalen Spezialisierungen und der Umfang des in diesen gründenden Handels ist<br />
allerdings in Melanesien außerordentlich hoch (vgl. Harding 1967: 238f). Harding führt drei Gründe<br />
da<strong>für</strong> an, daß sich ausgerechnet in Melanesien derartige Systeme entwickeln konnten: Erstens finden sich<br />
auf engstem Raum die unterschiedlichsten Umweltbedingungen. Die vom Handel zu überwindenden<br />
Distanzen sind also relativ gering. Zweitens erreichten die Austronesisch sprechenden Kolonisten (die<br />
Träger der melanesischen Kultur) ihren Siedlungsraum über den Seeweg — in womöglich genau jenen
40 Das Universum der Gaben<br />
merikanische Clovis-Kultur (die auf ein Alter von 11 bis 12 Jahrtausenden datiert<br />
und damit die früheste dokumentierte amerikanische Kultur ist). Brian M. Fagan<br />
schreibt über deren Austauschbeziehungen: »Als Ausgangsmaterial der Werkzeugherstellung<br />
dienten wertvolle, feinkörnige Gesteinsarten, die oft aus gehöriger Distanz<br />
beschafft werden mußten. [...] Vom Canadian River in Texas importierte man<br />
gebänderten Kalksinter (Onyx-Marmor). Durchscheinender, dunkelbrauner Jaspis<br />
kam aus dem Tal des Knife River in North Dakota und Manitoba; andere feinkristalline<br />
Quarze (Chalzedone) wurden in Ohio gefördert.« (1991: 83f.) Im östlichen<br />
Waldland Nordamerikas erreichte der Austausch von feinkörnigem Gestein (Achate,<br />
Hornstein, Feuerstein) damals »Dimensionen, an die man erst 8000 Jahre später, zur<br />
Zeit der Hopewell-Kultur, wieder anknüpfen konnte.« (Ibid.: 112) Auch <strong>für</strong> die<br />
Clovis-Leute dürfte gelten, was Fagan über die wenig später auftauchenden paläoindianischen<br />
Kulturen schreibt: »Weitverzweigte Verwandtschaftsbande und Heiratsbündnisse<br />
bildeten den Schlüssel zu hunderte von Kilometern entfernten Rohstoffen,<br />
die von Gruppe zu Gruppe weitergetragen wurden.« (Ibid.: 119) Vielleicht<br />
waren Feste, an denen die einzelnen verbundenen Horden dieser vor zehntausend<br />
Jahren lebenden Großwildjäger zusammentrafen, Anlaß <strong>für</strong> Tauschhandel ebenso<br />
wie <strong>für</strong> Eheschließungen (vgl. Ibid.: 103) Dieser "Handel" ebbte in dem Maße ab,<br />
wie die Menschen lernten (bzw. aufgrund großräumiger ökologischer Veränderungen,<br />
die ihnen eine andere Lebensweise aufzwang und ihren Radius beschränkte,<br />
lernen mußten), die Ressourcen in denjenigen Gebieten, in denen sie sich<br />
bewegten, intensiver zu nutzen. Das vorstehende Beispiel zeigt auch, daß derartige<br />
Austauschbeziehungen weit entfernt davon sind zur Triebfeder der gesellschaftlichen<br />
Entwicklung zu werden. Diese Aussage dürfte gleichermaßen <strong>für</strong> alle Formen des<br />
"primitiven Handels" gelten: Sie sind die den jeweiligen Gesellschaften angemessenen<br />
Formen des Austauschs und transformieren diese nicht aus sich heraus —<br />
zumindest nicht zwangsläufig. Es ist wichtig, angesichts einiger vordergründiger<br />
Strukturhomologien zwischen "primitivem Handel" einerseits und Warenökonomie<br />
andererseits auf die zentralen Differenzen zu verweisen: "Primitive Spezialisten" sind<br />
keine Lohnarbeiter, Kauri-Muscheln kein Geld, die Anhäufung von Reichtümern<br />
keine Akkumulation, "primitive Handelsgüter" keine Waren. 59<br />
Diese Ausführungen sollen als Basis <strong>für</strong> die in den folgenden Kapiteln entfaltete Diskussion<br />
zunächst genügen. Auch in den sog. "primitiven" Gesellschaften spielt der<br />
Austausch von Gütern und Dienstleistungen eine zentrale Rolle im gesellschaftlichen<br />
Leben, dies galt es vor allem herauszustellen. Die vorstehend präsentierten ethno-<br />
Auslegerkanus, mit denen der Großteil des Handels abgewickelt wird, und ohne die er in seiner<br />
spezifischen Form als Überseehandel gar nicht möglich wäre. Drittens war der melanesische Raum<br />
bereits bewohnt, als die austronesische Besiedlung einsetzte, weshalb die Siedler sich mit Plätzen<br />
begnügen mußten, die keine optimalen Lebensbedingungen boten, da es ihnen an bestimmten<br />
Ressourcen mangelte (Ibid.: 239ff.)<br />
59 Ich werde im 6. Kapitel detaillierter auf die Differenzen zwischen dem "primitiven Handel" und<br />
der Marktökonomie eingehen und will es deshalb hier bei dieser Bemerkung belassen.
Das Universum der Gaben 41<br />
graphischen Beispiele sollten darüber hinaus bereits hinreichend deutlich gemacht<br />
haben, wie vielfältig die Tauschverhältnisse auch unter vermeintlich "primitiven"<br />
Verhältnissen sein können — auf diesen Sachverhalt werde ich an späterer Stelle zurückkommen.<br />
Zunächst werde ich mich im folgenden Kapitel aber mit der gesellschaftlichen<br />
Funktion des "phänotypischen" Gabentauschs befassen, d.h. des Tauschs<br />
von Gleichem gegen Gleiches, da dieser aus der Perspektive der modernen Marktökonomie<br />
am erklärungsbedürftigsten ist.
2. Kapitel<br />
VERZICHT UND BEGEHREN<br />
Während Sinn und Zweck des Tauschs beim "primitiven Handel" (der direkt auf<br />
"entwickeltere" Formen von Arbeitsteilung und Austausch zu verweisen scheint)<br />
vermeintlich unmittelbar einsichtig sind, ist zumindest der Tausch von Gleichem gegen<br />
Gleiches zwischen den durch Eheschließung verbundenen sozialen Segmenten<br />
einigermaßen erklärungsbedürftig. »Warum sollte man einen Korb voller Früchte<br />
oder Gemüse geben, wenn jedermann praktisch die gleiche Menge besitzt und die<br />
gleichen Mittel, sie sich zu beschaffen? Warum sie zum Geschenk machen, wenn dieses<br />
nicht anders als in derselben Form erwidert werden kann?« (Malinowski 1922:<br />
209) Dieses "warum sollte man?" betrifft zwei unterschiedliche, <strong>für</strong> das Verständnis<br />
des Gabentauschs jeweils zentrale Ebenen, eine "soziologische" und eine "psychologische".<br />
Im ersten Fall geht es um den gesellschaftlichen Zweck der <strong>Institut</strong>ion, 60<br />
im zweiten darum, warum der einzelne tauscht bzw. gibt, wenn er keinen direkten<br />
ökonomischen "Nutzen" aus dieser Transaktion ziehen kann. Mit eben dieser doppelten<br />
Fragestellung befaßte sich Marcel Mauss in seinem berühmten Essai sur le don,<br />
weshalb ich zunächst diesem Text folgen will. 61<br />
NORM VERSUS INTERESSE<br />
Mauss' Auseinandersetzung mit dem Gabentausch ist eine direkte Fortführung der<br />
<strong>Soziologie</strong> Émile Durkheims. Deren Gegenstand war primär die »Beziehung zwischen<br />
der individuellen Persönlichkeit und der sozialen Solidarität« (Durkheim<br />
1902: 82), d.h. das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft. Durkheims Denken<br />
kreiste um die Frage, was die Gesellschaft in ihrem Innersten zusammenhält; er war<br />
60 "<strong>Institut</strong>ion" meint hier und im folgenden Verhaltensvorschriften, die das Handeln der Individuen<br />
einer Gruppe normativ bestimmen. »Im Minimum ist eine <strong>Institut</strong>ion lediglich eine Konvention.«<br />
(Douglas 1986: 80) Diese Begriffsverwendung geht auf Durkheim zurück; nach diesem kann man, »ohne<br />
den Sinn des Ausdrucks zu entstellen, alle Glaubensvorstellungen und durch die Gesellschaft<br />
festgesetzten Verhaltensweisen <strong>Institut</strong>ionen nennen; die <strong>Soziologie</strong> kann ... definiert werden als die<br />
Wissenschaft von den <strong>Institut</strong>ionen, deren Entstehung und Wirkungsart.« (Durkheim 1901: 99f.)<br />
61 Diese doppelte Ausrichtung geht zurück auf Durkheims "Bestimmung der moralischen Tatsache"<br />
(1906) und auf Mauss' Konzept der totalen soziale Tatsache (fait social total), welches von Durkheims<br />
"sozialer Tatsache" herleitet. Wie Evans-Pritchard in seinem Vorwort zur englischen Ausgabe des Essai<br />
schreibt, ist der Gabentausch »eine totale gesellschaftliche Tätigkeit. Er ist zur gleichen Zeit ein<br />
ökonomisches, juristisches, moralisches, ästhetisches, religiöses, mythologisches und sozio-morphologisches<br />
Phänomen. Seine Bedeutung können wir deshalb nur erfassen, wenn wir ihn als eine<br />
konkrete, komplexe Realität sehen.« (in Mauss 1925: 10) Nicht nur muß man eine <strong>Institut</strong>ion auf der<br />
eigentlichen soziologischen Ebene in ihren unterschiedlichen Facetten erfassen, man muß auch aufzeigen,<br />
wie sie sich in unterschiedlichen Gesellschaften (d.h. auch im historischen Wandel) formiert, wie sie<br />
schließlich auf die Individuen einwirkt und sich in ihren Vorstellungen manifestiert. »Das Gegebene ist<br />
Rom oder Athen oder der durchschnittliche Franzose, der Melanesier dieser oder jener Insel, nicht aber<br />
das Gebet oder das Recht als solche. Nachdem die Soziologen gezwungenermaßen etwas zuviel analysiert<br />
und abstrahiert haben, sollten sie sich nun bemühen, das Ganze wieder zusammenzusetzen.«<br />
(Mauss 1925: 178)
Verzicht und Begehren 43<br />
auf der Suche nach dem "sozialen Band" (lien social), welches die Menschen aneinander<br />
bindet und Gesellschaft dauerhaft ermöglicht. Durkheim wies diesbezüglich<br />
die Behauptung entschieden zurück, das soziale Band gründe im interessegeleiteten<br />
(ökonomischen) Handeln der Individuen — was in etwa die Quintessenz der u.a. auf<br />
Adam Smith zurückgehenden individualistisch-utilitaristischen Sozialtheorie ist.<br />
Wie schon bei Thomas Hobbes, der die berühmte These vom ursprünglichen<br />
"Krieg aller gegen alle" vertrat, steht bei Smith am Urgrund seiner Reflexionen das<br />
eigennützige Streben der Individuen. 62 Im Unterschied zu Hobbes ist Smith allerdings<br />
nicht der Ansicht, daß es einer externen Macht, eines "Leviathan" bedarf, um<br />
ein friedfertiges Zusammenleben der eigennützigen Individuen zu gewährleisten; im<br />
Gegenteil, »es kommt ... nicht zum Krieg aller gegen alle, weil das Eigennutzstreben<br />
den einzelnen gerade zu solchen Handlungen motivieren kann, die dem Interesse anderer<br />
nicht nur nicht abträglich sind, sondern es im Gegenteil sogar fördern. Die Erzielung<br />
solcher gegenseitiger Interessenvorteile sieht Smith durch den Tausch ermöglicht.«<br />
(Görlich 1992: 22) Warenaustausch auf Basis arbeitsteiliger Produktion<br />
wohlgemerkt. Die ökonomische Entwicklung ist demnach im »Bemühen des Menschen<br />
verankert, seine materielle und soziale Lage zu verbessern. Obwohl er dabei<br />
nur seine eigenen Interessen verfolgt, trägt er aber wie durch eine unsichtbare Hand<br />
geleitet, zur Erhöhung des Allgemeinwohls ... bei. Einem Zweck, den er in keiner<br />
Weise beabsichtigt hatte.« (Ibid.: 24) In dieser Lesart bilden sich <strong>Institut</strong>ionen als<br />
nicht intendierte aber gleichwohl nützliche soziale Konsequenzen individuellen Handelns<br />
heraus, "the result of human action but not of human design" (Ferguson). 63<br />
Durkheim war dagegen der Ansicht, daß nutzenorientierte Tauschakte zwar<br />
zu kurzfristigen Kooperationen führen konnten, nicht aber zur langfristigen Integration<br />
der Gesellschaft, solange sie einer "moralischen Basis" entbehrten. Wie Hobbes<br />
hielt Durkheim die Existenz einer ausschließlich im individuellen Interesse gründenden<br />
sozialen Ordnung <strong>für</strong> nicht möglich:<br />
62 Begrifflich sind bei Smith an Stelle der (unterschiedlichen und gleichwertigen) Hobbes'schen "Leidenschaften"<br />
Interessen getreten, die ihren Ursprung im Streben nach materiellem Wohlergehen haben.<br />
63 »Die theoretische Idee, die Smith mit dem Kürzel "unsichtbare Hand" bezeichnet, ist zentraler<br />
Bestandteil der explanativen Logik des individualistisch-utilitaristischen Ansatzes. Bereits Mandeville<br />
hatte in seiner satirischen Bienenfabel über die öffentlichen Vorteile privater Laster (The Fable of the<br />
Bees, 1714) diese Idee publik gemacht, bevor sie dann von der schottischen Schule der<br />
Moralphilosophie, zu der neben Hume und Ferguson auch Smith gehörte, systematisch ausgearbeitet<br />
wurde. Während bei Hobbes der Vertrag als Argumentationsfigur im Vordergrund steht, betonen die<br />
Schotten den Gedanken der organischen, unbewußten Entwicklung. Soziale Muster und Einrichtungen<br />
bilden sich allmählich heraus als die unintendierten sozialen Konsequenzen individuellen Handelns. [...]<br />
Ähnlich wie die Sprache haben sie sich unter bestimmten Bedingungen ohne bewußte Vereinbarung oder<br />
Planung in einem Prozeß entwickelt, in den die separaten und die aufeinander bezogenen Handlungen<br />
vieler Individuen eingehen. Es ist klar, daß die "unsichtbare Hand" dabei nicht als Metapher <strong>für</strong> eine<br />
Macht steht, welche die Menschen zwingt oder anleitet, bestimmte Handlungen auszuführen, sondern<br />
da<strong>für</strong>, daß soziale Phänomene als das unintendierte Ergebnis eigeninteressierter Bestrebungen erklärt<br />
werden können; obwohl es so scheint, als seien sie das Ergebnis eines "planvollen Entwurfs", weil sie<br />
eine wohlgeordnete Struktur aufweisen oder eine allgemein positiv bewertete Funktion ausüben.«<br />
(Ibid.: 24f.)
44 Verzicht und Begehren<br />
»Wenn das Interesse die Individuen auch näher bringt, so doch nur <strong>für</strong> einige Augenblicke; es<br />
kann aber zwischen ihnen nur ein äußerliches Band knüpfen. Im Tausch selbst bleiben die verschiedenen<br />
Träger außerhalb einander und jeder bleibt derselbe und zur Gänze Herr über sich,<br />
wenn das Geschäft beendet ist. Ihr Bewußtsein berührt sich nur oberflächlich, durchdringt einander<br />
nicht, noch verbindet es sich. Wenn man tiefer schaut, dann sieht man, daß jede Interessenharmonie<br />
einen schlummernden oder einfach vertagten Konflikt verdeckt. Wo aber das<br />
Interesse allein regiert, ist jedes Ich, da nichts die einander gegenüberstehenden Egoismen<br />
bremst, mit jedem anderen auf Kriegsfuß, und kein Waffenstillstand kann diese ewige Feindschaft<br />
auf längere Zeit unterbrechen. Das Interesse ist in der Tat das am wenigsten Beständige<br />
auf der Welt. Heute nützt es mir, mich mit ihnen zu verbinden; morgen macht mich derselbe<br />
Grund zu ihrem Feind. Eine derartige Ursache kann nur zu vorübergehenden Annäherungen<br />
und zu flüchtigen Verbindungen führen.« (1902: 259f.)<br />
Eine Gesellschaftsordnung, die allein auf das freie Spiel der Kräfte und rein individuelle<br />
Interessen aufbaut, kann nach Durkheim keinen Bestand haben; die Ansammlung<br />
aus "rationalen", nur ihren partikularen Interessen folgenden Individuen, auf welche<br />
die Utilitaristen rekurrieren, führte seiner Ansicht nach lediglich zum Krieg aller gegen<br />
alle (bzw. könnte diesen niemals überwinden), nicht zur geordneten, befriedeten<br />
Gesellschaft. 64 Durkheim stellt die (rhetorische) Frage, wie Menschen ohne die<br />
vorgängige Gewißheit (oder das Vertrauen), daß jeder sich an seine vertraglichen<br />
Verpflichtungen halten wird, jemals zu einer auf Kontrakten basierenden Gesellschaft<br />
gelangen konnten. Unter den Bedingungen, auf welche die utilitaristischindividualistische<br />
Sozialtheorie rekurriert, wären demnach keine vertraglichen Beziehungen<br />
möglich. 65 Vertragsabschlüsse und daraus resultierende friedfertige Transaktionen<br />
sind aber ganz offenkundig möglich, sie durchdringen unserer gesamtes<br />
wirtschaftliches und gesellschaftliches Leben. Wenn die Bedingung ihrer Möglichkeit<br />
aber weder das individuelle Interesse noch eine die Vertragserfüllung erzwingende<br />
Zentralinstanz ist, 66 auf welcher Grundlage können sie dann realisiert werden?<br />
Durkheim postulierte in diesem Zusammenhang prä– oder nichtkontraktuelle Ele-<br />
64 Vgl. Müller/Schmid 1987: 495. Durkheim lehnte allerdings den von Hobbes im Leviathan<br />
beschrieben Gründungsakt — kollektive Preisgabe des Rechts auf individuelle Gewaltausübung und<br />
Unterwerfung unter das Gewaltmonopol des Souveräns — als individualistisches Konstrukt ab (vgl.<br />
Lukes 1973: 287f.).<br />
65 »Die utilitaristische These, wonach die Arbeitsteilung die Produktivität erhöhe und eben deshalb<br />
realisiert werde, kontert [Durkheim] mit dem Hinweis, daß derartige Einsichten im vorhinein kaum zu<br />
gewinnen sind.« (Müller/Schmid 1987: 497) Vor allem wehrt er sich gegen die derartigen<br />
Überlegungen zugrundeliegende utilitaristische These, wonach der Ursprung der Arbeitsteilung<br />
»ausschließlich in dem Wunsch des Menschen [liegt], sein Glück ständig zu vermehren.« (Durkheim<br />
1902: 289) Wenn das Glück mit der Produktivität der Arbeit wächst, »so müßte es desgleichen unendlich<br />
anwachsen können, oder zum mindesten müßte der Zuwachs, zu dem es fähig wäre, dem der<br />
Arbeitsproduktivität proportional sein. Wenn das Glück in dem Maße zunähme, in dem die angenehmen<br />
Anregungen zahlreicher und intensiver werden, dann wäre es ganz natürlich, daß der Mensch immer<br />
mehr zu produzieren suchte, um immer mehr zu genießen. In Wirklichkeit ist aber unser<br />
Glücksvermögen sehr beschränkt.« (Ibid.: 291) Wir produzieren tatsächlich immer mehr, um immer<br />
mehr zu genießen — und werden dabei doch schwerlich immer glücklicher.<br />
66 Was Durkheim mit Smith verbindet ist die Zurückweisung der von Hobbes postulierten<br />
Notwendigkeit einer machtvollen Zentralinstanz, welche die Menschen zwingt, ihren Verpflichtungen<br />
nachzukommen. In den von Durkheim untersuchten segmentären Gesellschaften war eine derartige<br />
Instanz offensichtlich nicht vorhanden, und dennoch herrschte bei ihnen kein Krieg aller gegen alle.
Verzicht und Begehren 45<br />
mente, die in jedem Vertrag implizit enthalten sind. Für ihn waren es diese universellen<br />
moralischen Grundlagen der vertraglichen Beziehungen, die das Wesen der<br />
"organischen Solidarität" ausmachen und eine arbeitsteilige Sozialorganisation überhaupt<br />
erst ermöglichen. Der Vertrag genügt sich also nicht selbst, »er ist nur möglich,<br />
dank einer Reglementierung des Vertrages, die sozialen Ursprung ist.« (Ibid.:<br />
272) 67<br />
Hier knüpft der Essai sur le don an. Auch Mauss versucht, über das Studium der<br />
segmentären Gesellschaften zu verallgemeinerbaren Schlußfolgerungen zu gelangen,<br />
die sowohl den Übergang von der "mechanischen" zur "organischen" Solidarität als<br />
auch die Fundamente des gesellschaftlichen Lebens schlechthin betreffen. Sein Anknüpfungspunkt<br />
ist die zur Zeit der Entstehung des Essai relativ neue Erkenntnis, daß<br />
auch die segmentären Gesellschaften von einem beständigen Geben und Nehmen<br />
durchdrungen sind; Tauschbeziehungen, denen kein expliziter Vertrag (und auch<br />
kein individuelles ökonomisches Interesse), sondern eine unbedingte moralische<br />
Verpflichtung zugrunde liegt.<br />
»In den Wirtschafts– und Rechtsordnungen, die den unseren vorausgegangen sind, begegnet<br />
man fast niemals dem einfachen Austausch von Gütern, Reichtümern und Produkten im Rahmen<br />
eines zwischen Individuen abgeschlossenen Handels. Zunächst einmal sind es nicht Individuen,<br />
sondern Kollektive, die sich gegenseitig verpflichten, die austauschen und kontrahieren;<br />
die am Vertrag beteiligten Personen sind moralische Personen: Clans, Stämme, Familien, die<br />
einander gegenübertreten, seis als Gruppen auf dem Terrain selbst, seis durch die Vermittlung<br />
ihrer Häuptlinge, oder auch auf beide Weisen zugleich. Zum anderen ist das, was ausgetauscht<br />
wird, nicht ausschließlich Güter und Reichtümer, bewegliche und unbewegliche Habe, wirtschaftlich<br />
nützliche Dinge. Es sind vor allem Höflichkeiten, Festessen, Rituale, Militärdienste,<br />
Frauen, Kinder, Tänze, Feste, Märkte, bei denen der Handel nur ein Moment und der Umlauf<br />
der Reichtümer nur eine Seite eines weit allgemeineren und weit beständigeren Vertrags ist.«<br />
(1925: 21f.)<br />
Die vorstehende Passage vermittelt einen Eindruck dessen, was Mauss mit dem<br />
Terminus »System der totalen Leistungen« (Ibid.: 22) bezeichnet: ein System, welches<br />
dadurch gekennzeichnet ist, daß die beteiligten Gruppen durch einem unaufhörlichen<br />
Austausch verbunden sind, sich "wechselseitig durchdringen" — einer unbedingten<br />
Obligation folgend. 68 Auch wenn die einzelnen Tauschakte als freiwillige<br />
erscheinen, so stehen sie doch nicht im Belieben der Individuen, diese sind verpflichtet,<br />
zu tauschen, was heißt: zu geben (bzw. anzubieten), anzunehmen und zu<br />
erwidern.<br />
»Material, das die Pflicht des Nehmens betrifft, ist ohne Mühe in großer Anzahl zu finden. Ein<br />
Clan, eine Hausgemeinschaft oder ein Gast hat nicht die Freiheit, Gastfreundschaft nicht in Anspruch<br />
zu nehmen, Geschenke nicht anzunehmen, nicht zu handeln, Bluts– und Heiratsverbin-<br />
67 »Nicht alles ist vertraglich im Vertrag.« Der Vertrag ist »überall dort, wo er existiert, einer Regelung<br />
unterworfen, die das Werk der Gesellschaft ist und nicht das der Einzelpersonen.« (Ibid.: 267f.)<br />
68 Diese "totalen Leistungen" sind zum einen total, »weil sie ganze Familien, Clans, Phratien, Stämme<br />
erfassen und in den Ablauf der realen und zeremonialen Tauschhandlungen einbeziehen. Total sind sie<br />
aber auch, weil sie ihre Akteure voll beanspruchen, sie in ihrer gesamten Existenz fordern: den totalen<br />
Menschen.« (Oppitz 1975: 100)
46 Verzicht und Begehren<br />
dungen nicht einzugehen. Die Dayak haben sogar ein ganzes Rechts– und Moralsystem aus der<br />
Pflicht entwickelt, an dem Mahl, dem man beiwohnt, oder das man hat zubereiten sehen, teilzunehmen.<br />
[...] Die Pflicht zu geben ist nicht weniger wichtig; [...] Sich weigern, etwas zu geben,<br />
es versäumen, jemand einzuladen, sowie es ablehnen, etwas anzunehmen, kommt einer<br />
Kriegserklärung gleich, es bedeutet, die Freundschaft und die Gemeinschaft zu verweigern.«<br />
(Ibid.: 36ff.) 69<br />
Während die Verweigerung des Tauschs auf seinen Widerpart verweist — gewaltsame<br />
Aneignung, "privaten oder öffentlichen Krieg", signifiziert die Gabe Frieden<br />
und Soziabilität. Und so mutmaßt Mauss: »Die Gesellschaften haben in dem Maße<br />
Fortschritte gemacht, wie sie selbst, ihre Untergruppen und schließlich ihre Individuen<br />
fähig wurden, ihre Beziehungen zu festigen, zu geben, zu nehmen und erwidern.<br />
Zuerst mußten die Menschen es fertigbringen, die Speere niederzulegen.«<br />
(Ibid.: 181) Verzicht auf Gewaltausübung zugunsten friedfertiger Beziehungen also.<br />
Marshall Sahlins bezeichnet in diesem Sinne das von Mauss beschriebene System der<br />
die fremden und vergangenen Kulturen durchdringenden wechselseitigen Obligationen<br />
als "eine Art Gesellschaftsvertrag"; 70 was im konkreten Fall hieße: eine unbedingt<br />
gültige "Übereinkunft", die das Verhältnis der Personen und Segmente zueinander<br />
definiert und perpetuiert. Eine derartige Übereinkunft erscheint Mauss notwendig,<br />
um den "Urzustand der Unordnung" zu überwinden, den auch er sich offenbar<br />
als eine Art Hobbes'scher bellum omnium contra omnes, einen Krieg aller<br />
gegen alle vorstellt, der gegeben (eben "ursprünglich") ist, aber schließlich durch die<br />
Gabe "dialektisch" überwunden wird; die menschliche Natur ändert sich nicht, sondern<br />
ist im Tausch "aufgehoben". 71<br />
69 »Außerdem gibt man, weil man dazu gezwungen ist, weil der Geschenknehmer eine Art<br />
Eigentumsrecht auf alles hat, was dem Geber gehört.« (Ibid.)<br />
70 »Der Essai sur le don ist eine Art Gesellschaftsvertrag <strong>für</strong> die Primitiven.« (Sahlins 1972: 168) Dieser<br />
Satz dürfte meinen: Mauss kodifiziert, was die fraglichen Gesellschaften praktizieren.<br />
71 Man darf übrigens, wie Marshall Sahlins hervorhebt, den von Hobbes als Urzustand postulierten<br />
"Krieg aller gegen alle" keinesfalls als wechselseitigen Vernichtungskrieg mißverstehen: »Der von<br />
Hobbes beschriebene Naturzustand war auch eine politische Ordnung. Es ist wahr, daß Hobbes von dem<br />
menschlichen Machthunger und der Disposition zur Gewalt ausging, aber er schreibt auch von einer<br />
Verteilung der Macht unter den Menschen und von ihrer Freiheit, sie einzusetzen. Der Rückschluß im<br />
"Leviathan" von der menschlichen Psychologie auf einen vormaligen Zustand scheint darum zur gleichen<br />
Zeit durchgängig und gebrochen. Der Naturzustand entsprach der menschlichen Natur, aber er kündigte<br />
auch eine neue Ebene der Realität an, die als politische Ordnung in psychologischen Termini nicht<br />
beschreibbar war.« (Sahlins 1972: 171f.) Der bellum omnium contra omnes ist demnach weniger bestimmt<br />
durch die Disposition zur Ausübung von Gewalt als durch das Recht dazu. Es geht Hobbes folglich (auch)<br />
um die Legitimität der Konfrontation. Der "Naturzustand" beschreibt somit bereits eine Art von Gesellschaft.<br />
(vgl. Ibid.: 172) Eine Gesellschaft allerdings ohne Zentralinstanz, ohne Souverän, ohne Ordnungsmacht;<br />
in welcher der Einzelne das Recht zur individuellen Gewaltausübung besitzt. Im<br />
"Urzustand" ist dieses Recht von Dauer, nicht die sporadischen Kampfhandlungen: Während der Zeit, in<br />
der die Menschen »ohne eine allgemeine, sie alle im Zaum haltende Macht leben, [befinden sie] sich in<br />
einem Zustand ..., der Krieg genannt wird, und zwar in einem Krieg eines jeden gegen jeden. Denn<br />
Krieg [Warre] besteht nicht nur in Schlachten und Kampfhandlungen, sondern in einem Zeitraum, in<br />
dem der Wille zum Kampf genügend bekannt ist. Und deshalb gehört zum Wesen des Krieges der<br />
Begriff Zeit, wie zum Wesen des Wetters. Denn wie das Wesen des schlechten Wetters nicht in ein<br />
oder zwei Regenschauern liegt, sondern in einer Neigung hierzu während mehrerer Tage, so besteht das<br />
Wesen des Kriegs nicht in tatsächlichen Kampfhandlungen, sondern in der bekannten Bereitschaft dazu
Verzicht und Begehren 47<br />
"Gefühl" versus Vernunft also: »Indem die Völker die Vernunft dem Gefühl entgegenstellten<br />
und den Willen zum Frieden gegenüber plötzlichen Wahnsinnstaten geltend<br />
machten, gelang es ihnen, das Bündnis, die Gabe und den Handel an die Stelle<br />
des Kriegs, der Isolierung und Stagnation zu setzen.« (Mauss 1925: 181) 72 Die Gabe<br />
ist somit <strong>für</strong> Mauss »der Triumph der menschlichen Rationalität über die Unsinnigkeit<br />
des Krieges.« (Sahlins 1972: 175) 73 Mit der Entgegensetzung von Begehren<br />
und Verzicht korrespondierte also diejenige von Natur und Vernunft — wobei Vernunft<br />
gleich "Kultur" bzw. "Gesellschaft" ist. Die kulturelle Ordnung wäre demnach<br />
eine Ordnung des Verzichts, die (hypothetische vorkulturelle) Unordnung des "Naturzustands"<br />
eine der ungezügelten Begierden.<br />
So problematisch dieses Konstrukt auch ist, vor allem die Begründung der<br />
Notwendigkeit des Tauschs über den Rekurs auf einen kriegerischen Urzustand,<br />
festzuhalten ist zweierlei: Erstens sind gewaltsame Aneignung und "Krieg" stets<br />
Verhaltensoptionen 74 (das gesellschaftliche Leben dürfte stets hinreichend Anlässe<br />
während der ganzen Zeit, in der man sich des Gegenteils nicht sicher sein kann. Jede andere Zeit ist<br />
Frieden.« (Hobbes 1651: 96)<br />
72 Nach Sahlins stimmen Mauss und Hobbes in der Ansicht überein, daß die "primitive Ordnung" durch<br />
die Abwesenheit eines allgemein verbindlichen und von einer Zentralinstanz exekutierten Gesetzes<br />
gekennzeichnet ist; d.h. »jeder kann das Gesetz in eigene Hände nehmen, so daß Mensch und Gesellschaft<br />
ständig von einem gewaltsamen Ende bedroht sind.« (1972: 172f.) Mauss Argumentation erinnert<br />
hier tatsächlich stark an Hobbes, welcher im Leviathan schrieb: »Deshalb trifft alles, was Kriegszeiten mit<br />
sich bringen, in denen jeder eines jeden Feind ist, auch <strong>für</strong> die Zeit zu, während der die Menschen keine<br />
Sicherheit als diejenige haben, die ihnen ihre eigene Stärke und Erfindungskraft bieten. In einer solchen<br />
Lage ist <strong>für</strong> Fleiß kein Raum, da man sich seiner Früchte nicht sicher sein kann; und folglich gibt es<br />
keinen Ackerbau, keine Schiffahrt, keine Waren, die auf dem Seeweg eingeführt werden können, keine<br />
bequemen Gebäude, keine Geräte, um Dinge, deren Fortbewegung viel Kraft erfordert, hin– und<br />
herzubewegen, keine Kenntnis von der Erdoberfläche, keine Zeitrechnung, keine Künste, keine<br />
Literatur, keine gesellschaftlichen Beziehungen, und es herrscht, was das schlimmste von allem ist,<br />
beständige Furcht und Gefahr eines gewaltsamen Todes — das menschliche Leben ist einsam, armselig,<br />
ekelhaft, brutal und kurz.« (1651: 96)<br />
73 »In allen Gesellschaften, die uns unmittelbar vorausgegangen sind oder die uns noch heute umgeben,<br />
und selbst in zahlreichen Bräuchen unseres eigenen Volkes gibt es keinen Mittelweg: entweder volles<br />
Vertrauen oder volles Mißtrauen. Man legt seine Waffen nieder, entsagt der Magie und verschenkt alles,<br />
von gelegentlicher Gastfreundschaft bis zu Töchtern und Gütern. Unter solchen Bedingungen haben<br />
Menschen gelernt, auf das Ihrige zu verzichten und sich dem Geben und Erwidern zu verschreiben. Sie<br />
hatten auch keine andere Wahl. Wenn zwei Menschengruppen einander begegnen, können sie entweder<br />
einander ausweichen — und sich schlagen im Falle des Mißtrauens oder der Herausforderung —, oder<br />
aber miteinander handeln. Bis in die jüngste Zeit wurden Geschäfte immer mit Fremden getätigt,<br />
mochten sie auch Verbündete sein.« (Mauss 1925: 180)<br />
74 Die Wahl zwischen Tausch und Krieg haben einige Gesellschaften tatsächlich im direkten Wortsinn.<br />
Ein fast schon kurioses Beispiel <strong>für</strong> den sozialen Wert des "primitiven Handels" liefern in diesem<br />
Zusammenhang die Yanomamö, bei denen Spezialisierung und "Tauschhandel" primär sozialen (bzw.<br />
politischen) und nicht ökonomischen Zwecken dienen. Auf den ersten Blick scheint es sich allerdings<br />
genau andersherum zu verhalten. Napoleon Chagnon schreibt: »Ganz zu Anfang meiner Feldforschung<br />
besuchte ich die Mömariböwei-teri ... um mich bei ihnen insbesondere über die Verfertigung von<br />
Tontöpfen zu informieren. Sie stritten allesamt entschieden ab, darüber etwas zu wissen, und sagten, sie<br />
hätten früher einmal Kenntnisse davon besessen, diese aber schon lange verloren. Sie fügten hinzu, ihre<br />
Verbündeten, die Möwaraoba-teri fertigten Töpfe an und lieferten ihnen, was sie brauchten. Außerdem,<br />
meinten sie, eigne sich der Ton in der Umgebung ihres Dorfes nicht <strong>für</strong> Töpfe. Später im gleichen Jahr<br />
kühlte ihr Verhältnis zu dem Töpferdorf wegen eines Krieges ab, und sie sahen sich von ihrer
48 Verzicht und Begehren<br />
liefern, diese zumindest "im ersten Affekt" in Erwägung zu ziehen); zweitens ist die<br />
Alternative, vor der die "primitive" Gesellschaft zumindest theoretisch steht, diejenige<br />
zwischen Gabentausch und Auflösung. Es bedarf keiner sonderlich ausgeprägten<br />
Phantasie, um sich vor Augen zu führen, daß die Verweigerung des Tauschs, wenn<br />
auch nicht notwendig den Krieg zwischen Schwägern, so doch den "Tod" der (segmentären)<br />
Gesellschaft zur Folge hat. 75<br />
Das, was die segmentäre Gesellschaft befriedet, "vereinigt", ist also keine externe<br />
Instanz, die "sie alle in Schach hält" (Hobbes), sondern der Gabentausch auf<br />
Grundlage reziproker Verpflichtungen: 76 »Der Transfer von Dingen, die in gewissem<br />
Maß Personen sind, und von Personen, in gewissem Maß wie Dinge behandelt,<br />
das ist das Einvernehmen an der Basis der organisierten Gesellschaft. Die Gabe ist<br />
Allianz, Solidarität, Verbindung, kurz: Frieden, die große Tugend, welche frühe Philosophen,<br />
namentlich Hobbes, im Staat entdeckt hatten.« (Ibid.: 169) In diesem Sinne<br />
wäre jeder Tauschakt die Aktualisierung eines "ursprünglichen" Friedensvertrags.<br />
Auf den Zusammenhang von Tausch und sozialer Solidarität bezogen könnte<br />
man Mauss' Fragestellung also folgendermaßen zuspitzen: Auf welcher Grundlage ist<br />
soziale Ordnung in Abwesenheit regulativer <strong>Institut</strong>ionen wie Staat und Markt dau-<br />
Tontopfquelle abgeschnitten. Prompt "erinnerten" sich die Mömariböwei-teri daran, wie man Töpfe<br />
macht, und entdeckten, daß der Ton in ihrer Gegend sich doch <strong>für</strong> die Töpferei eignete. Sie hatten<br />
einfach nur künstlich eine Mangelsituation im Ort geschaffen, um einen Vorwand <strong>für</strong> Besuche bei ihren<br />
Verbündeten zu haben.« (1992: 228) Die Spezialisierung gründet demnach allein in den soziologischen<br />
Aspekten der Bündnispolitik der Yanomamö und nicht in der unterschiedlichen Verfügbarkeit der<br />
Rohstoffe oder Produkte. Der Austausch ermöglicht politische und soziale Beziehungen aufzubauen,<br />
welche durch die künstlich geschaffene "Abhängigkeit" perpetuiert werden.<br />
75 Die (offen zur Schau gestellte oder untergründige) Verbindung von Tausch und Krieg tritt im<br />
ethnographischen Material zum Teil tatsächlich recht deutlich zutage, häufig sind Tauschakte von<br />
kriegerischen Demonstrationen begleitet. So werden die Trobriander auf Dobu »mit einer<br />
Zurschaustellung von Feindseligkeit und Wildheit empfangen und fast wie Eindringlinge behandelt.«<br />
(Malinowski 1922: 381) Die Beispiele <strong>für</strong> derartige Praktiken sind zahlreich und vielfältig. Was <strong>für</strong> die<br />
"Primitiven" gilt, trifft im übrigen auch auf unsere Vorfahren zu: »Wenn schließlich einmal zwischen<br />
zwei gleich starken Stämmen Frieden geschlossen wurde, war es ratsam, ihn mit gegenseitigen Gaben als<br />
Garantie <strong>für</strong> seine Dauerhaftigkeit sorgfältig zu pflegen. Was bedeutet Friede <strong>für</strong> den Autor des Beowulf<br />
anderes, als daß den Völkern die Möglichkeit gegeben ist, untereinander Geschenke auszutauschen? Das<br />
Wagnis wechselnder Angriffe wurde von einem geregelten Kreislauf gegenseitiger Gaben abgelöst.«<br />
(Duby 1969: 66)<br />
76 »Durch das Herausstellen der inneren Zerbrechlichkeit segmentärer Gesellschaften, ihre Tendenz zur<br />
Auflösung, verschiebt "Die Gabe" die klassische Alternative zwischen Krieg und Handel von der Peripherie<br />
in das Zentrum des sozialen Lebens, und von der gelegentlichen Episode zur andauernden Präsenz.<br />
Dies ist die überragende Bedeutung von Mauss' Rückkehr zur Natur, aus der folgt, daß sich die<br />
primitive Gesellschaft im Kriegszustand mit [dem Krieg aller gegen alle] befindet, und daß all ihre<br />
Handlungen Friedensverträge sind. Jeder Tauschakt ... muß ... eine politische Bürde der Versöhnung<br />
tragen.« (Sahlins 1972: 182) Es ist evident, daß im Gabentausch das segmentäre Prinzip, d.h. die<br />
Tatsache der Differenzierung zum Ausdruck kommt, und dieser gerade nicht dazu tendiert, die Segmente<br />
letztlich in einer höheren Einheit, jener des antizipierten "Staates", aufzulösen. In der Wechselbeziehung<br />
der Gegensätze perpetuiert der Gabentausch diese — oder mit anderen Worten: im Tausch treten sich<br />
die beteiligten Parteien gegenüber, ohne ihre Identität einzubüßen. Keine dritte Partei steht über den<br />
Tauschenden, die die Einhaltung der Regel überwacht. Die Gabe schafft so — wie Sahlins es bezeichnet<br />
— inbetween relations, d.h. Gleichheit auf Basis von Gegenseitigkeit, während in den von der klassischen<br />
Vertragstheorie konzipierten Strukturen immer ein Element der Hierarchisierung enthalten ist.
Verzicht und Begehren 49<br />
erhaft möglich? Die Antwort ist denkbar einfach: die "primitive" Gesellschaft gründet<br />
im Gabentausch, in den wechselseitigen Verpflichtungen zu geben, zu nehmen<br />
und zu erwidern. Derartige Verpflichtungen bestehen in unserer Gesellschaft nicht<br />
(mehr), aber das Fremde ist keineswegs so fremd, wie es auf den ersten Blick erscheinen<br />
mag, und auch das Vergangene nicht tot, es ist noch nicht einmal vergangenen.<br />
Die dem Gabentausch zugrundeliegende Moral und Ökonomie wirken <strong>für</strong><br />
Mauss »sozusagen unterschwellig auch noch in unseren eigenen Gesellschaften«, und<br />
er glaubt, »hier einen der Felsen gefunden zu haben, auf denen unsere Gesellschaften<br />
ruhen« (1925: 19). Mauss merkt zu dem von ihm bearbeiteten ethnographischen<br />
Material an:<br />
»Gewöhnlich werden derartige Tatsachen nur der Kuriosität halber oder allenfalls zum Zweck<br />
des Vergleichs herangezogen, um zu zeigen, wie fern oder wie nahe unsere eigenen Gesellschaften<br />
solchen <strong>Institut</strong>ionen stehen, die man "primitive" nennt. Nichtsdestoweniger sind sie<br />
von allgemeinem soziologischen Wert, denn sie ermöglichen es uns, ein Moment der gesellschaftlichen<br />
Entwicklung zu verstehen. Doch auch sozialgeschichtlich sind sie von Bedeutung,<br />
denn <strong>Institut</strong>ionen dieses Typus haben den Übergang zu unseren eigenen Rechts– und Wirtschaftsformen<br />
gebildet und können daher zur historischen Erklärung unserer Gesellschaften<br />
dienen. Die Moral und die Praxis des Austauschs der uns unmittelbar vorausgegangenen Gesellschaften<br />
bewahren mehr oder minder deutliche Spuren all jener Prinzipien, die wir analysiert<br />
haben. Wir meinen in der Tat beweisen zu können, daß unsere Rechts– und Wirtschaftssysteme<br />
aus ähnlichen <strong>Institut</strong>ionen wie den erwähnten hervorgegangen sind.« (1925:<br />
120)<br />
Zwischen Waren– und Gabentausch besteht somit eine historische und systematische<br />
Beziehung, die eine Form geht der anderen notwendig zeitlich voraus (d.h. der Warentausch<br />
kann sich nur auf Grundlage des vorgängigen Gabentauschs entfalten), und<br />
die Moral der Gabe ist in der Ware gewissermaßen "aufgehoben" — die unbedingte<br />
Verpflichtung zur Erwiderung ermöglicht schließlich friedfertige Transaktionen jedweder<br />
Art.<br />
Aus der Perspektive der "entwickelten" Marktökonomie bzw. der bürgerlichen<br />
Ökonomie wird die historische Abfolge von Gaben– und Warenaustausch folgendermaßen<br />
skizziert: Die Tauschenden folgen einem restriktiven und präskriptiven Muster,<br />
welches solange notwendig ist, wie sich keine <strong>Institut</strong>ionen herausgebildet haben,<br />
mittels derer die Verfolgung des Eigeninteresses in den Dienst der sozialen Integration<br />
gestellt wird. Es sollte umstandslos deutlich sein, daß man innerhalb eines<br />
derartigen Paradigmas die Formen des Tauschs zwangsläufig in einer absteigenden<br />
Reihenfolge anordnen muß, ausgehend vom Markt als dem Ort der "höchsten" Rationalität.<br />
Zwar leben auch die Menschen in den Gaben tauschenden Gesellschaften<br />
friedlich zusammen, die Ökonomie dieser Gesellschaften erscheint aber als "gehemmt".<br />
77<br />
77 Auch wenn Mauss sehr genau die sozial desintegrativen und anomischen Wirkungen des "freien"<br />
Marktaustauschs wahrnimmt und kritisiert, ist der Gabentausch <strong>für</strong> ihn doch lediglich dessen historischer<br />
Vorgänger.
50 Verzicht und Begehren<br />
Begreift man den Menschen als eigennütziges Wesen, dessen Streben ursächlich auf<br />
die Maximierung seines materiellen Wohlergehens gerichtet ist, mißt man weiterhin<br />
die Rationalität von Handlungen und <strong>Institut</strong>ionen daran, inwieweit sie diesem Ziel<br />
zuträglich sind, erscheinen Gabentausch und segmentäre Differenzierung im Gegensatz<br />
zu Warenaustausch und "entwickelter" gesellschaftlicher Arbeitsteilung als defizitär<br />
und höchstens "proto-rational", denn folgt man Autoren wie Adam Smith, realisiert<br />
sich der soziale Zweck des Gabentauschs offenbar auch im Warenaustausch —<br />
als nicht intendiertes Nebenprodukt des Strebens nach individuellem Nutzen. Die<br />
Differenz zwischen Gabe und Ware entspricht in dieser Lesart somit derjenigen zwischen<br />
Norm und Interesse.<br />
DER GEIST DER GEGEBENEN SACHE<br />
Die Unterschiede zwischen "ihnen" und "uns" sind evident: Während in der bürgerlichen<br />
Gesellschaft der Austausch von Waren gegen Geld (oder andere Waren) erstens<br />
stets auf einer expliziten Übereinkunft beruht, deren Ausdruck der Kaufvertrag<br />
ist (oder der Arbeitsvertrag); die Erfüllung des Kontrakts (zwischen "Kontrahenten",<br />
nomen est omen) zweitens vom bürgerlichem Recht überwacht und bei Bedarf<br />
mittels staatlicher Zwangsmittel durchgesetzt wird, liegt dem Gabentausch weder<br />
ein expliziter Kontrakt zugrunde (d.h. die Gegengabe ist nicht vertraglich fixiert)<br />
noch existiert üblicherweise eine gesellschaftliche Instanz, welche die Erfüllung der<br />
Verpflichtung erzwingen kann. 78 Geht man weiterhin davon aus, daß der Gabentausch,<br />
dem kein direkter ökonomischer Nutzen entspringt, den Menschen einen<br />
Verzicht, eine Entsagung aufnötigt, der sie sich unter Umständen entzögen, dem<br />
Impuls folgend, etwas <strong>für</strong> nichts zu erhalten, muß man sich wundern, daß der<br />
Tausch unter derartigen Bedingungen funktionieren kann. Genau auf dieses Problem<br />
verweist Mauss' berühmte und vielzitierte Frage, die er zu Beginn des Essai stellt:<br />
»Welches ist der Grundsatz des Rechts und Interesses, der bewirkt, daß in den rückständigen<br />
oder archaischen Gesellschaften das empfangene Geschenk zwangsläufig<br />
erwidert wird? Was liegt in der gegebenen Sache <strong>für</strong> eine Kraft, die bewirkt, daß der<br />
Empfänger sie erwidert?« (1925: 18) 79 Es geht ihm also nicht allein darum, die Wir-<br />
78 Vielleicht widerspricht das Zwangsmittel auch dem "Geist der Gabe", der im Anschein der<br />
Freiwilligkeit gründet. Aus einem Geschenk kann man übrigens auch in unserer Gesellschaft keine<br />
formalen (d.h. einklagbaren) Ansprüche ableiten. Was auch daran liegt, daß ein Geschenk unserer<br />
Rechtsauffassung nach "spontan" und ohne den Gedanken an eine Gegenleistung gegeben wird.<br />
79 Das "Interesse", welches Mauss in der zitierten Frage bemüht, dürfte weniger auf materiellen Besitz<br />
als auf soziale Friedengerichtet sein, und auf die "Selbsterhaltung" der Individuen wie der Gesellschaft<br />
zielen. Wie Durkheim immer wieder betonte, müssen soziale Tatsachen wie die Arbeitsteilung von der<br />
Gesellschaft her (oder unter Bezugnahme auf andere soziale Tatsachen) erklärt werden. Mauss' bezieht<br />
sich zudem allein auf die Erwiderung der Gabe. Warum räumt er dieser eine derart privilegierte Stellung<br />
ein, wo doch die Weigerung, zu geben oder anzunehmen, die soziale Beziehung der Tauschenden<br />
ebenso negieren würde wie eine verweigerte Gegengabe? Dies könnte zum einen daran liegen, daß ein<br />
Tauschzyklus niemals mit der Erwiderung abgeschlossen ist. Tatsächlich dürfte <strong>für</strong> das System der<br />
"totalen Leistung" gelten, daß die Tauschzyklen keinen Anfang und kein Ende haben, jede Gabe auch
Verzicht und Begehren 51<br />
kungen des Tauschs auf die Gesellschaft und die Notwendigkeit der wechselseitigen<br />
Obligationen aufzuzeigen, er will auch die Frage beantworten, warum der Einzelne<br />
sich den ihm auferlegten Verpflichtungen fügt.<br />
Der zweite Teil der oben zitierten Frage impliziert bereits die Antwort: die<br />
empfangene Gabe hat Macht über die Menschen. Diese Annahme erscheint zunächst<br />
einmal logisch, wenn man davon ausgeht, daß die Gesellschaft Zwang auf die Menschen<br />
ausüben muß um sie daran zu hindern, ihren eigennützigen Strebungen zu folgen,<br />
eine erzwingende Instanz aber nicht existiert. In diesem Fall muß es einen anderen<br />
Mechanismus geben, welcher die Erfüllung der Norm garantiert. Dieser "Macht<br />
der Gabe", dem »Geist der gegebenen Sache« (Ibid.: 31), der durch die Dinge auf<br />
die Menschen wirkt, spürt Mauss im folgenden nach. 80 Er verortet jene Kraft, die<br />
der Gabe innewohnt und bewirkt, daß der Empfänger sie erwidert, im Taonga der<br />
Maori. Mit diesem Begriff bezeichnen die Maori alles, »was Eigentum im eigentlichen<br />
Sinn ist, alles was reich macht und zu Ansehen verhilft, alles was ausgetauscht<br />
werden oder als Entschädigung dienen kann. Es sind ausschließlich Wertgegenstände:<br />
Talismane, Embleme, heilige Matten und Götterbilder, manchmal sogar<br />
Traditionen, magische Kulte und Rituale.« (Ibid.: 30f.) In der Vorstellungswelt der<br />
Maori sind diese Wertgegenstände eng mit der sie besitzenden Person (oder dem<br />
Clan, dem Boden, dem Wald) verbunden, sie tragen etwas von der (Lebens-) Kraft<br />
ihres "Besitzers" in sich. 81 Wenn Mauss' Essai sur le don einen der Schlüsseltexte <strong>für</strong><br />
die zeitgenössische Ethnologie und Anthropologie darstellt, so ist der Schlüsseltext<br />
<strong>für</strong> den Essai die von Elsdon Best aufgezeichnete Rede des Maori-Weisen Tamati<br />
Ranapiri:<br />
»Ich will Ihnen jetzt vom hau erzählen ... das hau ist nicht der Wind, der bläst. Ganz und gar<br />
nicht. Stellen Sie sich vor, Sie besitzen einen bestimmten Gegenstand (taonga) und geben ihn<br />
mir; Sie geben ihn mir ohne festgesetzten Preis. Wir handeln nicht darum. Nun gebe ich diesen<br />
Gegenstand einem Dritten, der nach einer gewissen Zeit beschließt, irgend etwas als Zahlung<br />
da<strong>für</strong> zu geben (utu), er schenkt mir irgend etwas (taonga). Und dieses taonga, das er mir<br />
gibt, ist der Geist (hau) des taonga, das ich von Ihnen bekommen habe und das ich ihm gegeben<br />
habe. Die taonga, die ich <strong>für</strong> die anderen taonga (die von Ihnen kommen) erhalten habe, muß<br />
ich Ihnen zurückgeben. Es wäre nicht recht (tika) von mir, diese taonga <strong>für</strong> mich zu behalten,<br />
ob sie nun begehrenswert (rawe) oder unangenehm (kino) sind. Ich muß sie Ihnen geben, denn<br />
sie sind ein hau des taonga, das Sie mir gegeben haben. Wenn ich dieses zweite taonga <strong>für</strong> mich<br />
Gegengabe ist. Mauss könnte mit dieser Hervorhebung aber auch implizit auf den Charakter der<br />
Reziprozitätsnorm als Bedingung der Möglichkeit von Tausch und damit Soziabilität rekurrieren. Ohne<br />
das "Wie du mir, so ich dir" als vorgängige Norm wäre niemals eine Gabe gegeben worden.<br />
80 Wie ich bereits weiter oben erwähnte, will Mauss, ausgehend von Durkheims Bestimmung der<br />
sozialen und moralischen Tatsache, die Wechselbeziehung des (individuell-) Psychischen ("gelebte<br />
Erfahrung") und des (kollektiv-) Sozialen ausleuchten. Lévi-Strauss kommentiert dieses Bestreben recht<br />
treffend: »Wir können niemals sicher sein, den Sinn und die Funktion einer <strong>Institut</strong>ion getroffen zu<br />
haben, wenn wir nicht imstande sind, ihre Einwirkung auf ein individuelles Bewußtsein wieder zu<br />
beleben. Da diese Einwirkung ein integrierender Bestandteil der <strong>Institut</strong>ion ist, muß jede Interpretation<br />
die Objektivität der historischen oder vergleichenden Analyse mit der Subjektivität der gelebten<br />
Erfahrung zur Koinzidenz bringen.« (1950: 21) Eine hervorragende neuere Darstellung und Diskussion<br />
von Mauss' Auseinandersetzung mit dem Gabentausch liefert Godelier 1996.<br />
81 Sein Mana. Dieses ist bei den Maori eine Subsumierung aller magischen, religiösen, geistigen Kraft.
52 Verzicht und Begehren<br />
behalten würde, könnte mir Böses daraus entstehen, ganz bestimmt, sogar der Tod. So ist das<br />
mit dem hau, dem hau des persönlichen Eigentums, dem hau der taonga, dem hau des Waldes.<br />
Kati ena (genug davon).« (nach Ibid.: 32f.)<br />
Mauss interpretiert diese Passage folgendermaßen: was Tamati Ranapiri ausdrücken<br />
wollte, ist die Tatsache, daß die Taonga, wie alles persönliche Eigentum, eine geistige<br />
Kraft enthalten: das Hau. Die gegebene Sache wird demnach erwidert, weil die<br />
Macht des Hau den Empfänger dazu zwingt, die Gabe könnte ihn sonst zerstören.<br />
»So interpretiert wird der Gedanke nicht nur klar, sondern er erscheint auch als einer der<br />
Leitgedanken des Maori-Rechts. Das was in dem empfangenen oder ausgetauschten Geschenk<br />
verpflichtet, kommt daher, daß die empfangene Sache nicht leblos ist. Selbst wenn der Geber<br />
sie abgetreten hat, ist sie noch ein Stück von ihm. Durch sie hat er Macht über den Empfänger,<br />
so wie er durch sie, als ihr Eigentümer, Macht über den Dieb hat. Denn das taonga ist vom hau<br />
seines Waldes, seines Ackerlandes, seines Heimatbodens beseelt, und das hau verfolgt jeden,<br />
der es innehat.« (Ibid.: 33f.)<br />
Die Gabe schafft Verpflichtung, Verpflichtung ist Bindung, eine Bindung die <strong>für</strong><br />
Mauss einen doppelten Charakter hat: Zum einen ist diese Bindung rechtlicher Natur,<br />
ein Quasi-Vertrag. Doch zum anderen ist <strong>für</strong> Mauss »eine Seelen-Bindung ...,<br />
denn die Sache selbst hat eine Seele, ist Seele. Woraus folgt, daß jemand etwas geben<br />
soviel heißt, wie jemand etwas von sich selbst geben« (Ibid.: 35; Hervorh. von<br />
mir). Mauss fährt fort:<br />
»Es ist vollkommen logisch, daß man in einem solchen Ideensystem dem anderen zurückgeben<br />
muß, was in Wirklichkeit ein Teil seiner Natur und Substanz ist; denn etwas von jemand annehmen<br />
heißt, etwas von seinem geistigen Wesen annehmen, von seiner Seele; es aufzubewahren<br />
wäre gefährlich und tödlich, und zwar nicht allein deshalb, weil es unerlaubt ist, sondern<br />
weil diese Sache — die nicht nur moralisch, sondern auch physisch und geistig von der anderen<br />
Person kommt, weil dieses Wesen, diese Nahrung, diese beweglichen oder unbeweglichen<br />
Güter, diese Riten oder Kommunionen magische und religiöse Macht über den Empfänger haben.<br />
Und schließlich ist die gegebene Sache keine leblose Sache. Beseelt, oft individualisiert,<br />
hat sie die Neigung, zurückzukehren in das, was Hertz ihre "Ursprungsstätte" nannte, oder <strong>für</strong><br />
den Clan und den Boden, dem sie entstammt, etwas zu produzieren, das sie ersetzt.« (Ibid.:<br />
35f.)<br />
Es ist in der Tat ein beinahe "magisches" Konzept, welches Mauss hier adaptiert.<br />
Trotz aller an seinem Rekurs auf das Hau in der Folgezeit geübten Kritik scheint mir<br />
doch, daß Mauss, als er sich dem Mystizismus des eingeborenen Denkens hingab, eine<br />
Spur verfolgte, die nicht vernachlässigt werden sollte: das Hau ist als soziale Tatsache,<br />
als kollektive Vorstellung im Denken und Fühlen der Eingeborenen wirklich<br />
und wirksam. 82 Ich muß nochmals betonen, daß die Gabe schon vom Namen her et-<br />
82 So schreibt Lévi-Strauss: »Stehen wir hier nicht vor einem der (nicht so seltenen) Fälle, wo der<br />
Ethnologe sich vom Eingeborenen narren läßt?« Demnach »versucht Mauss in der "Gabe" verbissen, ein<br />
Ganzes aus Teilen zu rekonstruieren, und da dies sichtlich unmöglich ist, muß er diesem Gemisch ein<br />
zusätzliches Quantum hinzufügen, das ihm die Illusion gibt, seine Rechnung ginge auf. Dieses Quantum<br />
ist das hau.« (1950: 31) Marshall Sahlins ist der Ansicht, daß Mauss die Rede des Maori-Weisen schlicht<br />
mißverstand. Demnach war der fragliche Text »eine erklärende Anmerkung zur Beschreibung eines<br />
sakralen Ritus. Tamati Ranapiri versuchte folglich Best mit diesem Beispiel — so gewöhnlich, daß jeder<br />
(oder jeder Maori) in der Lage sein sollte es sofort zu begreifen — klarzumachen, warum bestimmte
Verzicht und Begehren 53<br />
was weniger "profanes" ist als die Ware. Sie kann ein Geschenk sein (in dieser Form<br />
ist sie uns vertraut, es ist, wie bereits erwähnt, durchaus auch bezogen auf unsere<br />
Gesellschaft instruktiv, "geben" von "kaufen/verkaufen" zu scheiden), zuweilen<br />
umgeben vom blassen Widerschein einer heiligen Aura, zuweilen tatsächlich heilig:<br />
Opfergabe. Ihr wohnt in jedem Fall eine gewisse, schwer bestimmbare Kraft inne;<br />
sie ist keinesfalls ein neutrales Ding, jeder beliebige Gegenstand kann, als Gabe dargeboten,<br />
von dieser "Macht der Gabe" durchdrungen werden. Selbst wir spüren diese<br />
Kraft: der Gegenstand wird ein anderer, wenn wir ihn zum Geschenk erhalten,<br />
anstatt ihn zu kaufen, er bindet, ist und bleibt Teil des Gebers oder der Geberin.<br />
Damit ist eine Gabe (oder ein Geschenk) nicht einfach das "Gegebene"; zumindest<br />
solange nicht, wie man "geben" als neutralen, instrumentellen Akt definiert. Im Gabentausch<br />
erzeugen materielle Transaktionen "geistige" Bande, die sozialer Natur<br />
sind. Wie Mauss schreibt: die »enge Verquickung von symmetrischen und antithetischen<br />
Rechten und Pflichten hört auf, widersprüchlich zu sein, wenn man begreift,<br />
daß es sich hier vor allen um eine Verquickung von geistigen Bindungen handelt:<br />
zwischen den Dingen, die in gewissem Grad Seele sind, und den Individuen und<br />
Gruppen, die einander in gewissem Sinn als Dinge behandeln.« (1925: 39) Es werden<br />
also beim Gabentausch Beziehungen zwischen Personen mittels Dingen hergestellt,<br />
die im Denken der Eingeborenen (wie es scheint notwendig) Teil der Persönlichkeit<br />
der Tauschenden sind. 83<br />
Mauss Ausführungen verweisen auf einen zentralen Aspekt der Gabe, welcher<br />
besonders in der neueren Diskussion hervorgehoben wurde (z.B. in Gregory 1982):<br />
im Gegensatz zur käuflichen Ware ist sie ein unveräußerliches Gut. "Unveräußerlich"<br />
meint hier zweierlei: erstens ist, worauf ich bereits bei der Diskussion der<br />
gejagte Vögel zeremoniell dem Hau des Waldes zurückgegeben werden, dem Ursprung ihres Reichtums.«<br />
(1972: 158) Wie das Hau des Waldes seine Fruchtbarkeit, so ist das Hau der Gabe demnach der<br />
aus ihr resultierende Ertrag, der an den ursprünglichen Geber zurückerstattet werden muß. Kein<br />
Geheimnis also, und kein Geist, das Prinzip, das Tamati Ranapiri uns offenbart, ist nach Sahlins ein sehr<br />
einfaches: »Wir haben es mit einer Gesellschaft zu tun, in welcher beim Tausch die Freiheit, auf Kosten<br />
anderer Gewinn zu machen, nicht besteht. Hierin liegt die Moral der ökonomischen Fabel des alten<br />
Maori.« (Ibid.: 161)<br />
83 Der vermeintliche "Positivismus" der Durkheim-Schule bestand in dieser Hinsicht im Minimum<br />
einfach nur darin, soziale Phänomene als "Dinge" zu nehmen, die sowohl (<strong>für</strong> die Menschen) wirklich als<br />
auch (gesellschaftlich) wirksam sind. Die sozialen Tatsachen sind <strong>für</strong> das Individuum als notwendig<br />
gesellschaftliches Wesen ebenso unhintergehbar wie die Sprache. In den "Regeln der soziologischen<br />
Methode" schreibt Durkheim: »Übrigens darf man sich darüber nicht verwundern, da andere Naturerscheinungen<br />
in anderer Form dieselbe Eigenschaft zeigen, mittels deren wir die sozialen Phänomene<br />
definiert haben. Diese Ähnlichkeit rührt einfach davon her, daß die einen wie die anderen reale Dinge<br />
sind. Denn alles, was real ist, hat eine bestimmte Natur, die einen Zwang ausübt, mit dem man rechnen<br />
muß und die niemals überwunden wird, auch nicht, wenn man sie neutralisiert. Das ist im Grunde das<br />
Wesentliche an dem Begriffe des sozialen Zwangs. Sein Inhalt erschöpft sich darin, daß die kollektiven<br />
Handlungs– und Denkweisen eine Realität außerhalb der Individuen besitzen, die sich ihnen jederzeit<br />
anpassen müssen. Sie sind Dinge, die eine Eigenexistenz führen. Der Einzelne findet sie vollständig fertig<br />
vor und kann nichts dazu tun , daß sie nicht seien oder daß sie anders seien, als sie sind; er muß ihnen<br />
Rechnung tragen, und es ist <strong>für</strong> ihn um so schwerer (wenn auch nicht unmöglich), sie zu ändern, als sie<br />
in verschiedenem Grade an der materiellen und moralischen Suprematie teilhaben, welche die<br />
Gesellschaft über ihre Glieder besitzt.« (Durkheim 1901: 99f.)
54 Verzicht und Begehren<br />
Besitzrechte in Jäger/Sammler-Gesellschaften verwies, die Gabe kein Eigentum in<br />
unserem Sinne (absolute Verfügungsmacht über eine Sache). 84 Zweitens ist und<br />
bleibt sie notwendig mit der Person des Gebenden verknüpft; was am prägnantesten<br />
in Mauss' gerade zitierten Diktum, wonach etwas zu geben heißt, etwas von sich zu<br />
geben, zum Ausdruck kommt.<br />
Diese Bindung an die Person des Gebers unterscheidet die Gabe deutlich von<br />
der Ware: »Im zeitgenössischen westlichen Denken sehen wir es mehr oder weniger<br />
als gegeben, daß Dinge — physikalische Gegenstände und Rechte an ihnen — das<br />
natürliche Universum der Waren repräsentieren. Am entgegengesetzten Pol plazieren<br />
wir Menschen, die das natürliche Universum der Individuation und Eigenarten<br />
repräsentieren.« (Kopytoff 1986: 64) Die strikte Trennung von Personen und Dingen<br />
ist nicht nur ein Produkt unserer Gesellschaft; sie ist sogar eine ihrer Fundamentaldichotomien.<br />
Um nochmals Marcel Mauss zu bemühen: »Wir leben in einer<br />
Gesellschaft, die streng unterscheidet ... zwischen den dinglichen Rechten und<br />
den persönlichen Rechten, zwischen Personen und Sachen. Die Unterscheidung ist<br />
grundlegend, sie bildet einen Teil unseres Eigentums-, Verkaufs– und Tauschsystems.«<br />
(Mauss 1925: 120f.) Dem "primitiven Gemeinwesen", in dem »Geschenke<br />
noch obligatorisch sind, Sachen besondere Kräfte besitzen und einen Teil<br />
der Person ausmachen« (Ibid.: 139) ist diese Unterscheidung hingegen fremd. Ein<br />
Gut (Dinge, Grund und Boden, Arbeitskraft) veräußern zu können, erfordert die<br />
"Freiheit", beliebig über Produktionsmittel, die Produkte der eigenen Arbeit, die<br />
eigene Person verfügen zu können. Diese Freiheit haben die Menschen in fremden<br />
Kulturen in der Regel nicht, sie ist in den meisten Fällen stark eingeschränkt; die<br />
Ökonomie in diesen Gesellschaften auf eine bestimmte Weise "reguliert" — wie im<br />
einem von Margaret Mead aufgezeichneten Arapesh-Aphorismus paradigmatisch zum<br />
Ausdruck kommt: »Deine eigene Mutter, deine eigene Schwester, deine eigenen<br />
Schweine, deine eigenen Yams, die du aufgestapelt hast, darfst du nicht essen. Die<br />
Mütter anderer Leute, die Schwestern anderer Leute, die Yams anderer Leute, die<br />
sie aufgestapelt haben, das darfst du essen.« (nach Lévi-Strauss 1967: 75) Die "primitiven<br />
Ökonomien" gründen dergestalt in einem komplizierten und unhintergehbaren<br />
Geflecht wechselseitiger Ansprüche und Verpflichtungen, die im Gabentausch zum<br />
Ausdruck kommen.<br />
ZWANG UND TABU<br />
Der Gabentausch ist eine hochgradig normative Angelegenheit. Typischerweise ist<br />
vorgeschrieben, was wem wann zu geben ist, und in welcher Form und zu welchem<br />
Zeitpunkt die Erwiderung zu erfolgen hat. Dies gilt <strong>für</strong> alle seine Ausprägungen<br />
84 Ich muß auch bei dieser idealtypischen Kontrastierung darauf verweisen, daß die Rede von<br />
"unveräußerlichen" Dingen nur bezogen auf unseren Eigentumsbegriff Sinn macht. In den "primitiven"<br />
Gesellschaften dürfte man es mit einem relativ weitgespannten Kontinuum der Unveräußerlichkeit zu<br />
tun haben.
Verzicht und Begehren 55<br />
gleichermaßen. Die Menschen sind verpflichtet, zu geben, zu nehmen und zu erwidern.<br />
85 Und so kann es nicht verwundern, daß <strong>für</strong> einige Autoren der hauptsächliche<br />
Garant <strong>für</strong> die Erfüllung dieser Verpflichtungen direkter oder indirekter Zwang ist.<br />
Bronislaw Malinowski (dem man gewiß nicht vorwerfen kann, vom Mystizismus der<br />
Eingeborenen infiziert zu sein) stellt in seiner Abhandlung "Crime and Custom in<br />
Savage Society" ebenfalls die Frage, warum Verhaltensnormen in primitiven Gesellschaften<br />
eingehalten werden, wo doch ihre Befolgung mit strengen und lästigen<br />
Pflichten verbunden ist. Da die ethnographische Beobachtung (ihn) zu der Einsicht<br />
führte, daß "der Eingeborene" sich diesen Pflichten allzu oft nach Möglichkeit entzieht,<br />
können wir, so Malinowski, nicht annehmen, daß jener derartigen Regelsystemen<br />
"spontan" und "sklavisch" allein aus Ehrfurcht vor der Tradition folge. Er<br />
unterwirft sich vielmehr seinen Pflichten, weil er dazu genötigt ist — Zwang wird<br />
auf ihn von denjenigen ausgeübt, die etwas von ihm zu erhalten haben, wie er wiederum<br />
Druck auf diejenigen ausübt, die ihm verpflichtet sind. Dieses wechselseitige<br />
Verhältnis ist der Kernpunkt von Malinowskis Theorie: 86<br />
»Der soziale Zwang, die Achtung <strong>für</strong> die wirklichen Rechte und Ansprüche anderer sind im<br />
Denken und im Verhalten der Eingeborenen immer deutlich vorhanden. [...] Er ist auch uner-<br />
85 Der Kontrast zwischen "uns" und "ihnen" wird nochmals deutlich in Polanyis folgender Nachzeichnung<br />
von Meads Beschreibung des Lebens der Arapesh: »Der typische Arapesch-Mann wohnt zumindest<br />
einen Teil seiner Zeit (denn jeder Mann wohnt in zwei oder mehr Dörfern, sowie in den Gartenhütten,<br />
Hütten in der Nähe des Jagdbusches und in Hütten bei seiner Sagopalme) auf Boden, der ihm nicht<br />
gehört. Um das Haus befinden sich Schweine, die von seiner Frau gefüttert werden, die aber einem ihrer<br />
oder seiner Verwandten gehören. Neben dem Haus stehen Kokos– und Betelpalmen, die wiederum<br />
anderen Personen gehören und deren Früchte er niemals ohne die Erlaubnis des Besitzers oder einer<br />
Person berühren wird, dem vom Besitzer das Verfügungsrecht über die Früchte eingeräumt worden ist.<br />
Zumindest <strong>für</strong> einen Teil seiner Jagdzeit geht er auf das Buschland seines Schwagers oder Neffen jagen,<br />
in der restlichen Zeit schließen sich andere ihm auf seinem Buschland an, sofern er eines besitzt. Er<br />
gewinnt sein Sago in den Sagobeständen von anderen ebenso wie in den eigenen. Von seiner persönlichen<br />
Habe in seinem Haus sind alle Gegenstände von einigem Wert, etwa große Gefäße, schön geschnitzte<br />
Teller, gute Speere, bereits seinen Söhnen übertragen worden, obwohl sie noch Kleinkinder<br />
sind. Seine eigenen Schweine befinden sich fernab in anderen Dörfern; seine Palmen sind drei Meilen in<br />
der einen Richtung und zwei Meilen in der anderen Richtung verstreut, seine Sagopalmen sind noch<br />
weiter verstreut, und seine Gartenbeete befinden sich da und dort, meist aber auf dem Boden anderer.<br />
Wenn sich auf dem Räuchergestell über seinem Feuer Fleisch befindet, dann ist es entweder Fleisch, das<br />
von einem anderen erbeutet wurde, einem Bruder, einem Schwager einem Neffen etc., und ihm<br />
übergeben wurde: in diesem Fall dürfen er und seine Familie es verzehren; oder es handelt sich um<br />
Fleisch, das er selbst erbeutet hat und das er nun räuchert, um es jemandem anderen zu schenken, denn<br />
die eigene Beute zu verzehren, und sei es nur ein kleiner Vogel, ist ein Verbrechen, das nur moralisch<br />
verkommene Personen ... begehen würden. Auch wenn das Haus, in dem er sich befindet, nominell ihm<br />
gehört, so wurde es zumindest teilweise aus den Pfosten und Planken von anderen Leuten gehörenden<br />
Häusern errichtet, die auseinandergenommen oder zeitweilig verlassen wurden und von denen er sich<br />
das Holz ausgeborgt hat. Er wird die Dachbalken, wen sie zu lang sind, nicht zuschneiden, damit sie auf<br />
sein Haus passen, denn sie könnten später <strong>für</strong> das Haus eines anderen benötigt werden, das eine andere<br />
Form oder Größe hat.« (1957a: 157f., vgl. auch Mead 1937a)<br />
86 Die Argumentation Malinowskis — der nichts von einer Bindung des Einzelnen an die moralische<br />
Autorität der Gruppe oder der geheiligten Autorität des kollektiven Bewußtseins wissen will — zielt auf<br />
Durkheim. Konformität wird demnach nicht gewährleistet durch »eine bloße psychologische Kraft,<br />
sondern durch einen genau bestimmbaren sozialen Mechanismus.« (Malinowski zit. nach Gouldner<br />
1973: 94)
56 Verzicht und Begehren<br />
läßlich <strong>für</strong> das reibungslose Funktionieren ihrer <strong>Institut</strong>ionen. [...] Jeder, der weiß, wie gut<br />
und bereitwillig sie die Arbeit in ihren gewohnten Tätigkeiten verrichten, wird die Funktion<br />
und die Notwendigkeit des Zwangs erkennen, der aus der Überzeugung der Eingeborenen resultiert,<br />
ein anderer habe Anspruch auf ihre Arbeit.« (Malinowski 1926: 138)<br />
Die Verpflichtung den anderen gegenüber ist nach Malinowski sogar der wichtigste<br />
Anreiz zur Arbeit, was ihm auch sofort den utilitaristischen Wert der wechselseitigen<br />
Verpflichtung und des Zwangs erklärt. 87 — Man kann es also knapp fassen: ohne<br />
Zwang würde nichts getauscht. Malinowski zufolge haben die Eingeborenen zudem<br />
eine klare Vorstellung von den Folgen verweigerten Tauschs:<br />
»Ein Mann, der sich in seinen wirtschaftlichen Handlungen hartnäckig den Rechtsnormen entziehen<br />
würde, sähe sich sehr schnell außerhalb der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ordnung<br />
gestellt — und er weiß das. [...] Der ehrbare Bürger muß seinen Verpflichtungen nachkommen,<br />
und dies nicht, weil er irgendeinem Instinkt, irgendeinem intuitiven Impuls oder<br />
einem mysteriösen "Gruppengefühl" unterworfen ist, sondern kraft des detaillierten und entwickelten<br />
Funktionierens eines Systems, in dem jede Handlung ihren bestimmten Platz hat und<br />
ohne Ausnahme ausgeführt werden muß. Obwohl kein Eingeborener, und sei er auch noch so<br />
intelligent, diese Sachlage in allgemeine abstrakte Begriffe fassen oder sie als soziologische Theorie<br />
vortragen könnte, ist sich ein jeder der Existenz jenes Systems völlig bewußt und kann in<br />
jedem Fall die aus einer Handlung resultierenden Konsequenzen vorhersehen.« (Ibid.: 144f.)<br />
Die Menschen geben demnach unter dem Zwang der Verpflichtung, mit einem sehr<br />
wachsamen Blick <strong>für</strong> die Angemessenheit der Gaben und Gegengaben, und sie kalkulieren<br />
durchaus die (zu hohen) Risiken der Nichtbefolgung der gesellschaftlichen<br />
Normen. 88 Dieses Bild scheint mir aber ein wenig zu grob und nach unseren Maßstäben<br />
gezeichnet, um wirklich zu überzeugen. 89 Um das Spannungsfeld, in welchem<br />
87 »Man muß wohl kaum hinzufügen, daß es außer dem Zwang gegenseitiger Verpflichtungen noch<br />
andere treibende Motive gibt, die die Fischer ihre Aufgabe erfüllen lassen. Die Nützlichkeit des Tuns,<br />
das Streben nach frischer, ausgezeichneter Nahrung und vielleicht am stärksten der Reiz dessen, was <strong>für</strong><br />
die Eingeborenen ein äußerst faszinierender Sport ist — all das bewegt sie offensichtlicher, bewußter<br />
und effektiver als das, was wir als rechtliche Verpflichtung beschrieben haben.« (Ibid.) Dennoch ist das<br />
Bewußtsein um den Zwang nach Malinowski stets präsent.<br />
88 Im übrigen empfinden die Eingeborenen nach Malinowski geradezu Abscheu Veränderungen und<br />
(sozialer oder ökonomischer) Dynamik gegenüber: »Die soziale Hauptkraft, die das gesamte<br />
Stammesleben beherrscht, könnte als Beharrungsvermögen der Bräuche, als Liebe zur Gleichförmigkeit<br />
des Verhaltens, beschrieben werden. Der große Moralphilosoph [gemeint ist Kant] irrte, als er seinen<br />
kategorischen Imperativ formulierte, der den Menschen als eine grundlegende Maxime ihres Verhaltens<br />
dienen sollte. Indem er uns riet, so zu handeln, daß unser Verhalten als Norm <strong>für</strong> ein allgemeines Gesetz<br />
genommen werden könnte, kehrte er den natürlichen Zustand der Dinge um. Das wirkliche Gesetz, das<br />
das Verhalten der Menschen bestimmt, lautet: "Was jeder andere auch tut, was als allgemeine<br />
Verhaltensnorm erscheint, das ist richtig, moralisch und geboten. Laß mich über den Zaun schauen und<br />
sehen, was mein Nachbar tut, und es als Regel <strong>für</strong> mein Verhalten nehmen". So handelt jeder 'Mann auf<br />
der Straße' in unserer Gesellschaft, so haben die durchschnittlichen Mitglieder jeder Gesellschaft in der<br />
Vergangenheit immer gehandelt, und so handelt der Wilde von Heute; und je niedriger der Stand seiner<br />
kulturellen Entwicklung, desto mehr wird er <strong>für</strong> gute Sitten, Anstand und Form eifern und desto<br />
unverständlicher und abstoßender wird ihm der nonkonformistische Standpunkt vorkommen.« (Ibid.:<br />
363f.)<br />
89 Zu allem Überfluß sind Malinowskis Beschreibungen bei genauerer Betrachtung recht widersprüchlich.<br />
Malinowskis "Funktionalismus" ist häufig lediglich ein kruder Utilitarismus, d.h. alle kulturellen<br />
Praktiken zielen auf einen materiellen Endzweck. Seine Argumentation ist verwandt mit derjenigen
Verzicht und Begehren 57<br />
die im Tausch gründende menschliche Kultur (vermeintlich) situiert ist, aus einer<br />
anderen Perspektive etwas differenzierter zu illustrieren, bemühe ich erneut Pierre<br />
Clastres' bereits im 1. Kapitel zitierte Guayaki-Monographie. 90 Das Szenario ist vertraut:<br />
der Jäger hat seine Beute an seine Frau abzugeben, die sie zubereitet und anschließend<br />
verteilt, er wird nichts von "seinem" Fleisch, sondern nur das der anderen<br />
verspeisen. Er ist somit auf ewig vom Produkt seiner Tätigkeit abgeschnitten<br />
(diesem aber natürlich nicht in dem Sinne entfremdet wie Marx' Lohnarbeiter). Der<br />
Jäger fügt sich offensichtlich ohne Murren in diese seine Pflicht — das ist die Tagseite<br />
der Gesellschaft, Tausch und wechselseitige Abhängigkeit. Nachts singen die<br />
Männer, halb träumen sie:<br />
»Fast übergangslos ist die Nacht über den Wald herabgesunken, und die Masse der großen<br />
Bäume scheint näherzurücken. Und mit der Dunkelheit bricht auch die Stille herein. [...] Man<br />
könnte meinen, daß auch die Männer schlafen, die neben ihrem Feuer sitzen und stumm und<br />
regungslos Wache halten. Aber sie schlafen nicht, und in ihrem nachdenklichen Blick, von der<br />
Dunkelheit ringsum gefesselt, liegt verträumte Aufmerksamkeit. Denn die Männer halten sich<br />
bereit, diesen Abend zu singen [...] Bald erhebt sich eine Stimme, kaum wahrnehmbar zunächst,<br />
so tief kommt sie von innen, ein behutsames Murmeln, das noch nichts artikuliert, sich<br />
geduldig der Suche nach einem treffenden Ton und einer treffenden Rede widmet. Doch allmählich<br />
schwillt sie an, der Sänger ist sich seiner nun sicher, und plötzlich bricht sein Gesang<br />
frei und gespannt, laut schallend empor. Angespornt gesellt sich eine zweite Stimme zur ersten,<br />
dann noch eine, sie schleudern hastige Worte, wie Antworten auf Fragen, denen sie stets<br />
zuvorkommen würden. Jetzt singen alle Männer. Immer noch sitzen sie reglos, mit etwas verlorenem<br />
Blick; sie singen alle zusammen, aber jeder singt sein eigenes Lied. Sie sind Herren<br />
der Nacht, und jeder will darin Herr über sich selbst sein.« (Clastres 1974: 99f.)<br />
Alle singen zusammen, aber jeder <strong>für</strong> sich. Die Jäger berauschen sich an ihrem Gesang,<br />
in dem sie sich selbst loben: ihre Erfolge, ihre Heldentaten bei der Jagd. »Und<br />
oftmals, wie um herauszustreichen, wie sehr sein Ruhm außer Frage steht, beendet<br />
er seinen Satz mit einem kräftigen Cho, cho, cho: "Ich, ich, ich".« (Ibid.: 110) Im<br />
Rausch des Gesangs verändern sich die Worte, sie sind entstellt, <strong>für</strong> den Ethnologen<br />
nicht mehr verständlich. Zwei Gegensätze spiegeln sich nach Clastres in diesem Ge-<br />
Thurnwalds, der als erster im Prinzip der Gegenseitigkeit die Grundlage rechtlicher <strong>Institut</strong>ionen sah.<br />
Thurnwald schreibt: »Das Verlangen nach "billigen" Gegenleistungen durchzieht das gesamte<br />
Rechtsleben.« und fährt fort: »Nicht die Furcht vor einer Strafe ist es, welche etwa die Gegenseitigkeit<br />
aufrechterhält, sondern das Gefühl, im eigenen Interesse zu handeln. Die unter den Mitgliedern einer<br />
Gesellungseinheit herrschende Forderung der einen Persönlichkeit gegenüber der anderen trägt den<br />
Zusammenschluß [...] Dieses Prinzip wendet sich gegen den, der sich nicht an diese gerechte Entgeltung<br />
hält, und auf ihr ist andererseits, im positiven Sinn, das gesamte Obligationenrecht aufgebaut. Es<br />
beherrscht das Zusammenleben der Menschen aller Zeiten und Kulturen.« (1936: 97) Das klingt<br />
allerdings wesentlich differenzierter als Malinowskis Formulierung: »Nehmen wir den wirklichen<br />
Wilden, darauf bedacht, seinen Pflichten auszuweichen, prahlerisch und großtuerisch, wenn er sie erfüllt<br />
hat, und vergleichen wir ihn mit dem angeblichen Mustereingeborenen des Anthropologen, der sklavisch<br />
dem Brauch folgt und automatisch jeder Regel gehorcht. Es besteht nicht die entfernteste Ähnlichkeit<br />
zwischen den Lehren der Anthropologie auf diesem Gebiet und der Wirklichkeit des Lebens der<br />
Eingeborenen.« (1926: 139)<br />
90 Allerdings nicht weil uns diese Indianer eine bestimmte "Wahrheit" besonders deutlich vor Augen<br />
führten, sondern weil der Ethnologe sie so hervorragend stilisiert.
58 Verzicht und Begehren<br />
sang: 91 ganz offensichtlich derjenige zwischen Männern und Frauen — ebenso<br />
scharf, wie bei den Aché das männliche vom weiblichen Universum getrennt ist, unterscheidet<br />
sich auch der männliche vom weiblichen Gesang 92 — im Verborgenen<br />
jedoch, und <strong>für</strong> Clastres bedeutsamer, der Gegensatz zwischen Mann und Mann, Jäger<br />
und Jäger. Sie teilen die Frauen wie die Jagdbeute. Aufgrund der demographischen<br />
Situation sind polyandrische Ehen sehr häufig. »Im einen Fall sieht sich der<br />
Mann radikal vom Produkt seiner Jagd getrennt, da er es nicht konsumieren darf, im<br />
anderen Fall ist er niemals vollständig ein Gatte, sondern bestenfalls ein halber Gatte.«<br />
(Ibid.: 117f.)<br />
Für Clastres, der an Lévi-Strauss' Auffassung anknüpft, wonach der Tausch<br />
der Güter, der Tausch der Frauen (Heirat) und schließlich der Tausch der Wörter<br />
(als Nachrichten) gleichwertig und auf einen gemeinsamen Nenner zurückzuführen<br />
sind, 93 verhält sich das Wild zum Jäger wie die Frau zum Gatten, das Wort zum<br />
Mann. Im Gesang der Männer kommt somit, ausgesprochen-unausgesprochen, der<br />
(unbewußte) Widerstand gegen den Tausch zum Ausdruck: »In ihrem Gesang drücken<br />
die Männer sowohl das ungedachte Wissen um ihr Schicksal als Jäger und Gatten<br />
wie den Protest gegen diese Schicksal aus.« (Ibid.: 119) 94 Auf der <strong>für</strong> den Bestand<br />
der Gesellschaft ungefährlicheren Ebene des Gesangs praktizieren die Jäger<br />
das, dessen sie sich ansonsten enthalten müssen. Sie verweigern symbolisch den<br />
Tausch, verneinen ihn in ihrem individuellem Lobgesang: "Ich, ich, ich!". Infolgedessen<br />
nimmt <strong>für</strong> Clastres »der Gesang der Jäger eine umgekehrt symmetrische Position<br />
zu der des Nahrungstabus und der Polyandrie ein, und er zeigt, durch seine<br />
Form, wie durch seinen Inhalt, daß die Männer sie als Jäger und Gatten verleugnen<br />
möchten.« (Ibid.) Nur der Jäger selbst lauscht seinem Gesang, nur ihm gilt seine<br />
Botschaft, keinem sonst. Die Sprache, ihrer Kommunikationsfunktion beraubt, wird<br />
sozial absurd. »Gefangene eines Tauschs, der sie nur als Elemente eines Systems be-<br />
91<br />
Der Gesang selbst hängt einzig von der Stimmung des Jägers ab und ist eine persönliche Improvisation.<br />
92<br />
Letzterer ist stets eine Klage, ein Weinen fast. Er begleitet die rituellen Zeremonien, und er handelt<br />
stets von Krankheit, Gewalt (der Weißen) und Tod — er ist niemals fröhlich. Die Frauen singen bei<br />
Tage, zumeist im Chor.<br />
93<br />
Ich gehe im folgenden Kapitel ausführlich auf diesen Ansatz ein.<br />
94 Für die Guayaki besteht allerdings eine durchaus bedeutsame Differenz zwischen beiden Formen des<br />
Teilens. »Wir müssen nämlich betonen, daß von den Indianern die Pflicht, das Wild herzugeben, keinesfalls<br />
als solche erfahren wird, während die Pflicht, die Gattin zu teilen, als Entäußerung empfunden<br />
wird.« (Ibid.: 118) Damit widersprechen die Guayaki in gewissem Sinn dem Ethnologen, der diese<br />
Beobachtungen machte. Denn Clastres sieht in diesem "Teilen" der Frauen ein Element der Gegenseitigkeit:<br />
»Hier bestimmt sich die strukturale Beziehung des Mannes zum Wesen der Gruppe, d.h. zum<br />
Tausch. In der Tat verweisen das Geschenk des Wildes und die Teilung der Gattinnen jeweils auf zwei<br />
der drei Hauptpfeiler, auf denen das Gebäude der Kultur ruht: der Tausch der Güter und der Tausch der<br />
Frauen.« (Ibid.: 119) Doch das Unbehagen, welches die Aché-Männer angesichts der Polyandrie<br />
verspüren, spiegelt gerade den Mangel an Gegenseitigkeit wider, den ihre demographische Situation erzeugt:<br />
Ich gebe meine Schwester und erhalte eine halbe Gattin. Der Tod des Nebengatten wird mit unverhohlener<br />
Befriedigung zur Kenntnis genommen: »"Ich bin zufrieden", sagte er, "jetzt bin ich der einzige<br />
Mann meiner Frau".« (Ibid.: 115)
Verzicht und Begehren 59<br />
stimmt, sehnen sich die Guayaki danach, sich seinen Forderungen zu entziehen, doch<br />
ohne es auf der Ebene ablehnen zu können, wo sie es erfüllen und ihm unterliegen.«<br />
(Ibid.: 120) In der Einsamkeit seines nächtlichen Gesangs träumt der Guayaki-Jäger<br />
demnach singend einen Traum: nicht dem Gesetzen des Tauschs unterworfen zu<br />
sein, die Güter und die Frauen ebenso bei sich behalten zu können wie die nur <strong>für</strong><br />
sich selbst bestimmten Worte seines Gesangs — der etwas zeigt, was die Guayaki<br />
vielleicht nicht sagen, vielleicht noch nicht einmal denken dürfen.<br />
Wenn Gesellschaft im Tausch gründet, so gründet sie zwangsläufig in einem<br />
doppelten Verzicht. Erstens einem Verzicht darauf, sich die Dinge des anderen gewaltsam<br />
anzueignen und zweitens einem Verzicht auf die Dinge, die ich dem anderen<br />
gebe bzw. zu geben habe — um einer aufgeschobenen, gesicherten Befriedigung<br />
des eigenen Begehrens willen. Moderner formuliert: der soziale Prozeß zielt unter<br />
diesem Blickwinkel darauf ab, eine ungesicherte individuelle Maximierung durch eine<br />
gesicherte kollektive Maximierung zu ersetzen. Aber auch wenn der Tausch dem<br />
Menschen all die Vorzüge des Lebens mit den anderen beschert, und jeder letztlich<br />
ebensoviel erhält, wie er gab, wird der notwendig zu leistende Verzicht unter Umständen<br />
allzu oft als schmerzlich empfunden. 95 Claude Lévi-Strauss schreibt in der<br />
Schlußpassage der "Elementaren Strukturen der Verwandtschaft":<br />
»Bis heute hat die Menschheit davon geträumt, jenen flüchtigen Augenblick zu fassen und festzuhalten,<br />
da es erlaubt war zu glauben, man könne das Gesetz des Tauschs überlisten, man<br />
könne gewinnen ohne zu verlieren, genießen ohne zu teilen. An beiden Enden der Welt und<br />
an beiden Enden der Zeit entsprechen einander der sumerische Mythos vom goldenen Zeitalter<br />
und der Mythos der Andamanen vom zukünftigen Leben: <strong>für</strong> den einen ist das Ende des<br />
ursprünglichen Glücks der Zeitpunkt, da die Verwirrung der Sprachen die Wörter zur Sache<br />
aller machte; der andere beschreibt die Glückseligkeit des Jenseits als einen Himmel, in dem<br />
die Frauen nicht mehr ausgetauscht werden, d.h. er verweist die dem gesellschaftlichen Menschen<br />
auf ewig versagten Freuden einer Welt, in der man unter sich leben könnte, in eine<br />
gleichermaßen unerreichbare Vergangenheit oder Zukunft.« (1967: 663)<br />
Den Gesetzen des Tauschs entrinnen, etwas behalten, frei darüber verfügen zu können<br />
— sich tausch-los selbst genügen: Freiheit als Abwesenheit von Verpflichtung,<br />
von Abhängigkeit. Frei zu geben, wem ich will, frei zu nehmen, von wem ich will<br />
— und was ich will. Diese Freiheit besitzen die Menschen, zumindest in der "primitiven"<br />
Gesellschaft, nicht. Scheinbar gefangen in der unauflösbaren Diskrepanz zwischen<br />
ihren Begierden und den gesellschaftlichen Anforderungen bleibt den Guayaki<br />
nichts anderes als ihr Gesang. Aber warum sollten sie sich damit begnügen?<br />
Um diese Frage zu beantworten, muß man zunächst einen Blick auf das<br />
Selbstverständnis des Guayaki-Mannes als Jäger werfen. Wie gesehen, geht es im<br />
Gesang der Männer vor allem darum, sich als großer Jäger zu präsentieren. Die Jagd<br />
95 Freuds "Realitätsprinzip" (Verzicht auf spontane Bedürfnisbefriedigung zugunsten einer langfristig<br />
gesicherten) ist in seiner institutionalisierten Form Sinnbild der elementaren Rationalität des gesellschaftlichen<br />
Lebens, welches dem Zufall und der Willkür Ordnung und Berechenbarkeit entgegenstellt,<br />
und es scheint unter diesem Blickwinkel tatsächlich gut geeignet, das "Wesen" des Tauschs zu<br />
beschreiben.
60 Verzicht und Begehren<br />
ist bei diesen Indianern fraglos normativ und motivational überdeterminiert, sie »ist<br />
ein fortwährendes Abenteuer, manchmal gefährlich, doch immer begeisternd.«<br />
(Clastres 1972: 186) Und jeder will ein großer Jäger sein. »Bareka, jagen, das ist ihre<br />
Aufgabe, mit der sie sich identifizieren und auf die sie sich strikt beschränken. Ein<br />
Mann kann sich nichts anderes vorstellen, als Jäger zu sein, und man könnte nicht<br />
gleichzeitig ein Mann und kein Jäger sein. Der ganze symbolhafte Raum der Männlichkeit<br />
entfaltet sich im jyrvö, im Pfeile schießen [...] Jäger sein oder nicht sein. Sie<br />
haben keine Wahl.« (Ibid.: 184f.) Pane zu werden, dauerhaft Pech bei der Jagd zu<br />
haben, ist die größte Furcht der Guayaki-Männer. »Um ein bretete [ein Jäger] zu<br />
sein, muß man kräftig, geschickt und beweglich sein; man muß einen Zustand erreichen,<br />
in dem Körper und Geist sich wohl fühlen, ihrer selbst sicher sind: das ist<br />
paña. Paña: pane-iä, das Gegenteil von pane. Und pane ist das wohl, was einem<br />
Mann am meisten Angst einjagt.« (Ibid.) Der Mann der kein Jäger ist, ist kein Mann.<br />
Schlimmer noch: »Wenn ich pane bin, was <strong>für</strong> eine Gegenleistung könnte ich anbieten,<br />
mit welchem Wild kann ich die Gabe wieder ausgleichen? Man kann nicht nehmen<br />
ohne zu geben, man kann nicht gleichzeitig pane sein und das Gesetz der Gegenseitigkeit<br />
einhalten. Schließlich werden die Gefährten es leid, immer nur zu geben,<br />
ohne je etwas da<strong>für</strong> zu bekommen.« (Ibid.: 187) Doch pane wird der Mann<br />
nicht ohne Grund, es ist die Folge der schwersten vorstellbaren Verfehlung, nämlich<br />
»wenn ein Jäger den Tausch verweigerte, d.h. von seinem eigenen Wild äße: eine so verhängnisvolle<br />
Tat, daß es keinem auch nur momentan in den Sinn käme, derart mit dem Feuer<br />
zu spielen. Mit jedem Versuch, etwas <strong>für</strong> sich zu behalten, handelte man sich nur die völlige<br />
und endgültige Trennung von der Welt der Tiere ein [...] Wer nicht seine Beziehung<br />
zur Nahrung mit seiner Beziehung zu den Gefährten in Einklang bringen will, riskiert ganz<br />
einfach, von der Welt der Natur abgeschnitten und schließlich ausgestoßen zu werden —<br />
ebenso, wie man selbst das soziale Universum verlassen hat, indem man sich der Teilung der<br />
Güter entzogen hat.« (Ibid.: 188) 96<br />
Der Traum von Freiheit, Bindungslosigkeit, ist nicht mit den Gesetzen des Tauschs,<br />
die diejenigen der Gesellschaft sind, vereinbar. Genau, wie die Menschen gezwungen<br />
sind, zu nehmen, müssen sie geben, ob sie wollen oder nicht. In einer auf wechselseitigem<br />
Verzicht und Tausch beruhenden Kultur darf ich mitnichten frei entscheiden<br />
können, wem ich gebe oder von wem ich nehme; dies würde das soziale<br />
Band an sich in Frage stellen.<br />
Unter Bezugnahme auf Adam Smith könnte man angesichts dieser restriktiven<br />
Regulierung der Güterdistribution vermuten, den Menschen müsse so lange die "rationale"<br />
Verfolgung ihres ökonomischen Eigeninteresse verwehrt werden, bis die <strong>Institut</strong>ion<br />
des Marktes dieses in den Dienst der gesellschaftlichen Integration stellt.<br />
Folgt man Clastres, so heißt im Universum des von präskriptiven Normen regulier-<br />
96 Die Negation des Tauschs könnte im scheinbar individuellen Gesang der Indianer bereits institutionalisiert<br />
sein. Zwar kommt es gar nicht in Frage, den Tausch zu verweigern, aber es ist zumindest<br />
vorstellbar, daß seine Verweigerung inszeniert, "repräsentiert" (im Sinne von vorstellen/darstellen)<br />
wird, um sie zu bannen. Der Gesang der Jäger wäre somit nicht allein Ventil <strong>für</strong> unterdrücktes Streben,<br />
er brächte zugleich dessen Unmöglichkeit zum Ausdruck.
Verzicht und Begehren 61<br />
ten Gabentauschs Verweigerung tatsächlich Tod. Die Bedrohung des Zerfalls ist<br />
demnach allerdings auf einer viel weniger dramatischen Ebene angesiedelt als der<br />
Krieg von Bruder gegen Bruder. Es ist im Gegenteil die stets präsente Möglichkeit<br />
eines eher passiven Aktes, einer Geste der Verweigerung um der eigenen direkten<br />
und unmittelbaren Befriedigung willen, welche die Gesellschaft bedroht. Es bedarf<br />
dazu keines Wolfes im Menschen. Allein aufgrund der (potentiellen) Negation des<br />
Tauschs bedroht jegliches Streben nach Selbstgenügsamkeit die "primitive" Gesellschaft,<br />
da "Autonomie" (nicht allein dort) in einem gewichtigen Sinn nur gegen die<br />
anderen gedacht werden kann. Muß aus diesem Grund ein mächtiges, unbedingtes<br />
Tabu die potentielle Verweigerung des Tauschs verhindern?<br />
DAS SOZIALE BAND<br />
Man könnte Clastres' Analyse durchaus auf folgende funktionalistische Argumentation<br />
hin zuspitzen: Der Guayaki <strong>für</strong>chtet sich vor den Folgen der Tabuverletzung<br />
(äße er von seiner Jagdbeute, wäre er pane, könnte kein Wild mehr erbeuten), deshalb<br />
gibt er, und indem er gibt, perpetuiert er das soziale Band zwischen ihm und<br />
seinen Gefährten. Letzteres wäre ihm nicht bewußt. 97 Ich halte es aber <strong>für</strong> einigermaßen<br />
unglaubwürdig, daß er allein der Angst vor den von ihm selbst angegebenen<br />
Folgen "undenkbarer" Handlungen folgt — und hier komme ich zum entscheidenden<br />
Punkt: Dem Indianer dürfte der soziale "Wert" und der symbolische Charakter<br />
des Tauschs wesentlich bewußter sein, als wir gemeinhin glauben möchten,<br />
auch wenn er dieses Bewußtsein nicht in unseren Termini zum Ausdruck bringt.<br />
Wenn Clastres schreibt: »Was uns die Gesänge der Guayaki-Indianer letztlich in Erinnerung<br />
rufen, ist die Erkenntnis, daß man nicht auf allen Ebenen gewinnen kann,<br />
daß man die Regeln des sozialen Lebens nicht mißachten kann und daß die Faszination,<br />
nicht mehr an ihm teilzunehmen, zu einer großen Illusion führt« (1972: 121),<br />
kann es ebensogut ihre Einsicht sein, nicht allein diejenige des Ethnologen. Und die<br />
Furcht vor den Folgen einer Normverletzung schließt die Einsicht in den sozialen<br />
Wert der Norm nicht prinzipiell aus; auch wenn letztere vorhanden ist, sind unbedingte<br />
moralische Regeln ein probateres Mittel, den sozialen Zusammenhalt sicherzustellen.<br />
Sie könnten tatsächlich eine Art Gesellschaftsvertrag sein: "rationale<br />
Selbstbindung" gegen antizipierte eigene Irrationalität.<br />
Das Konzept der rationalen Selbstbindung stammt von Jon Elster, der<br />
schreibt: »Selbstbindung ist ein vorrangiger Weg, das Problem der Willensschwäche<br />
zu lösen, die entscheidende Technik, Rationalität durch indirekte Mittel zu erlan-<br />
97 Eine treffende Skizze der derartigen funktionalistischen Argumenten zugrundeliegenden »impliziten<br />
regulativen Idee« liefert Jon Elster: »Wenn man zeigen kann, daß ein gegebenes Verhaltensmuster nichtintendierte,<br />
unerkannte und vorteilhafte Wirkungen hat, dann hat man ebenfalls erklärt, warum es<br />
existiert und Bestand hat.« (1979: 60) Der Funktionalismus verdoppelt (wie z.B. auch die<br />
Psychoanalyse) in gewissem Sinne die Realität: der Handelnde tut nicht das, was er eigentlich zu tun<br />
glaubt, und die von ihm selbst angegeben Ziele seiner Handlung sind ganz andere als die tatsächlichen<br />
Ziele, die er sozusagen "implizit" verfolgt.
62 Verzicht und Begehren<br />
gen.« (1979: 68) Elster bemüht zur Illustrierung die bekannte Episode von Odysseus<br />
und den Sirenen: 98<br />
»... doch bindet mich fest, damit ich kein Glied zu rühren vermöge ... Fleh ich aber euch an<br />
und befehle die Seile zu lösen: Eilend fesselt mich dann mit mehreren Banden noch stärker!«<br />
als Beispiel <strong>für</strong> eine Selbstbindung im wahrsten Sinn des Wortes: »Odysseus war nicht gänzlich<br />
rational, denn ein rationales Wesen hätte nicht zu diesem Mittel greifen müssen; er war aber<br />
auch nicht einfach der passive und irrationale Spielball seiner wechselnden Wünsche und Bedürfnisse,<br />
denn er konnte mit indirekten Mitteln sein Ziel erreichen, das eine rationale Person<br />
auf direkte Art und Weise realisiert hätte. Sein Dilemma — schwach zu sein und davon zu wissen<br />
— verweist auf die Notwendigkeit, einer Theorie unvollständiger Rationalität, die von Philosophen<br />
und Sozialwissenschaftlern fast gänzlich vernachlässigt worden ist.« (Ibid.: 67) »Um das<br />
spezifisch Menschliche vollständig zu charakterisieren, bedarf es wenigstens dreier Merkmale.<br />
Der Mensch kann rational sein, in dem Sinne, daß er bewußt auf jetzige Gratifikation zugunsten<br />
zukünftiger verzichtet. Der Mensch ist oft nicht rational und zeigt statt dessen Willensschwäche.<br />
Auch wenn der Mensch nicht rational ist, weiß er, daß er irrational ist, und kann sich selbst binden,<br />
um sich vor der Irrationalität schützen. Diese zweitbeste oder unvollständige Rationalität<br />
beachtet sowohl die Vernunft wie die Leidenschaft.« (Ibid: 140)<br />
Zwei zentrale Fragen stellen sich an dieser Stelle: in welchem Sinne liegen erstens<br />
Verzicht und Gabentausch im "Interesse" der Tauschenden und inwieweit sind zweitens<br />
die Menschen in der Lage, dies zu erkennen? 99 Ich verweile bei den Jägern und<br />
Sammlern. Auf einer ersten Ebene hat das Teilen der Jagdbeute zweifellos einen utilitaristischen<br />
Aspekt; der Tausch ist nützlich (auch wenn er auf lange Sicht ein ökonomisches<br />
Nullsummenspiel sein mag): Ausgewogenheit via Abhängigkeit. Die Konvention<br />
sichert der Gruppe eine ausgeglichene Ernährung, da jedes Mitglied nahezu<br />
98 Der Akt der Selbstbindung kann entweder auf eine Änderung in der realisierbaren Menge von<br />
Möglichkeiten gerichtet sein oder auf eine Änderung im "Mechanismus", der eine dieser Möglichkeiten<br />
auswählt. (vgl. Ibid: 107) Die zweite wird von Elster als "endogener Präferenzwandel" bezeichnet und<br />
soll hier nicht weiter interessieren, obwohl Elsters Argumentation darauf zielt. Sein Ansatz ist letztlich<br />
zu trivial, um wirklich produktiv zu sein. Dies allein aufgrund der Tatsache, daß die Theorie der rational<br />
choice als normative Theorie Ziele und Präferenzen der Menschen nicht reflektiert. »Sie sagt uns, was wir<br />
tun müssen, um unsere Ziele so gut wie möglich zu erreichen. Sie sagt uns nicht, was unsere Ziele sein<br />
sollten.« (Elster 1986: 1)<br />
99 Einen derartigen Akt rationaler Selbstbindung präsentiert überraschenderweise auch Sigmund Freud.<br />
Für diesen entsprang das Inzesttabu auch einer ursprünglichen Einsicht der Brüder. Er schreibt in Totem<br />
und Tabu: »Die beiden Tabu des Totemismus ... sind psychologisch nicht gleichwertig. Nur das eine, die<br />
Schonung des Totemtieres, ruht ganz auf Gefühlsmotiven; der Vater war je beseitigt, in der Realität war<br />
nichts mehr gutzumachen. Das andere aber, das Inzestverbot, hatte auch eine starke praktische<br />
Begründung. Das sexuelle Bedürfnis einigt die Männer nicht, sondern entzweit sie. Hatten sich die<br />
Brüder verbündet, um den Vater zu überwältigen, so war jeder des anderen Nebenbuhler bei den<br />
Frauen. Jeder hätte sie wie der Vater alle <strong>für</strong> sich haben wollen, und im Kampfe aller gegen alle wäre die<br />
neue Organisation zugrunde gegangen. Es war kein Überstarker mehr da, der die Rolle des Vaters mit<br />
Erfolg hätte aufnehmen können. Somit blieb den Brüdern, wenn sie miteinander leben wollten, nichts<br />
übrig, als — vielleicht nach Überwindung schwerer Zwischenfälle — das Inzestverbot aufzurichten.«<br />
(1912/13: 427f.) Damit sagt Freud nicht mehr, als daß der einzige Weg, den Urzustand zu überwinden,<br />
ein Vertrag (d.h. die Aufrichtung des unbedingt gültigen Tabu) ist, der zwischen den Brüdern geschlossen<br />
wird, der Einsicht in den antisozialen Charakter ihrer eigene Begierde folgend. Man sollte das nicht<br />
überbewerten, dieser Aspekt wird der Vielschichtigkeit des Freudschen Denkens kaum gerecht, führt<br />
aber zu einer interessanten Hypothese: Man kann postulieren, daß Freuds "wissenschaftlicher Mythos"<br />
von der Urvatertötung die Emergenz von (sozialer) Ordnung aus (individueller) Handlungsrationalität<br />
beschreibt.
Verzicht und Begehren 63<br />
die gleiche Portion Fleisch erhält. Existierte die Regel nicht, würden die Familien<br />
derjenigen, die Beute machten, schlemmen, während die anderen hungerten. Ein absurdes<br />
Bild — zumindest was die "Primitiven" betrifft. 100 Der Nutzenaspekt greift<br />
aber noch weiter: »Die Batek selbst wissen um die Bedeutung des Teilens der Nahrung<br />
<strong>für</strong> das Überleben der Gruppe. Sie sind sich sowohl der Unwägbarkeiten der<br />
Nahrungsbeschaffung als auch der ständig präsenten Bedrohung, krank zu werden<br />
und damit unfähig, <strong>für</strong> sich selbst zu sorgen, durchaus bewußt.« (Endicott 1988:<br />
120) In Sammler/Jäger-Gesellschaften, wo unvermeidlich mal diese und mal jene<br />
Familie bei der täglichen Nahrungsbeschaffung erfolglos ist, ist es zweckmäßig, das<br />
Prinzip des Teilens zur fundamentalen Regel zu machen. »Der Anfälligkeit gegenüber<br />
Engpässen in der Nahrungsmittelversorgung kann durch die <strong>Institut</strong>ionalisierung<br />
andauernden Teilens innerhalb der örtlichen Gemeinschaft begegnet werden.<br />
Ich denke, dies ist der beste Weg Tabus zu interpretieren die dem Jäger untersagen,<br />
von ihnen erbeutetes Wild zu essen, oder die weniger drastische und geläufigere<br />
Vorschrift, daß große Tiere im Lager verteilt werden.« (Sahlins 1972: 212) 101<br />
Derartige Regeln haben üblicherweise großes moralisches Gewicht. Das Tabu, mit<br />
dem die Guayaki die Jagdbeute belegen, "erzeugt" somit eine totale Interdependenz<br />
zwischen jedem Jäger und seinen Gefährten; ohne sie müßte er verhungern, während<br />
seine Beute verwest. Der Jäger könnte also auf die Frage, warum er nicht von<br />
seinem Wild ißt, antworten: "Heute gebe ich, morgen gibt mein Gefährte. Es wäre<br />
doch absurd, ihn hungern zu lassen, wenn ich mehr als genug Fleisch habe. Und ich<br />
(meine Familie) hätte dann vielleicht morgen nichts zu essen. Und überhaupt: wäre<br />
ich krank, müßte ich verhungern." Das wäre eine rationale Begründung der Norm<br />
und des Tabu. Aber diese Argumentation hat noch eine gewichtige Schieflage: sie<br />
kann die vermeintliche Angst vor den drastischen Folgen, die eine Tabuverletzung<br />
angeblich nach sich zieht, nicht erklären. Warum sollten die Indianer sich vor pane<br />
<strong>für</strong>chten, wenn sie in der Lage wären, einen derart "rationalen" Diskurs zu führen?<br />
Vielleicht <strong>für</strong>chten sie sich gar nicht davor.<br />
Der Ethnologe jedenfalls steht in der Regel vor einem Übersetzungsproblem,<br />
und es mag sehr wohl sein, daß er die Metaphern (und Metonymien) des Indianers<br />
als solche nicht erkennt und wörtlich nimmt. Es ist durchaus denkbar, daß jener viel<br />
weniger an die antizipierten Folgen des verweigerten Tauschs als an die faktische<br />
Notwendigkeit glaubt, den Tausch zu vollziehen. Er könnte schließlich ebensogut<br />
100 In der globalen Marktökonomie ist dies leider der Normalzustand.<br />
101 Andauernde Unterschiede den Wohlstand oder die Möglichkeit, Dinge zu erlangen, betreffend<br />
würden die soziale Funktion des ausgeglichen reziproken Tauschs unterminieren. »Soweit der Tausch<br />
ausgeglichen ist, würde die eine Seite ein Opfer bringen, welches die andere Seite nicht benötigt.«<br />
(Sahlins 1972: 211) Je größer das Gefälle ist, um so mehr neigt sich die Waagschale in Richtung<br />
generalisierter Reziprozität, da nur diese ökonomische Differenzen nicht per se sozial reproduziert und<br />
ein andauerndes Gefälle toleriert. In der Regel aber wird dort, wo man die Nahrung teilt, sich jeder von<br />
Zeit zu Zeit in Schwierigkeiten befinden. Wie Sahlins es formuliert: Knappheit und nicht Überfluß<br />
macht die Menschen großzügig.
64 Verzicht und Begehren<br />
sagen: "Wie könnte ich mein Fleisch <strong>für</strong> mich behalten. Das sind meine Gefährten.<br />
Ich würde sie niemals hungern lassen; ebensowenig wie sie mich. Wer nicht tauscht<br />
ist kein Jäger, ist kein Mensch." Denn pane meint auch den Ausschluß aus dem sozialen<br />
Universum der Guayaki.<br />
Wenn sie auf das Tabu rekurrieren, bringen die Indianer also vor allem dies<br />
zum Ausdruck: Die Preisgabe der sozialen Existenz zieht die Preisgabe der physischen<br />
Existenz nach sich — wer pane ist, ist nicht überlebensfähig. 102 Es ist jedenfalls<br />
nicht allein die Befolgung der Regel, die den Menschen ausmacht und die<br />
menschliche Gesellschaft von der Affenhorde trennt, sondern auch das Wissen um<br />
diese Regel. Es wäre naiv, den "Wilden" unterstellen zu wollen, sie seien nicht in<br />
der Lage, die Folgen unterbliebener Gegenseitigkeit — z.B. des Teilens von Nahrungsmitteln<br />
— vorauszusehen. Dem möglichen oder drohenden Zerfall der Gruppe<br />
(und schlimmstenfalls Diebstahl und Mord) stellen sie die Norm entgegen, die erbeutete<br />
Nahrung stets mit den Gefährten (also "unter Brüdern") zu teilen; manchmal<br />
etwas schwächer formuliert (nur "Großwild" wird geteilt), manchmal schärfer<br />
(die eigene Beute ist <strong>für</strong> den Jäger tabu). Auch wenn "Brüder" sich vielleicht in Notzeiten<br />
aus einem Gefühl der Verbundenheit heraus helfen, sind moralische Regeln in<br />
jedem Fall ein probateres Mittel, den sozialen Zusammenhalt sicherzustellen als (unsichere)<br />
Einsichten und (schwankende) affektive Bande.<br />
Die Annahme, der Mensch sei als notwendig gesellschaftliches Wesen dem Leben in<br />
dieser Gesellschaft vollkommen angepaßt (oder könnte es sein), ist schließlich absurd.<br />
Am besten sagt man also wohl: der Guayaki folgt der Vorschrift, weil es ihm<br />
notwendig, geboten, wünschenswert erscheint, weil er möglicherweise auch berechtigte<br />
Angst vor den Folgen der Nichtbefolgung (Ausschluß aus dem Gemeinwesen)<br />
hat. Bis auf letzteres wahrscheinlich häufig alles zugleich. Man muß nicht zugunsten<br />
102 Das Tabu, von der eigenen Jagdbeute zu essen, existiert übrigens nicht in allen Wildbeuter-Gesellschaften.<br />
Die Guayaki sind aber in wesentlich stärkerem Maß vom Jagdertrag abhängig als Jäger/Sammler-Ethnien<br />
in anderen Teilen der Welt, wo der Großteil der Nahrung aus von Frauen gesammelten<br />
Pflanzenprodukten besteht. Die Jagd hat in der Ökonomie der Guayaki eine derart dominierende Bedeutung,<br />
weil die südamerikanischen Wälder in der Regel vergleichsweise arm an eßbaren vegetatiblen<br />
Ressourcen sind. Zwar stellen Wurzeln, Beeren, Früchte, Palmherzen, Honig und Larven einen<br />
beträchtlichen Anteil an der Ernährung dar, und die Frauen spüren in der Umgebung des Lagers ohne<br />
Unterlaß Nahrung auf, doch sind diese Quellen schnell erschöpft. »Den Löwenanteil der Nahrungsmittelproduktion<br />
besorgen die Männer. In der Gesellschaft der Guayaki kommt ihrer Gruppe die<br />
Aufgabe zu, die regelmäßige Verpflegung der Menschen zu garantieren, indem sie sie mit Fleisch und<br />
Fett versorgen, auf das man nicht verzichten kann.« (Clastres 1972: 186) Man ist vielleicht geneigt, diese<br />
Analyse zu bezweifeln, da Clastres die Indianer zu einem Zeitpunkt antraf, da sie sich hauptsächlich von<br />
dem ernährten, was die Regierung ihnen zukommen ließ, und nur noch zu sporadischen<br />
Jagdexpeditionen aufbrachen, um ihre Kost zu ergänzen. Allerdings sind, wie erwähnt, die Verhältnisse<br />
in südamerikanischen Waldgebieten nicht ohne weiteres mit denen anderer Gegenden der Erde vergleichbar,<br />
so daß die von Clastres beschriebene dominante Bedeutung der Jagd durchaus den realen<br />
Bedingungen und nicht nur den Erzählungen der Männer entspringen mag. So schreiben Lindig/Münzel<br />
bezüglich einer den den Aché verwandten und benachbarten Kultur: »Die wichtigste Aktivität der<br />
Männer ist die Jagd. Fleisch ist beliebteste und Hauptspeise. Bei den Xokleng ergaben Berechnungen<br />
einen Durchschnitt von 1.100 Gramm Tapirfleisch täglich <strong>für</strong> jeden Erwachsenen in der Hauptjagdzeit<br />
(etwa ein Drittel des Jahres), anderes Wildbret nicht mitgerechnet« (Lindig/Münzel 1976, Bd.2: 161)
Verzicht und Begehren 65<br />
einer einzelnen Option votieren. Und wenn uns die "primitive Kultur" zuweilen als<br />
widersprüchlich erscheint, so ist das unser Problem, und nicht ihres. Für den "Primitiven"<br />
sind unsere Fragen vielleicht ebenso schwer verständlich wie seine <strong>Institut</strong>ionen<br />
es <strong>für</strong> uns sind. Man kann das "Geben" also nicht umstandslos über einen<br />
Kamm scheren, ebensowenig wie den beim Tausch zu leistenden "Verzicht". Letzterer<br />
ist schwerlich eine feststehende Größe — das Gefühl, etwas preisgegeben zu<br />
müssen, Verzicht zu leisten, dürfte ebenso kulturspezifisch sein wie das Empfinden<br />
eines Mangels. 103<br />
Es sollte bis hierhin deutlich geworden sein, daß die "primitiven" Kulturen nicht einfach<br />
als gehemmte Vorläufer der modernen Industriegesellschaften gesehen werden<br />
können. Vor allem darf man das Reflexionsvermögen der vermeintlichen "Wilden"<br />
nicht voreilig unterschätzen. Die Differenz zwischen "uns" und "ihnen" entspricht<br />
nicht einfach derjenigen zwischen Freiheit und Notwendigkeit, sie ist im Zweifelsfall<br />
tiefgreifender, als nicht nur der ökonomiehistorische sondern auch der ethnographische<br />
Diskurs in der Regel zur Kenntnis nimmt, da sie nicht allein formaler, sondern<br />
auch inhaltlicher Natur ist. Ich werde im fünften und sechsten Kapitel auf diese inhaltlichen<br />
Unterschiede zurückkommen, die primär die von den Akteuren verfolgten<br />
Interessen betreffen. Im folgenden will ich aber zunächst anhand der Darstellung des<br />
Zusammenhangs von Sozialstruktur und Tauschformen die formalen Aspekte ausleuchten.<br />
103 Die Haltung, aus der heraus der eine Gabe gegeben wird, dürfte sich von Fall zu Fall unterscheiden,<br />
ebenso sehr wie diejenige, die dem Schenken zugrunde liegt. Das Geschenk kann z.B. ebenso Zeichen<br />
von persönlicher Zuneigung wie die Reaktion auf eine bestehende Verpflichtung oder gar der Ausdruck<br />
sozialer Überlegenheit sein (ich komme im 4. Kapitel darauf zurück).
3. Kapitel<br />
DIE SOZIALE ALS KLASSIFIKATORISCHE ORDNUNG<br />
Für Marcel Mauss mußte menschliche Natur im Tausch aufgehoben sein, damit Kultur<br />
sein kann. Der von ihm bemühte "Naturzustand" ist allerdings nicht allein<br />
dadurch gekennzeichnet, daß entfesselte (oder besser: noch nicht gefesselte menschliche)<br />
Begierden in Bestialitäten münden, sondern ganz allgemein durch die Abwesenheit<br />
von Ordnung und Berechenbarkeit. Dergestalt ist die kulturelle Ordnung<br />
nicht allein restriktiv, sondern auch "befähigend", institutionalisierte Normen regulieren<br />
und beschränken soziales Handeln ebenso, wie sie es überhaupt erst ermöglichen.<br />
Hierauf spielt Anthony Giddens an, wenn er hervorhebt, daß »Normen sowohl<br />
Zwang ausüben als auch befähigen.« (1976: 131). In diesem Sinne ist die Norm der<br />
Reziprozität als fundamentale und minimale <strong>Institut</strong>ion nicht nur Bedingung der<br />
Möglichkeit jeglichen Tauschs sondern soziales Kausalitätsprinzip schlechthin. Als<br />
irreduzibler Bestandteil menschlichen Zusammenlebens gilt das "wie du mir, so ich<br />
dir" immer und überall und ist eines der Fundamente, auf denen die menschliche<br />
Gesellschaft ruht. Auch wenn dieser Grundsatz manchmal dort, wo Gnade, Vergebung<br />
und Mildtätigkeit, aber auch Unterwerfung und Willkür walten, außer Kraft<br />
gesetzt scheint, ist ein Zusammenleben ohne ihn schlicht nicht vorstellbar. 104 Erst<br />
auf Grundlage dieses elementaren Prinzips kann sich nicht nur der Tausch, sondern<br />
eine große Vielfalt von (eben reziproken) Handlungsmustern entfalten.<br />
Die Gesellschaft ermöglicht soziales Handeln aber nicht einfach nur, sie verleiht<br />
unseren Handlungen zudem Bedeutung. Der Gabentausch ist dergestalt Teil einer<br />
bedeutungsvollen (sozialen) Ordnung, soziale Beziehungen ruhen wie der institutionelle<br />
Rahmen, in welchen der Tausch stets eingebettet ist — die Obligationen,<br />
denen er folgt —, nicht nur auf einem moralischen und affektiven, sondern<br />
notwendig auch (und vielleicht vor allem) auf einem "logischen", d.h. klassifikatorischen<br />
Fundament. Die vorstehende Formulierung führt zu Claude Lévi-Strauss und<br />
der von ihm begründeten strukturalen Anthropologie. Folgt man Sahlins' Lesart des<br />
Essai sur le don, liegt der Schluß nahe, daß im Tausch der Übergang von Natur zu Kultur,<br />
d.h. die Menschwerdung des Menschen vollzogen ist. Das ist genau die in den<br />
monumentalen Structures élémentaires de la parenté (dt.: "Die elementaren Strukturen<br />
der Verwandtschaft", zuerst erschienen 1949) von Lévi-Strauss vertretene Position:<br />
die Regelhaftigkeit der gesellschaftlichen Tauschakte scheidet demnach den<br />
kulturellen vom natürlichen Prozeß. Tausch heißt <strong>für</strong> Lévi-Strauss allerdings nicht<br />
allein (und nicht einmal in erster Linie) Austausch materieller Güter, sondern meint<br />
stets dreierlei: Tausch der Frauen, Tausch der Güter, Tausch der Wörter — als Zeichen.<br />
Ich werde seine Konzeption weiter unten kritisieren und will mich zunächst<br />
auf ihre Darstellung beschränken. Insbesondere die Behandlung der Eheschließung<br />
104 Innerhalb einer stabilen sozialen Beziehung (unter Gleichen) wird stets gleiches mit gleichem<br />
vergolten (oder zumindest die Fiktion aufrechterhalten, daß dem so wäre). Eine Verletzung dieser<br />
Norm, der Versuch, etwas <strong>für</strong> nichts zu erhalten, impliziert notwendig Feinseligkeit.
Die soziale als klassifikatorische Ordnung 67<br />
als Frauentausch wird in diesem Zusammenhang bei der Leserin oder dem Leser<br />
vielleicht (durchaus zu recht) einiges an Widerstreben hervorrufen; das sollte aber<br />
nicht dazu verleiten, einen Ansatz vorschnell zu verwerfen, der m.E. <strong>für</strong> das Verständnis<br />
des Zusammenhangs von Tausch und (segmentärer) Vergesellschaftung von<br />
zentraler Bedeutung ist. 105<br />
DIE REGEL DER REGELN<br />
Lévi-Strauss' Argumentation nimmt ihren Ausgang beim Inzesttabu und dessen Stellung<br />
im Spannungsfeld von "Natur" und "Kultur". Die Universalität dieser <strong>Institut</strong>ion,<br />
ihre überzeitliche und interkulturelle Geltung war zur Entstehungszeit der<br />
Structures élémentaires eine der unumstrittensten Erkenntnisse der ethnologischen<br />
Forschung, ohne daß jedoch »die darin enthaltene Problematik und Widersprüchlichkeit<br />
erkannt worden wäre.« (Lévi-Strauss 1967: 62) Während nämlich die Natur<br />
universellen, unveränderlichen Gesetzen folgt (Naturgesetzen), ist das Kennzeichnen<br />
der Kultur die Partikularität der Regeln, die sich von Gesellschaft zu Gesellschaft unterscheiden.<br />
Das Inzesttabu als universelle Regel scheint aber beiden Bereichen<br />
gleichzeitig anzugehören. Lévi-Strauss beschreibt die Behandlung dieses hybriden<br />
Phänomens in der soziologischen Theorie folgendermaßen: »Einige haben sich auf<br />
den doppelten, natürlichen und kulturellen, Charakter der Regel berufen, sich jedoch<br />
darauf beschränkt, zwischen beiden Aspekten eine rational abgeleitete und äußerliche<br />
Verbindung herzustellen. Andere wollen das Inzestverbot ... durch natürliche<br />
Ursachen erklären oder haben in ihm ... ein kulturelles Phänomen gesehen.«<br />
(Ibid.: 73) Diese Interpretationen sind jedoch unzureichend, denn das Inzesttabu<br />
»hat weder einen rein kulturellen noch einen rein natürlichen Ursprung, es ist auch<br />
keine bunte Mischung aus Elementen, die teils der Natur, teils der Kultur entlehnt<br />
sind. Es ist der grundlegende Schritt, dank dem sich der Übergang von der Natur zur<br />
Kultur vollzieht.« (Ibid., Hervorhebung von mir) Die Untersagung des Inzests erscheint<br />
so als kleinster gemeinsamer Nenner der Kultur, als "Regel der Regeln".<br />
Damit steht <strong>für</strong> Lévi-Strauss zugleich der Tausch notwendig am Urgrund der<br />
menschlichen Gesellschaft. Erstens weil das Inzestverbot ohne Exogamiegebot nicht<br />
möglich wäre, und zweitens weil <strong>für</strong> ihn bei jeder Eheschließung eine Frau gegeben<br />
wird — als Gabe.<br />
Inzestverbot und Exogamie sind funktional untrennbar verknüpft. Während es<br />
einerseits untersagt ist, innerhalb der eigenen Gruppe, der eigenen Familie, zu heiraten,<br />
ist andererseits vorgeschrieben, in fremde Gruppen resp. Familien ein-<br />
105 Ich will Lévi-Strauss' Versuch, die Einsichten und Programmatik der strukturalen Linguistik zur<br />
Kritik und Fortführung der <strong>Soziologie</strong> Durkheims einzusetzen, in aller gebotenen Kürze nachzeichnen.<br />
Wiewohl sein Ansatz mir einen wichtigen Schlüssel zum Verständnis zur sozialen Logik des Tauschs zu<br />
liefern scheint, geht es mir doch nicht um die unkritische Aufnahme eines Theoriegebäudes, in welchem<br />
schließlich die Spezifität des Gegenstands auf der Strecke zu bleiben droht, wenn Lévi-Strauss versucht<br />
soziale Prozesse aus den "Gesetzen" des Denkens abzuleiten.
68 Die soziale als klassifikatorische Ordnung<br />
zuheiraten. Letzteres ist nach Lévi-Strauss, unter Ausschluß von Frauenraub und<br />
Frauenkauf, nur möglich, wenn die Frauen der eigenen Gruppe "gegeben" werden.<br />
Das Inzestverbot ist demnach »weniger eine Regel, die es untersagt, die Mutter,<br />
Schwester oder Tochter zu heiraten, als vielmehr eine Regel, die dazu zwingt, die<br />
Mutter, Schwester oder Tochter anderen zu geben. Es ist die höchste Regel der Gabe,<br />
und gerade dieser allzu oft verkannte Aspekt erlaubt es, ihre Natur zu verstehen.«<br />
(Ibid.: 643) Lévi-Strauss identifiziert (ohne explizit darauf zu verweisen)<br />
mit den der dem Inzesttabu/Exogamiegebot entspringenden Praxis der Eheschließung<br />
zwischen den sozialen Segmenten die nach Mauss <strong>für</strong> den Gabentausch charakteristischen<br />
Verpflichtungen erstens zu geben (die Frauen der eigenen Abstammungsgruppe)<br />
und zweitens zu nehmen (die Frauen der anderen Abstammungsgruppe).<br />
106 Das Inzesttabu hat somit keine "biologischen" Gründe, es verfolgt allein<br />
den Zweck, soziale Ordnung, sprich: Gesellschaft, im Tausch zu perpetuieren. Es<br />
garantiert den sozialen Zusammenhalt, da es auf einer kulturell geschaffenen "künstlichen"<br />
(d.h. keiner naturgesetzlichen), aber dennoch unhintergehbaren Abhängigkeit<br />
beruht. In Abwandlung eines berühmten Ausspruchs von Sigmund Freud könnte<br />
man sagen: wo Natur war, soll Kultur werden — als Ordnung auf Grundlage einer<br />
Regel. Die Ehe wurzelt also »nicht nur in gegenseitiger Liebe und in gegenseitigem<br />
Begehren, sondern auch in einer allgemeinen sozialen Gegenseitigkeit, die weit über<br />
die Zweierbeziehung hinausgeht.« (Heinrichs 1983: 64).<br />
Den größten Teil der Elementaren Strukturen der Verwandtschaft nimmt die<br />
Systematisierung der in den unterschiedlichsten segmentären Gesellschaften aufgefundenen<br />
Heiratsregeln ein, wobei "Heiratsregel" meint, daß die Ehen entweder<br />
nach einem präferentiellen oder einem präskriptiven Muster geschlossen werden,<br />
bestimmte Personen also als Gatten entweder bevorzugt oder vorgeschrieben sind.<br />
Auch wenn dieser Gegenstand das Thema des vorliegenden Buches nur am Rande<br />
berührt, will ich doch in aller gebotenen Kürze die Ergebnisse von Lévi-Strauss' materialer<br />
Analyse darstellen, denn die Heiratsordnung ist zumindest in segmentären<br />
Gesellschaften, wo nahezu alle institutionalisierten sozialen Beziehungen verwandtschaftliche<br />
sind, die notwendige Grundlage der gesellschaftlichen Ordnung. Die unterschiedlichen<br />
Typen der Kreuzkusinenheirat sind die häufigsten Formen präskriptiver<br />
oder präferentieller Eheschließung, ihnen gilt Lévi-Strauss' primäres Interesse.<br />
Jede dieser Regeln steht <strong>für</strong> Lévi-Strauss <strong>für</strong> eine »Art und Weise, die Zirkulation<br />
der Frauen innerhalb der sozialen Gruppe zu sichern, das heißt, ein System von<br />
Blutsbeziehungen, ein System biologischen Ursprungs durch ein soziologisches System<br />
der Bündnisse zu ersetzen.« (Lévi-Strauss 1951: 73) Als Kreuzkusine wird die<br />
Tochter des Mutterbruders ("matrilaterale Kreuzkusine") bzw. der Vaterschwester<br />
106 Das Inzesttabu stellt <strong>für</strong> sich genommen »lediglich eine vorbereitende Maßnahme dar, die als solche<br />
unfruchtbar ist, jedoch die Voraussetzung <strong>für</strong> die späteren Schritte bildet.« (Ibid.: 97) Mit anderen<br />
Worten: es soll die Exogamie erzwingen oder besser: sicherstellen, daß die sozialen Segmente (Clans,<br />
Lineages) sich verbinden.
Die soziale als klassifikatorische Ordnung 69<br />
("patrilaterale Kreuzkusine") bezeichnet, 107 die Tochter der Mutterschwester oder<br />
des Vaterbruders ist hingegen Parallelkusine.<br />
Großeltern<br />
Eltern<br />
Kinder<br />
Clan X Clan Y Clan Z<br />
Tochter d.<br />
Mutterbruders<br />
Mutterbruder<br />
Abbildung 3: Matrilaterale Kreuzkusinenheirat (matrilineare Deszendenz)<br />
Sohn<br />
Nach Lévi-Strauss im Gegensatz zu einer Fülle von Beispielen <strong>für</strong> Kreuzkusinenheiraten<br />
nahezu keine ethnographischen Belege <strong>für</strong> Ehen zwischen Parallelvettern und Parallelkusinen,<br />
was auf den ersten Blick verwunderlich erscheint, denn biologisch,<br />
d.h. bezogen auf den Grad der Blutsverwandtschaft, unterscheiden sich Parallel– und<br />
Kreuz-Vettern bzw. –Kusinen nicht. Ist aber in einer Gesellschaft die Abstammung,<br />
d.h. Verwandtschaft, entweder nur über die mütterliche (matrilineare Deszendenz)<br />
oder nur über die väterliche Linie (patrilineare Deszendenz) definiert, dann besteht<br />
auf der soziologischen Ebene ein bedeutsamer Unterschied. Bei derartigen unilinearen<br />
Deszendenzsystemen ist im Gegensatz zur Kreuzkusine, die notwendig einer anderen<br />
Abstammungsgruppe angehört als ihr Vetter, die Parallelkusine dem gleichen<br />
Segment zugeordnet. In diesem Fall wäre die Heirat mit der Parallelkusine ein inzestuöser<br />
Akt der verhinderte, worauf das Inzesttabu zielt, nämlich die Verbindung<br />
zwischen sozialen Segmenten. Folglich wird die Heirat mit der Parallelkusine bei<br />
unilinearer Abstammungsregelung untersagt, während die Heirat mit der Kreuzkusine<br />
häufig geboten ist. 108 Die biologische ist also lediglich Substrat der sozialen Verwandtschaft.<br />
Obwohl der Grad der sozialen Verwandtschaft in beiden Fällen gleich ist, entfaltet<br />
sich nach Lévi-Strauss die sozial integrative Kraft der Kreuzkusinenheirat erst<br />
beim matrilateralen Typ (Abbildung 3) vollkommen. Dieser korrespondiert mit einem<br />
Heiratsmuster, wie ich es bereits im 1. Kapitel darstellte: Die Frauen aus Segment<br />
X heiraten Männer aus Segment Y, die Frauen aus Segment Y Männer aus Seg-<br />
107 Die "bilaterale Kreuzkusine" ist beides zugleich.<br />
108 Bei den matrilinearen Trobriandern z.B. ist der Vater nicht mit seinen Kindern verwandt, der<br />
nächste männliche Verwandte ist der Bruder der Mutter.<br />
Mutter<br />
Tochter<br />
Vater<br />
Vaterschwester<br />
Tochter d.<br />
Vaterschwester
70 Die soziale als klassifikatorische Ordnung<br />
ment Z, die Frauen aus Segment Z Männer aus Segment X, und dies über alle Generationen.<br />
Das dargestellte Beispiel ist dabei umstandslos erweiterbar, die matrilaterale<br />
Kreuzkusinenheirat kann theoretisch beliebig viele Gruppen verknüpfen und bildet<br />
damit das ideale Grundmuster <strong>für</strong> ein verallgemeinertes, alle sozialen Segmente<br />
(als Heiratsklassen) durchdringendes System von Verwandtschaftsbeziehungen. 109<br />
Zwar gilt auch bei der patrilateralen Kreuzkusinenheirat (Abbildung 4) innerhalb<br />
der Generationen ein Heiratsmuster wie das oben skizzierte, dessen Richtung<br />
wechselt aber von Generation zu Generation um. 110 Die Heiratsrichtung alterniert<br />
in diesem Fall und es stehen immer nur jeweils zwei Segmente in einer Tauschbeziehung<br />
zueinander. Daß dem so ist, liegt an der Struktur der jeweiligen Heiratsordnung:<br />
Bei der matrilateralen Kreuzkusinenheirat gehören Kinder, Eltern und<br />
Großeltern notwendig drei verschiedenen Abstammungsgruppen an, bei der patrilateralen<br />
Form sind die Kinder dagegen dem gleichen Segment zugeordnet wie die<br />
Großeltern. Die Modellskizze sieht also nicht nur eleganter aus, die matrilaterale<br />
Kreuzkusinenheirat "funktioniert" auch besser, <strong>für</strong> Lévi-Strauss ist sie daher das<br />
Sinnbild des verallgemeinerten Tauschs und besiegelt dergestalt endgültig »die Vorherrschaft<br />
des Sozialen über das Biologische und des Kulturellen über das Natürliche«<br />
(1967: 640) — Ich will es bei dieser knappen Darstellung belassen, die auch<br />
dazu dienen sollte, den Zusammenhang von Segmentierung und sozialer Verwandtschaft<br />
zu verdeutlichen.<br />
Großeltern<br />
Eltern<br />
Kinder<br />
Tochter d.<br />
Mutterbruders<br />
Clan X Clan Y Clan Z<br />
Mutterbruder<br />
Tochter<br />
Abbildung 4: Patrilaterale Kreuzkusinenheirat (matrilineare Deszendenz)<br />
109 Das Dreieck symbolisiert einen Mann, der Kreis eine Frau, die mit = verbundenen Personen sind<br />
miteinander verheiratet, wobei die Linien die Kinder (idealtypisch stets Sohn und Tochter) bezeichnen.<br />
Beim darstellten Beispiel ist die Abstammung patrilinear, weshalb die Kinder aus einer Ehe immer dem<br />
Segment des Vaters zugehören.<br />
110 Die dargestellten Modelle gehen von einer zentralen Vereinfachung aus, die selbstverständlich nicht<br />
der demographischen Realität entspricht: jedes Ehepaar hat nur jeweils einen Sohn und eine Tochter.<br />
Wenngleich die realen Muster wesentlich komplizierter sind, ändert die aber nichts am Prinzip und der<br />
Wirksamkeit des Operationsmodus. Hat die Mutter keinen Bruder, so bezieht sich die Heiratsregel z.B.<br />
auf die Tochter des nächsten männlichen Verwandten der Mutter usw..<br />
Mutter<br />
Sohn<br />
Vater<br />
Tochter d.<br />
Vaterschwester<br />
Vaterschwester
Die soziale als klassifikatorische Ordnung 71<br />
DER WERT DER ZEICHEN<br />
Bei seinem nicht eben bescheidenen Versuch, eine "kopernikanische Wende" in den<br />
Wissenschaften vom Menschen einzuläuten, bezieht sich Lévi-Strauss' in erster Linie<br />
auf die von Ferdinand de Saussure begründete strukturale Linguistik als Referenzdisziplin.<br />
»Die Sprachwissenschaft nimmt im Gesamtzusammenhang der Sozialwissenschaften,<br />
zu denen sie unbestreitbar gehört, einen besonderen Platz ein: sie ist<br />
nicht eine Sozialwissenschaft wie die anderen, sondern diejenige, die bei weitem die<br />
größten Fortschritte erzielt hat; die einzige zweifellos, die den Namen Wissenschaft<br />
verdient, die gleichzeitig eine positive Methode formuliert hat und das Wesen der<br />
ihrer Analyse unterzogenen Tatsachen kennt.« (Lévi-Strauss 1945a: 43) 111 Da<br />
sprachliche Phänomene vielgestaltig sind und unter vielerlei Hinsicht (und von unterschiedlichen<br />
Disziplinen) untersucht werden können, unterschied Saussure zwischen<br />
(faculté de) langage (Sprachfähigkeit), parole (Sprechen, d.h. Sprechakte) und<br />
langue (Sprache). Nur letztere war sein Gegenstand: die Sprache, d.h. ihr "Wesen",<br />
nicht Sprachen (im historischen oder systematischen Vergleich) — plus ça change,<br />
c'est la même chose. Die Sprache hat drei grundlegende Eigenschaften, sie ist 1) ein<br />
homogenes Ganzes, 2) sozialer Natur und 3) ein Zeichensystem. Die Originalität des<br />
Saussureschen Ansatzes gründet primär in der Einsicht vom relativen und relationalen<br />
"Wert" des aus Lautbild (signifiant, Signifikant) und Vorstellung (signifié, Signifikat)<br />
bestehenden sprachlichen Zeichens. 112 Sprache ist demnach ein relationales<br />
Ordnungssystem von untrennbaren Verbindungen aus zwei Komponenten: Ausdruck<br />
und Inhalt. Nach Saussure existieren jenseits des (sprachlichen) Zeichens keine<br />
klaren und unterschiedenen Vorstellungen: »Das Denken, <strong>für</strong> sich allein genommen,<br />
ist wie eine Nebelwolke, in der nichts notwendigerweise begrenzt ist. Es gibt keine<br />
von vornherein feststehenden Vorstellungen und nichts ist bestimmt, ehe die Sprache<br />
in Erscheinung tritt.« (1915: 133) 113 Die Signifikanten haben aber keine ihnen<br />
111 Deshalb müsse der Soziologe, der den Fortschritt seiner Disziplin zu befördern sucht, sich an der<br />
Sprachwissenschaft orientierten. Lévi-Strauss zitiert Marcel Mauss, der bereits im Jahre 1925 einer<br />
ähnlichen Überzeugung Ausdruck verlieh: »Die <strong>Soziologie</strong> wäre ganz gewiß weiter, wenn sie überall<br />
nach dem Muster der Sprachwissenschaft vorgegangen wäre.« (nach Ibid.)<br />
112 Saussure übernahm damit »die stoische Vorstellung von der Zweiheit des sprachlichen Zeichens, das<br />
sich zusammensetzt aus dem perzeptiblen Signifikanten (signans) und dem intelligiblen Signifikat (signatum).«<br />
(Jakobson 1972: 160). Das Gehirn übermittelt im Sprechakt »den Sprechorganen einen Impuls,<br />
der dem Lautbild entspricht; dann breiten sich die Schallwellen aus vom Munde des A zum Ohr des B<br />
hin: ein rein physikalischer Vorgang. Dann setzt sich der Kreislauf bei B fort in umgekehrter<br />
Reihenfolge: vom Ohr zum Gehirn, physiologische Übertragung des Lautbildes; im Gehirn psychologische<br />
Assoziation dieses Lautbildes mit den entsprechenden Vorstellungen.« (Saussure 1915: 14)<br />
113 Aber auch das lautliche Potential ist aus sich heraus ebensowenig strukturiert. »Die Sprache hat ...<br />
dem Denken gegenüber nicht die Rolle, vermittelst der Laute ein materielles Mittel zum Ausdruck der<br />
Gedanken zu schaffen, sondern als Verbindungsglied zwischen dem Denken und dem Laut zu dienen,<br />
dergestalt, daß deren Verbindung notwendigerweise zu einander entsprechenden Abgrenzungen von<br />
Einheiten führt.« (Ibid.: 133f.) Die Sprache ist also ein Mittel, Denken und Laute zu strukturieren und<br />
zu korrelieren; Voraussetzung <strong>für</strong> Kommunikation ist die Artikulation, welche durch diese Strukturierung<br />
ermöglicht wird (wobei das französische articulation gleichzeitig die Verbindung wie das<br />
Aussprechen meint) — wenn ich die Dinge denken kann, kann ich von ihnen sprechen.
72 Die soziale als klassifikatorische Ordnung<br />
innewohnende positive Bestimmung; der Bedeutungsgehalt, die Vorstellung, welche<br />
die Lautbilder vermitteln, ist nicht ursächlich an sie gebunden. Sprachliche Zeichen<br />
lassen sich ganz allgemein nicht durch Bezugnahme auf eine feststehende, unabhängige<br />
Bedeutung bestimmen, ihr Wert (Saussure führt den Begriff ein) entspringt der<br />
Art und Weise, wie sie zueinander in Beziehung gesetzt, miteinander kombiniert<br />
sind, er läßt sich nur ableiten aus der Position eines Zeichens im Gesamtsystem, d.h.<br />
in Beziehung zu allen anderen Zeichen (Sprache als System ist in dieser Hinsicht in<br />
gewissem Sinne selbstbezüglich). Die Beziehung zwischen den Zeichen kann also nur<br />
durch ihre Differenz bestimmt werden: »Ihr bestimmtestes Kennzeichen ist, daß sie<br />
etwas sind, was die anderen nicht sind.« (Ibid.: 139f.) Erst auf dieser Grundlage ist<br />
Bedeutung, die "positive" Beziehung zwischen einem Wort und der an dieses geknüpften<br />
Vorstellung möglich. 114 Hier knüpft Lévi-Strauss an. Die Verwandtschaftssysteme<br />
segmentärer Gesellschaften ähneln <strong>für</strong> ihn in ihrem relationalen Charakter<br />
der Sprache: »Die Verwandtschaftserscheinungen sind in einer anderen Ordnung der<br />
Wirklichkeit Phänomene vom gleichen Typus wie die sprachlichen.« (Lévi-Strauss<br />
1945a: 46) 115 Die Grundannahmen der strukturalen Anthropologie sind diesbezüglich<br />
zunächst Variationen der Aussagen Saussures: "Es gibt keine von vornherein feststehenden<br />
sozialen Beziehungen und nichts ist bestimmt, ehe die Verwandtschaft in<br />
Erscheinung tritt", und: "das bestimmteste Kennzeichen einer Frau ist, daß sie etwas<br />
ist, was die anderen nicht sind". Die "Funktion" des sprachlichen Zeichens, soweit<br />
man Sprache als soziales Phänomen betrachtet, ist Kommunikation; und wenn Verwandtschaftssysteme<br />
Phänomene vom gleichen Typus wie die sprachlichen und<br />
Frauen Zeichen sind, dann müssen die Frauen offenbar notwendig dem gleichen<br />
Zweck dienen wie die sprachlichen Zeichen.<br />
Die Beziehungen zwischen den Geschlechtern lassen sich <strong>für</strong> Lévi-Strauss folglich<br />
als Modalitäten einer großen »Kommunikationsfunktion« konzipieren, die auch<br />
die Sprache einschließt (vgl. 1967: 660). Zu heiraten hieße also, Frauen zu tauschen<br />
als Zeichen, »die man mißbraucht wenn man nicht den Gebrauch von ihnen macht,<br />
der den Zeichen zukommt, und der darin besteht, kommuniziert zu werden.« (Ibid.:<br />
662) Wenn man es denn so sehen will, stellt die segmentäre Sozialorganisation in<br />
114 Saussure veranschaulicht die Differenz zwischen Wert und Bedeutung mit folgendem Beispiel: Die<br />
Franzosen bezeichnen mit mouton sowohl das Schaf als auch sein Fleisch. Dieses Wort »kann dieselbe<br />
Bedeutung haben wie das englische sheep, aber nicht denselben Wert ... besonders deshalb, weil, wenn<br />
von einem Stück Fleisch die Rede ist, das zubereitet und auf den Tisch gebracht wird, das Englische<br />
mutton und nicht sheep sagt. Der Unterschied des Wertes zwischen sheep und mouton kommt daher, weil<br />
das erstere neben sich ein zweites Glied hat, was bei dem französischen Wort nicht der Fall ist. Innerhalb<br />
einer und derselben Sprache begrenzen sich gegenseitig alle Worte, welche verwandte Vorstellungen<br />
ausdrücken... So ist der Wert von jedem beliebigen Glied begrenzt durch das, was es umgibt.« (Ibid.:<br />
138)<br />
115 Lévi-Strauss folgt Saussures Aufforderung recht wörtlich: »So wird man nicht nur das Problem der<br />
Sprache klären, sondern auch Riten, Bräuche usw. werden in anderem Licht erscheinen, wenn man sie<br />
als Zeichen betrachtet, und man wird es als notwendig empfinden, sie in die Semiologie einzuordnen<br />
und sie durch die Gesetze dieser Wissenschaft zu erklären.« (1915: 170) Somit ist <strong>für</strong> ihn die Ethnologie<br />
Teil der Semiologie (oder Semiotik), jener allgemeinen Wissenschaft von den Zeichen, in welche<br />
Saussure seine Betrachtungen einmünden lassen wollte.
Die soziale als klassifikatorische Ordnung 73<br />
Verbindung mit dem Inzesttabu/Exogamiegebot tatsächlich ein System wechselseitig<br />
aufeinander bezogener "Zeichen" (d.h. Frauen) bereit: Innerhalb einer Generation<br />
gibt es zumindest zwei Klassen von Frauen — solche, die verboten, und solche die<br />
geboten sind — aber auch zwei Klassen von Männern — "Brüder" (Söhne meiner<br />
eigenen Mutter oder der Mütter der mir verbotenen Frauen) und potentielle Schwäger.<br />
Im Gegensatz zur Differenz der Geschlechter und der Generationen kann diese<br />
kulturelle Setzung einer Norm und einer relationalen Differenz auf kein unmittelbar<br />
wahrnehmbares "natürliches" Muster zurückgeführt werden, was sie als soziologische<br />
sui generis erscheinen läßt. 116 Die segmentäre Differenzierung wäre dergestalt<br />
Bedingung der Möglichkeit des Frauentauschs, und dieser wiederum Bedingung der<br />
Möglichkeit von sozialer Ordnung.<br />
Für Lévi-Strauss resultiert aus einem Tausch (dem der Frauen) schließlich<br />
notwendig ein zweiter (derjenige der Güter). Die über die Ehe verbundenen Segmente<br />
sind die Basis eines Systems von Allianzen, »zum Preis der Abtretung unersetzbarer<br />
oder kaum zu ersetzender Güter geschlossen ...: Schwestern und Töchter.<br />
Von dem Augenblick an, da die Allianz geschlossen ist, muß alles darangesetzt werden,<br />
sie aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln.« (Lévi-Strauss 1967: 587) Aus<br />
diesem Grund steht <strong>für</strong> Lévi-Strauss ist Eheschließung Anlaß und Ausgangspunkt jenes<br />
scheinbar endlosen Zyklus von Gaben und Gegengaben, die zwischen den verbundenen<br />
Gruppen getauscht werden.<br />
Ich werde auf den Zusammenhang zwischen Verwandtschaft und Gabentausch weiter<br />
unten zurückkommen. Zunächst muß ich einige grundsätzliche kritische Anmerkung<br />
zu Lévi-Strauss' Konzeption des Zusammenhangs von Sprache, Tausch und Verwandtschaft<br />
machen. Diese betreffen zunächst die Rede vom "Frauentausch". Wie<br />
Lévi-Strauss schreibt, kommunizieren die Menschen »mit Hilfe von Symbolen und<br />
Zeichen; <strong>für</strong> die Anthropologie [...] ist alles Symbol und Zeichen, das sich als Vermittler<br />
zwischen die Subjekte stellt.« (1960: 20) Dieser Aussage ist in ihrer Pauschalität<br />
kaum zu widersprechen, zwischen Worten und Gaben, zwischen Geben und<br />
Heiraten besteht fraglos ein gewisser Zusammenhang. Das heißt aber noch lange<br />
nicht notwendig, daß Frauen Gaben-Zeichen sind, die ebenso wie Worte und Dinge<br />
zum Zwecke der Verständigung ausgetauscht, d.h. bei der Eheschließung gegeben<br />
und genommen werden. Für Lévi-Strauss allerdings bedingen sich Sprache, Tausch<br />
und Verwandtschaft wechselseitig. Er schreibt auf den letzten Seiten der "Elementaren<br />
Strukturen der Verwandtschaft":<br />
»Das Auftauchen des symbolischen Denkens mußte zu der Forderung führen, daß die Frauen,<br />
so wie die Wörter, Dinge seien, die ausgetauscht werden. Dies war ... tatsächlich das einzige<br />
116 Die Familie ist nichts Naturgegebenes, sondern etwas von der Gesellschaft notwendig hervorgebrachtes:<br />
eine Art und Weise, uns in Beziehung zu anderen zu setzen und zu denken, elementarer<br />
Baustein jener Ordnung, die wir meinen, wenn wir von "Verwandtschaft" sprechen. Damit soziale<br />
Segmente sich via Eheschließung in Beziehung setzen können, müssen sie sich zunächst voneinander<br />
geschieden sein.
74 Die soziale als klassifikatorische Ordnung<br />
Mittel, den Widerspruch zu überwinden, der bewirkte, daß ein und dieselbe Frau unter zwei<br />
unvereinbaren Aspekten wahrgenommen wurde: einerseits als Gegenstand der eigenen Begierde,<br />
die die sexuellen Triebe sowie die Triebe der Besitzergreifung anstachelte; und andererseits<br />
als Subjekt der Begierde anderer und als solches wahrgenommenes Subjekt, d.h. als<br />
Mittel, die anderen zu binden, indem man sich mit ihnen verbündete.« (1967: 662f.)<br />
Die Männer bedienten sich demnach der Frauen, um Gesellschaft zu konstituieren;<br />
männliche Dominanz erscheint nachgerade als Bedingung der Möglichkeit von Soziabilität.<br />
Maurice Godelier merkt dazu kritisch an: »Logischerweise eröffnet das Inzesttabu<br />
gleichzeitig drei Möglichkeiten: daß [erstens] die Männer die Frauen unter<br />
sich tauschen, was die gesellschaftliche Dominanz der Männer über die Frauen voraussetzt,<br />
daß [zweitens] die Frauen die Männer unter sich austauschen, was voraussetzt,<br />
daß sie eine dominierende Rolle in der Gesellschaft spielen, daß [drittens] die<br />
Abstammungsgruppen unter sich die Frauen austauschen, und das impliziert a priori<br />
keine Dominanz eines Geschlechts über das andere.« (1993: 1197) Lévi-Strauss ignoriert<br />
die Existenz der drei Möglichkeiten nicht, aber er hält sich nur an eine einzige:<br />
den Austausch der Frauen unter den Männern; die anderen beiden tut er als Illusion<br />
ab. Die männliche Dominanz ist <strong>für</strong> ihn ein transhistorisches Faktum. Godelier<br />
hält dagegen: »Wir leugnen nicht, daß männliche Dominanz existiert, aber wir denken<br />
nicht ..., daß sie ein <strong>für</strong> die Verwandtschaft konstitutives Prinzip ist.« (Ibid.:<br />
1198) 117 Es ist tatsächlich vollkommen uneinsichtig, warum die Männer notwendig<br />
die Frauen unter sich austauschen müssen. Zwar werden in vielen Fällen Frauen tatsächlich<br />
getauscht (manchmal sogar gekauft), dominieren die Männer in wahrscheinlich<br />
den meisten Kulturen, aber dies ist schwerlich Bedingung der Möglichkeit von<br />
Verwandtschaft. Gesellschaft wird nicht zwischen den Männern mittels der Frauen<br />
hergestellt. 118 Anstatt davon zu sprechen, daß Männer Frauen tauschen, sollte man<br />
117 Obwohl z.B. in der modernen europäischen Gesellschaft die Männer das gesellschaftliche Leben<br />
dominieren, existiert bei uns die Vorstellung des Frauentauschs nicht (vgl. Ibid.).<br />
118 Im Zweifelsfall argumentiert Lévi-Strauss unvermittelt "naturalistisch". So nimmt er, wenn er in der<br />
gerade zitierten Passage aus den Elementaren Strukturen der Verwandtschaft von »instincts sexuels et d'appropriation«<br />
spricht, genau jenen willkürlichen Rekurs auf das Affektive vor, den er an anderer Stelle Durkheim<br />
vorwirft (vgl. Lévi-Strauss 1962a: 93f.). Auch Lévi-Strauss kann das Konzept des "notwendigen"<br />
Frauentauschs letztlich nur über einen Rekurs auf höchst fragwürdige "Hobbes'sche Urzustände"<br />
begründen, der in scheinbar völligem Widerspruch zu den ansonsten von ihm vertretenen Positionen<br />
steht. Lévi-Strauss' in seinem zuerst 1956 erschienen Aufsatz "The Family" präsentierte Version der<br />
"primitiven Menschheit" erscheint Godelier als eine Ansammlung isolierter, männlich dominierter<br />
biologischer Familien, die die Gesellschaft in einem Konstitutionsakt "erschufen". »Durch Aufrichtung<br />
des Inzesttabus erfand die primitive Menschheit die Gesellschaft, indem sie die Kultur der Natur entgegenstellte.«<br />
(Godelier 1993: 1198) Für Lévi-Strauss stünde also am Urgrund der Gesellschaft eine<br />
Übereinkunft zwischen den "biologischen Familien". Godelier hält dem entgegen: »Das Leben in der<br />
Gesellschaft wird nicht aus einem Kontrakt geboren. Es ist die unserer Spezies angeborene Existenzweise.«<br />
(Ibid.: 1199) Aber Lévi-Strauss selbst schreibt in dem von Godelier bemühten Aufsatz: »Was<br />
den Menschen vom Tier unterscheidet, ist, daß eine Familie in der Menschheit nicht existieren könnte,<br />
wenn es nicht zuvor eine Gesellschaft gegeben hätte: eine Vielzahl von Familien, die die Existenz anderer<br />
Verbindungen als der der Blutsverwandtschaft anerkennen und einräumen, daß der natürliche Prozeß<br />
der Filiation seinen Lauf nur als in den sozialen Prozeß der Allianz eingebetteter nehmen kann.« (1983a:<br />
93) Auf der folgenden Seite des eben zitierten Textes formuliert er dann folgende Passage, die scheinbar<br />
in völligen Widerspruch zu der eben zitierten steht: »Einzig das Inzestverbot bewirkt eine Neugestaltung
Die soziale als klassifikatorische Ordnung 75<br />
besser sagen, daß sich die Familien resp. sozialen Segmente über reziproke Akte verbinden,<br />
mittels wechselseitiger Eheschließung durchdringen. Der entscheidende<br />
Punkt ist hierbei nicht etwa, daß eine Gruppe von Menschen über eine andere verfügt<br />
und sie austauscht, sondern daß die Wahl des Ehepartners gesellschaftlich vorgeschrieben<br />
ist und nicht im Belieben der Individuen steht — weder der Männer,<br />
noch der Frauen. 119<br />
Die eben geäußerte Kritik betrifft ganz allgemein die von Lévi-Strauss vorgenommene<br />
unterschiedslose Subsumierung von Tausch, Verwandtschaft und Sprache<br />
unter dem Zauberwort "Kommunikation", die bedeutsame Differenzen verwischt.<br />
120 Man muß in diesem Zusammenhang die Frage stellen, worüber die strukturale<br />
Linguistik als Referenzwissenschaft Auskunft geben kann und worüber nicht.<br />
Nach eigener Aussage lernte Lévi-Strauss von der Linguistik, »daß es darauf ankommt,<br />
auf die einfachsten und plausibelsten Relationen zwischen den verschiedenen<br />
Ausdrücken zu achten, anstatt sich von ihrer Vielfalt irreführen zu lassen.«<br />
(1976: 214) Ziel ist, im Zuge der »Systematisierung offenbar willkürlicher Fakten<br />
[...] über alle Unterschiede hinweg die Invarianten aufzuzeigen.« (Ibid.) Man muß<br />
sich dazu »von der Betrachtung der Ausdrücke [lösen], um sich auf das Niveau der<br />
Relationen zu begeben.« (Ibid.: 215) Denn von »jedem beliebigen vorgestellten oder<br />
realen Ausdruck« läßt sich das behaupten, »was Jakobson ... über die lautliche Individualität<br />
der Phoneme schreibt: "Entscheidend ist keineswegs deren jeweilige lautliche<br />
Individualität an und <strong>für</strong> sich. Entscheidend ist vielmehr ihre wechselseitige<br />
Opposition innerhalb eines Systems."« (Ibid.) 121 Verwandtschaftssysteme, Opposi-<br />
der biologischen Bedingungen von Paarung und Fortpflanzung. Sie ermöglicht den Familien den<br />
Fortbestand nur dann, wenn sie in ein künstliches Netz von Verboten und Verpflichtungen eingebettet<br />
sind. Nur da kann man den Übergang von der Natur zur Kultur, vom Tierwesen zum Wesen des<br />
Menschen ansiedeln, und nur da läßt sich ihre Verknüpfung erfassen. Wie Tylor bereits vor einem<br />
Jahrhundert begriffen hatte, liegt die Erklärung in letzter Instanz wahrscheinlich darin, daß der Mensch<br />
sehr bald gewußt hat, daß er zwischen "either marrying-out or being killed-out" zu wählen hatte: <strong>für</strong><br />
biologische Familien ist das beste, wenn nicht das einzige Mittel, sich nicht zur gegenseitigen Vertilgung<br />
drängen zu lassen, die Verbindung miteinander durch Blutsbande. Biologische Familien, die isoliert<br />
leben wollten, in lockerem Nebeneinander, sähen sich bald eine geschlossene Gruppe bilden, die ihren<br />
Fortbestand aus sich selbst sichern müßte und unausweichlich der Unwissenheit, der Angst und dem Haß<br />
zum Opfer fiele. Indem es den separatistischen Tendenzen der Blutsverwandtengruppe entgegentritt,<br />
gelingt es dem Inzestverbot, Affinitätsnetze zu weben, die den Gesellschaften ihr Gerüst geben und ohne<br />
die sie sich nicht erhalten können.« (Ibid.: 94)<br />
119 In diesem Sinne ist die Rede von der "matrilateralen Kreuzkusinenheirat" schon tendenziös, das sie<br />
allein die Perspektive des Gatten wiedergibt und nicht diejenige der Frau, welche den Sohn der<br />
Schwester ihres Vaters heiratet.<br />
120 Kommunikation, Kommunizieren: "communicare", gemeinsam tun, mitteilen; "communicatio",<br />
Mitteilung, Unterredung; "communis", mehreren oder allen gemeinsam; "communio", Gemeinschaft. Bei<br />
Lévi-Strauss meint der Begriff Zeichen– bzw. Informationsaustausch innerhalb einer Sprach– bzw.<br />
kulturellen oder sozialen "Gemeinschaft".<br />
121 Die Struktur ist in diesem Sinne die »Art und Weise, nach der die Teile eines Ganzen einander<br />
zugeordnet sind.« (Petit Larousse), das Gefüge »aus sich gegenseitig bedingenden Elementen, wobei<br />
jedes Element von den übrigen abhängt und nur in Relation zu ihnen sein kann, was es ist.« (Lalande,<br />
Vocabulaire de Philosophie). Der Strukturbegriff steht dabei "vermittelnd" zwischen "Modell" und<br />
"System"; das System ist dasjenige der sozialen Beziehungen. »Die sozialen Beziehungen sind das Rohmaterial,<br />
das zum Bau der Modelle verwendet wird, die dann die soziale Struktur erkennen lassen.« (Lévi-
76 Die soziale als klassifikatorische Ordnung<br />
tion der Segmente: die Übertragung ist bis hierhin durchaus schlüssig, vor allem<br />
wenn man bedenkt, daß die Differenz zwischen sprachlichen Ausdrücken immer<br />
notwendig eine relationale ist. — Eine produktive Analogie von einigem heuristischen<br />
Wert. Aber hier endet meine positive Einschätzung vorerst. Man kann sich<br />
durchaus eine Sache mittels einer anderen vorstellen, und Wissenschaft besteht zunächst<br />
aus wenig anderem als analogischer Übertragung. Anschließend muß man erstens<br />
überprüfen, wie weit die Analogie trägt, anstatt sie zu mystifizieren, und sich<br />
zweitens Rechenschaft darüber ablegen, auf welcher Grundlage man die Übertragung<br />
vornehmen konnte. Differenzen und Ähnlichkeiten — Lévi-Strauss ist von<br />
letzteren derart geblendet, daß er einer klassischen pars pro toto-Täuschung aufsitzt,<br />
d.h. einen Teilaspekt, in welchem sich zwei Gegenstandsbereiche entsprechen, <strong>für</strong><br />
das Ganze nimmt. Pars: ein relationales Ordnungssystem als Grundlage von Tausch–<br />
und Verwandtschaftsbeziehungen sowie Sprache, — pro toto: Tauschen = Kommunizieren<br />
= Sprechen, und Verwandtschaft = Sprache; woraus <strong>für</strong> Lévi-Strauss<br />
folgt Frauentausch = Gütertausch = Zeichenaustausch. Man muß dem entgegenhalten,<br />
daß eine funktionale oder strukturale Ähnlichkeit bzw. Homologie keine<br />
"Wesensidentität" impliziert. So ist "Gegenseitigkeit", d.h. reziprokes Handeln,<br />
zwar gemeinsamer Nenner von Sprechen, Eheschließung und Gabentausch, aber<br />
nicht identisch mit reziprokem Tausch. Jener ist nur ein Spezialfall reziproken Handelns.<br />
Diese notwendige Kritik zu üben heißt allerdings nicht, die Lehren der strukturale<br />
Anthropologie pauschal zurückzuweisen. 122 An einigen der zentralen Einsichten<br />
Lévi-Strauss' sollte man durchaus festhalten. Eine dieser Einsichten ist, daß ebenso,<br />
wie Sprache und segmentäre Sozialorganisation ("Verwandtschaft") eine strukturale<br />
Homologie aufweisen, Sprechen, (Gaben-)Tausch und Eheschließung funktional interdependent<br />
sind, d.h. <strong>für</strong> Kultur konstitutiv. 123 Die beispielhafte Hervorhebung<br />
Strauss 1952: 301) Diese Struktur ist nicht die »Gesamtheit der in einer gegebenen Gesellschaft<br />
beobachtbaren Beziehungen«, sie ist viel mehr die diesen zugrundeliegende ("unbewußte") Realität.<br />
Während der Begriff strukturell Muster und Arrangements bezeichnet, die der direkten Wahrnehmung<br />
zugänglich sind, bezeichnet struktural »jede Anordnung, die in den Sprachen und menschlichen<br />
Zeichensystemen Bedeutung hervorbringt... Im Gegensatz zum Strukturellen kann das Strukturale nicht<br />
unmittelbar wahrgenommen ... werden.« (Fages 1968: 10)<br />
122 Julia Kristeva schreibt: »Lévi-Strauss' strukturale Anthropologie hatte unter anderem den Vorteil,<br />
ein Klassifikationssystem, das heißt ein symbolisches System in einer gegebenen Gesellschaft mit der<br />
sprachlichen Ordnung in ihrer Universalität (dem phonologischen Binarismus, den Abhängigkeiten und<br />
Eigenständigkeiten von Bedeutendem und Bedeutetem [signifiant-signifié] etc.) in Verbindung zu setzen.<br />
Sie gewann auf diese Weise eine universelle Wahrheit, ohne deshalb die subjektive Dimension und/oder<br />
die diachronische oder synchronische Implikation des sprechenden Subjekts in der allgemeinen Ordnung<br />
der Sprache zu vernachlässigen.« (Die Passage aus "Pouvoirs de l'horreur" wurde mir freundlicherweise von<br />
Xenia Rajewsky übermittelt, die auch die Übertragung aus dem Französischen besorgte).<br />
123 Der "eigentliche" Gabentausch ist mitnichten Epiphänomen. Zwar betonten auch die Maori nach<br />
Lévi-Strauss den Vorrang der Verwandtschaft, wenn sie sagten: »"Ein durch Gaben geknüpftes Band<br />
kann zerreißen, nicht aber ein menschliches Band." Zwei Gruppen mögen einander freundschaftlich<br />
begegnen und Geschenke austauschen und sich trotzdem später zerstreiten und bekriegen, aber die<br />
Heirat untereinander verbindet sie dauerhaft.« (Elsdon Best nach Lévi-Strauss 1967: 643) Diese Aussage
Die soziale als klassifikatorische Ordnung 77<br />
des Zusammenhangs von Inzestverbot und Soziabilität bzw. sozialer Integration<br />
macht die Stärke des Ansatzes von Lévi-Strauss aus. Im (fiktiven) Naturzustand paaren<br />
sich die Hominiden wahllos, verfügen über keine Begriffe — und tauschen<br />
nicht. 124 Keine Vergesellschaftung, d.h. keine Kultur ohne Sprache, ohne Tausch,<br />
ohne soziale Differenzierung (also Verwandtschaft). Der Inzest spricht nicht, Bedeutung<br />
kann es nur "innerhalb" der Kultur geben. Die einzelnen bedeutungstragenden<br />
Elemente (Laute, Dinge und Personen) sind aus sich heraus bedeutungslos, sie gewinnen<br />
ihren Wert (und damit die Fähigkeit, zu bedeuten) nur innerhalb des Systems,<br />
d.h. der Struktur die sie bilden und in die sie eingebettet sind. Die Ebenen<br />
der Strukturbildung mögen sich jeweils unterscheiden, das Prinzip aber, nach dem<br />
sich die Elemente gruppieren, ist stets identisch: die Opposition, in der sie zueinander<br />
stehen, beruht stets auf einer Differenz, die einzig existiert, um innerhalb eines<br />
integralen Ganzen überwunden zu werden, einer bedeutungsvollen kulturellen Ordnung<br />
als Bedingung der Möglichkeit sinnvoller instrumenteller, kommunikativer und<br />
expressiver Handlungen.<br />
NOTWENDIGE BEZIEHUNGEN<br />
»Wer Logik sagt, sagt Herstellung notwendiger Beziehungen.« (Lévi-Strauss 1962b:<br />
49) Notwendige Beziehungen zwischen Dingen und Personen können aber erst hergestellt<br />
werden, wenn diese voneinander geschieden sind — wobei die Betonung auf<br />
notwendig liegt. Das ist die meines Erachtens entscheidende Quintessenz von Lévi-<br />
Strauss' Untersuchung der Verwandtschaftsbeziehungen und Heiratsregeln in segmentären<br />
Gesellschaften. Auch wenn er Durkheims These vom sozialen Ursprung<br />
des logischen Denkens letztlich in ihr Gegenteil verkehrt, und die These vom Primat<br />
des Intellekts vor dem Sozialen vertritt, besteht auch <strong>für</strong> Lévi-Strauss ein enger Zusammenhang<br />
zwischen logischer und sozialer Differenzierung. Was gelebt wird, muß<br />
gedacht, was gedacht gelebt und dargestellt werden. Wie Durkheim in den Elementaren<br />
Formen des religiösen Lebens feststellt, setzt die Gesellschaft »eine bewußte<br />
Organisation ihrer selbst voraus, die nichts anderes ist als eine Klassifizierung.«<br />
(1912: 592) Die Gesellschaft besteht »nicht einfach aus der Masse von Individuen,<br />
aus der sie sich zusammensetzt [...] sondern vor allem aus der Idee, die sie sich von<br />
sich selbst macht.« (Ibid.: 566) 125 Da wir uns Dinge nur vorstellen können, wenn sie<br />
unterschieden sind, ist die soziale Unterteilung folglich zwingend notwendig, um<br />
erstens die Gesellschaft und zweitens uns selbst als gesellschaftliche Wesen zu denken.<br />
dürfte aber nur <strong>für</strong> Allianzen zwischen potentiell feindseligen Gruppen zutreffen und schwerlich auf das<br />
Leben innerhalb segmentärer Gesellschaften zu übertragen sein.<br />
124 Lévi-Strauss wäre bezüglich des Tauschs vielleicht besser von der Reziprozitätsnorm als vom<br />
Inzesttabu ausgegangen, denn dieses ist eine ebenso universelle <strong>Institut</strong>ion wie jenes, und wahrscheinlich<br />
noch elementarer, da Exogamie als reziprokes Handeln sich nur auf seiner Grundlage entfalten kann.<br />
125 Der primäre Zweck der Klassifikationssysteme ist folglich, »die Beziehungen zwischen den<br />
Wesenheiten begreifbar, intelligibel zu machen.« (Durkheim/Mauss 1903: 249)
78 Die soziale als klassifikatorische Ordnung<br />
In diesem Zusammenhang kommt in segmentären Gesellschaften den Heiratsregeln<br />
eine zentrale Bedeutung zu, ohne sie ginge entweder die Differenzierung oder der<br />
gesellschaftliche Zusammenhalt verloren; bei regellosen Heiraten untereinander<br />
würden die Segmente zu einem konturlosen Konglomerat verschmelzen, genügten<br />
die Gruppen sich hingegen als "inzestuöse" Einheiten selbst, trieben sie auseinander.<br />
Es geht bei der Eheschließung also darum, die definierten Beziehungen zwischen den<br />
Angehörigen der gesellschaftlichen Gruppen aufrecht zu erhalten. 126 Diese Beziehungen<br />
manifestieren sich in den wechselseitigen Verpflichtungen, welche dem Gabentausch,<br />
der wie die Heirat einem System von Verboten und Geboten folgt, zugrunde<br />
liegen. Klassifiziert, d.h. konzeptionell voneinander geschieden, sind nicht<br />
nur Menschen und die sie umgebende Natur (Tiere, Pflanzen, Naturphänomene),<br />
sondern auch die ihnen zugeordneten gesellschaftlichen Güter. Die Beziehung zu einem<br />
anderen Menschen bestimmt die Tauschverhältnisse, die ich mit ihm zu unterhalten<br />
habe bzw. die ich mit ihm unterhalten kann. Dies betrifft nicht allein die<br />
Relation zwischen den verwandtschaftlich verbundenen Segmenten, es gilt <strong>für</strong> jegliche<br />
definierte soziale Beziehung.<br />
Mit der Sozialorganisation verändern sich zwar die Tauschmuster, das Prinzip<br />
aber bleibt das gleiche: Ist eine Gesellschaft in Clans oder Lineages unterteilt, korrespondiert<br />
der zeremonielle Gabentausch von Gleichem gegen Gleiches (die sog.<br />
"ausgeglichene Reziprozität") mit den verwandtschaftlichen Beziehungen, während<br />
in der engeren Familie geteilt wird und man mit "Fremden" z.B. Kula treibt oder<br />
Handelsverbindungen unterhält. Bei den Guayaki hingegen (vgl. das Schema in Abbildung<br />
5), wo sich der Stamm in Horden gliedert, bestehen zwar verwandtschaftliche<br />
Beziehungen zwischen diesen Gruppen (der ganze Stamm kommt einmal im Jahr<br />
zum "Honigfest" zusammen, wo die künftigen Partner sich kennenlernen und<br />
schließlich heiraten), es existieren aber mit Ausnahme der Hordenexogamie keine<br />
Heiratsregeln, und ebensowenig wird auf Grundlage der Eheschließungen getauscht;<br />
die vorherrschende Form des Tauschs ist das Teilen innerhalb der Horde (zu<br />
Fremden besteht kein Kontakt, mit ihnen wird kein Handel getrieben). Diese Gegenüberstellung<br />
ist zwar recht schematisch und vielleicht unzulässig simplifizierend;<br />
sie mag aber ausreichen, um das simple Faktum zu illustrieren, daß sich im Tausch<br />
die jeweilige gesellschaftliche Ordnung manifestiert. Indem ich tausche, bringe ich<br />
eine spezifische Relation zum Ausdruck (die innerhalb der Horde eine andere ist als<br />
z.B. zwischen den Lineages) — wie vice versa die soziale Klassifikation den Tausch<br />
sowohl ermöglicht als auch weitestgehend determiniert. 127<br />
126 Bezogen auf seinen normativen Charakter kann man ein Verwandtschaftssystem durchaus mit der<br />
Sprache vergleichen: Das Wesen der Sprache ist nicht allein Kommunikation und Expression, sondern<br />
auch soziale Kontrolle, da sie die Kategorien von sozialer Norm und Abweichung in sich trägt.<br />
Verwandtschaft hingegen definiert wechselseitige Ansprüche und Verpflichtungen, wie sie auch von<br />
diesen bestimmt wird.<br />
127 Die Beziehung zwischen Männern und Frauen schließlich gründet in beiden Fällen in der geschlechtlichen<br />
Arbeitsteilung, die auch eine Art Austauschverhältnis ist (ich komme hierauf im folgenden<br />
Kapitel zurück).
Die soziale als klassifikatorische Ordnung 79<br />
Der Tausch ist also nicht nur Teil der sozialen bzw. kulturellen Wirklichkeit, diese<br />
Wirklichkeit wird auch dargestellt — um sie sozusagen begreifbar zu machen (z.B.<br />
"ich bin nicht überlebensfähig ohne die anderen"); man kann durchaus die Obligationen,<br />
Verteilungsregeln als "Drehbuch" und den Tauschakt als "Inszenierung" begreifen.<br />
128 Der Tauschakt ist stets ein symbolischer, d.h. er verweist über sich hinaus auf<br />
etwas anderes. 129 Gleiches gilt <strong>für</strong> die getauschten Dinge und die geheirateten Männer<br />
und Frauen, diese signifizieren nicht allein soziale Einheiten, sie signifizieren<br />
ebenso die Beziehungen, die zwischen diesen Einheiten bestehen. Diese Beziehungen<br />
werden nicht allein gedacht, sie werden ausgehend von wechselseitigen Verpflichtungen<br />
gelebt. 130 Jede Yamsernte, jedes erlegte Wild ist eine zukünftige Gabe, so<br />
Abbildung 5: Relationisschema (Guayaki)<br />
wie jeder neugeborene Mensch ein zukünftiger Ehegatte ist. Ihre soziale Funktion ist<br />
den Menschen und Dingen ebenso eingeschrieben wie ihr sozialer Ort. Dinge werden<br />
schließlich nicht getauscht, weil sie "gut zu essen" sind; die getauschten Dinge<br />
sind "gut zu denken" 131 — nur dann allerdings, wenn sie Personen und damit sozia-<br />
128 Die soziale Klassifikation schafft in gewichtigem Sinne stets ein sehr spezifisches "Innen" und<br />
"Außen" schafft. So wie soziale Nähe nur in Differenz zu sozialer Distanz konzipierbar ist, wird unter<br />
Umständen das Gefühl der Zusammengehörigkeit "unter Brüdern" durch die Distanz zu "den<br />
Schwägern" erzeugt oder zumindest stabilisiert.<br />
129 Zu den symbolischen Dimensionen des Tauschs vgl. z.B. auch Kämpf 1995.<br />
130 Auf diesen ursächlichen Zusammenhang zwischen Denken und Handeln verweist bereits Durkheims<br />
Konzept der kollektiven Vorstellung (représentation collectif), in welchen die Gruppe sich selbst und »ihre<br />
Beziehungen zu den sie affizierenden Gegenständen denkt.« (Durkheim 1901: 94) Représentation ist mit<br />
"Vorstellung" aber nur unzureichend übersetzt solange man den Begriff mit "Idee" assoziiert. Die "Vorstellung"<br />
ist auch eine "Vorführung", bzw. ihr normativer Charakter mündet in eine solche (vgl. auch<br />
Lukes 1973: 6f.).<br />
131 Die Paraphrase führt zurück zu Lévi-Strauss und seinen Thesen zum Totemismus, die meinen<br />
vorstehenden Ausführungen zugrunde liegen. Meines Erachtens sollte man mit dem Gabentausch<br />
(zumindest was seine logische Basis betrifft) ebenso verfahren, wie Lévi-Strauss es <strong>für</strong> den sog. "totemistischen<br />
Komplex" vorschlug: ihn im allgemeineren Bereich von Benennung, Bezeichnung, letztlich<br />
Klassifikation sozusagen "auflösen". Auch wenn die Konstitutionslogik rein formal gesehen eine andere<br />
ist, ähnelt der Operationsmodus beim Gabentausch stark dem totemistischen. Der sogenannte<br />
Totemismus drückt mit Hilfe einer sehr speziellen, aus Tier– und Pflanzennamen gebildeten<br />
Nomenklatur »Wechselbeziehungen und Gegenüberstellungen aus, die auch anders in Form gebracht
80 Die soziale als klassifikatorische Ordnung<br />
len Einheiten zugeordnet sind. Durch definierte Besitzrechte und Abstammungsregelungen,<br />
d.h. die Zuordnung von Personen zu Dingen bzw. zu anderen Personen<br />
(z.B. "Brüder" zu Schwestern), werden diese Personen und Dinge zu Bedeutungsträgern<br />
und Tausch wie Eheschließung zu bedeutungsvollen Akten. Wie bereits im<br />
vorigen Kapitel erwähnt, gründet der Gabentausch nicht allein in den Verpflichtungen<br />
zu geben, zu nehmen und zu erwidern; sondern auch in der "Unveräußerbarkeit"<br />
der Dinge. So wird erst durch das Tabu, mit welchem die Jagdbeute des<br />
Guayaki belegt ist, diese völlig zum gesellschaftlichen Gegenstand — Beute machen<br />
schließlich auch Raubtiere. Das Teilen ist auch eine symbolische Handlung, es verdeutlicht<br />
die Differenz zwischen dem Jäger und seinen Gefährten ebenso wie deren<br />
wechselseitige Abhängigkeit: ich erhalte nie genau das, was ich gab; ich esse stets das<br />
Fleisch des anderen. Es ist dergestalt das Konstitutionsprinzip von Kultur, die Güter<br />
und die Menschen zu trennen, sichtbar zu unterscheiden, um sie schließlich auf einer<br />
sekundären Ebene, der kulturellen eben, zusammenzuführen. Der Gabentausch gewährleistet<br />
somit (ebenso wie die Exogamie) die wechselseitige Durchdringung und<br />
Verbindung der sozialen Einheiten in einer denk–baren segmentierten Gesellschaft.<br />
So wie Sprache und Sprechen eine untrennbare Einheit bilden, kann man auch soziale<br />
Differenzierung — Verortung aufgrund der kulturellen Setzung von Differenzen —<br />
und Tausch — das Zum–Ausdruck–Bringen und gleichzeitige Überwinden dieser<br />
Differenz im Tauschakt — nicht substantiell voneinander scheiden.<br />
NATUR UND KULTUR<br />
Die "differentiellen Abstände" zwischen Menschen und gesellschaftlichen Gruppen<br />
sind <strong>für</strong> die kulturelle Ordnung konstitutiv. Unterscheidungen einerseits und vorgeschriebene<br />
soziale Beziehungen andererseits zwischen den unterschiedlichen "Klassen"<br />
von Personen sind Teil einer (kollektiven) Selbstdefinition — die im Tausch<br />
zum Ausdruck kommt. Klassifikationssysteme sind <strong>Institut</strong>ionen, deren Basis kollektive<br />
Vorstellungen und deren Ausdruck Handlungen (Gebote und Verbote) sind. 132<br />
Die Individuen "leben" die Kategorien, sie sind, was sie tun (müssen). Der Jäger<br />
teilt, weil ein Jäger dies tut; ansonsten wäre er keiner. Indem er tauscht, bezeichnet<br />
werden können; so in einigen Stämmen Nord– und Südamerikas durch die Gegenüberstellung von<br />
Himmel-Erde, Krieg-Frieden, oberhalb-unterhalb, rot-weiß usw.« (Lévi-Strauss 1962a: 115) Die<br />
sinnlich wahrnehmbare Wirklichkeit der natürlichen Gattungen »läßt Begriffe und Beziehungen<br />
durchscheinen, die vom spekulativen Denken von den Gegebenheiten der Beobachtung aus erfaßt<br />
werden. Endlich begreift man, daß die natürlichen Gattungen nicht ausgewählt werden, weil sie "gut zu<br />
essen" sind, sondern weil sie "gut zu denken" sind.« (Ibid.: 116)<br />
132 In einem Klassifikationssystem hat alles ebenso seinen Ort, steht zueinander in genau definierter<br />
Beziehung, wie es sauber ("rein") voneinander geschieden ist (vgl. Douglas 1966). Eine Vermischung<br />
der Elemente hätte fatale Folgen: berührte die Frau den Bogen des Mannes, kämen männliche also mit<br />
weiblichen Attributen in Berührung, wäre der Besitzer des Bogens pane und müßte sich einem Reinigungsritual<br />
unterziehen. So wird bei den Guayaki der Mann zum Mann in seiner Differenz zur Frau.<br />
»Mann = Jäger = Bogen; Frau = Sammeln = Korb: eine doppelte Gleichung, deren Strenge den<br />
Lebenslauf der Aché bestimmt.« (Clastres 1972: 193) Ein Mann ist keine Frau, Natur ist nicht Kultur.
Die soziale als klassifikatorische Ordnung 81<br />
er sich. Nach Clastres ermöglicht der Verzicht auf das erlegte Wild zudem, den<br />
Übergang von der Natur zur Kultur immer wieder neu zu manifestieren. Das Tier<br />
als Naturwesen schlägt seine Zähne in das rohe Fleisch der eigenen Beute, als Kulturwesen<br />
ißt der Guayaki(-Mann) das von den Frauen gekochte Fleisch des anderen.<br />
Weil das Tabu, mit welchem die Jagdbeute belegt ist, dergestalt<br />
»das Individuum zwingt, sich von seinem Wild zu trennen, zwingt es dieses auch, den anderen<br />
zu vertrauen, und ermöglicht somit, daß sich das soziale Band endgültig knüpfen kann; die<br />
wechselseitige Abhängigkeit der Jäger garantiert die Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Bandes,<br />
und die Gesellschaft gewinnt an Stärke, was die Individuen an Autonomie verlieren. Die Trennung<br />
des Jägers von seinem Wild begründet die Verbindung der Jäger untereinander, d.h. den<br />
Vertrag der die Guayaki-Gesellschaft lenkt. [...] Indem das Nahrungstabu die unmittelbare Berührung<br />
zwischen dem Jäger und seinem Wild auf die Seite der Natur verweist, steht es mitten<br />
in der Kultur selbst: zwischen den Jäger und seine Nahrung setzt es die Vermittlung anderer<br />
Jäger.« (Clastres 1974: 112f.) 133<br />
Somit markiert der Tausch tatsächlich den Übergang von Natur zu Kultur (anders<br />
allerdings, als in den Elementaren Strukturen der Verwandtschaft konzipiert). 134 Jedenfalls<br />
ist er ein universelles Phänomen. Im Unterschied zum ungeordneten "Naturzustand"<br />
ist das wichtigste Kennzeichen von Kultur, daß sie eine bedeutungsvolle<br />
Ordnung ist. Die Bedeutungen kommen in der Sprache ebenso zum Ausdruck, wie<br />
in den klassifikatorischen Ordnungen der Verwandtschaft und des Tauschs. Und so,<br />
wie jede Kultur über eine Sprache verfügt, ist die Untersagung des Inzest ein ebenso<br />
universelles Faktum wie der Tausch. Die Sprachen der einzelnen Gesellschaften unterscheiden<br />
sich ebenso voneinander wie deren Verwandtschafts– und die Tauschbeziehungen,<br />
alle drei Ordnungen gründen aber in allen Kulturen im gleichen Prinzip:<br />
der kulturellen Setzung von Differenzen und Normen.<br />
Weiter sollte man bezüglich des ursächlichen Zusammenhangs von Sprache, Verwandtschaft<br />
und Tausch nicht gehen. Alle drei sind konstitutive Merkmale des gesellschaftliches<br />
Lebens, unhintergehbar und stehen in komplementärer Beziehung<br />
133 Diese Vermittlung wird aber primär von den Frauen geleistet: das verteilte und anschließend konsumierte<br />
Fleisch ist nicht länger roh, sondern gekocht d.h. kulturalisiert. Der Jäger könnte seine<br />
gesellschaftliche Rolle nicht ausfüllen, stände nicht seine Frau als vermittelnde und transformierende<br />
Instanz zwischen ihm und den anderen.<br />
134 Clastres beschreibt eindringlich das sehr explizite Bemühen der Guayaki um den Abstand von der<br />
Natur, es nimmt teilweise groteske Formen an: »Eine Sorge teilen alle Indianer miteinander: unentwegt<br />
der Naturwelt gegenüber ihre Menschlichkeit zu bestätigen und zu bewahren, ständig darauf zu achten,<br />
nicht in der Wildheit der Natur zu versinken, die immer den Menschen auflauert um sie zu verschlingen.<br />
Auch setzen sie, sowohl vom ethischen wie von ästhetischen Gesichtspunkt aus, ihre ganze Ehre darein,<br />
sich von den Tieren zu unterscheiden bzw. zumindest die Andersartigkeit, die sie von ihnen trennt, zum<br />
Höchstmaß auszubilden. Die Tiere sind behaart, die Menschen sind es nicht, von einigen Stellen des<br />
Körpers abgesehen [...] Doch selbst dies, so wenig es ist, muß man wegmachen, man muß es zum<br />
Verschwinden bringen, um jede Möglichkeit der Verwechslung mit dem Körper eines Tieres<br />
auszuschließen. Man muß den Körper rigoros zwingen, muß ihm Gewalt antun, er muß gut sichtbar das<br />
Zeichen der Kultur tragen, zum Beweis, daß sein Aufstieg aus der Natur unwiderruflich ist: man muß<br />
sich enthaaren. (1972: 89)
82 Die soziale als klassifikatorische Ordnung<br />
zueinander. 135 — Ich fasse kurz zusammen: Im Tauschakt können die Menschen sich<br />
als gesellschaftliche Wesen wahrnehmen, so wie gleichzeitig der Tausch Gesellschaft<br />
perpetuiert. Die kulturelle Setzung von Differenzen ist dabei Bedingung der Möglichkeit<br />
des Tauschs als bedeutungsvoller Handlung. 136 Vielleicht verspüren Menschen<br />
eine (unbewußte) Sehnsucht nach Aufhebung dieser Differenzen und der sie<br />
konstituierenden Regeln, vielleicht macht ihnen dieses Verlangen angst, und muß<br />
darum abgewehrt werden — aber das sind lediglich Spekulationen. 137 Möglicherweise<br />
liegt auch der Generierung der Unterscheidungen und Trennungen ein Verlangen<br />
zugrunde, ein Streben danach, sich zu unterscheiden, um sich denken, um<br />
Mensch sein zu können. 138 Indem ich die Ansprüche des anderen anerkenne, erkenne<br />
ich mich selbst als gesellschaftliches Wesen. Anders können wir nicht sein; eine<br />
vollständig undifferenzierte Gesellschaft ist nicht denkbar, und damit nicht lebbar.<br />
Soziale Beziehungen ruhen also nicht nur auf einem ökonomischen und moralischen,<br />
sondern notwendig auch auf einem logischen Fundament; der Gabentausch ist Teil<br />
einer bedeutungsvollen (symbolischen) Ordnung, die ihn ermöglicht und die er wiederum<br />
zum Ausdruck bringt und perpetuiert. Der Tauschakt ist also auch ein expressiver,<br />
er ist bedeutungsvoll, während er gleichzeitig ökonomisch oder gesellschaftlich<br />
notwendig sein kann. Es wäre unangemessen, diese praktischen und symbolischen<br />
Aspekte des Tauschs trennen oder gegeneinander ausspielen zu wollen, beide sind,<br />
135 Im Wilden Denken vertritt Lévi-Strauss eine ähnliche Position: »Der Austausch der Frauen und der<br />
Austausch der Nahrung sind Mittel, die gegenseitige Durchdringung der sozialen Gruppen zu<br />
gewährleisten oder diese Durchdringung offenkundig zu machen. Da es sich um Verfahren desselben<br />
Typs handelt (die übrigens allgemein als zwei Aspekte desselben Verfahrens aufgefaßt werden), ist es<br />
verständlich, daß sie je nachdem entweder gleichzeitig vorhanden sein und ihre Wirkungen (beide im<br />
Bereich des Realen, oder das eine im Bereich des Realen und das andere im Bereich des Symbolischen)<br />
kumulieren können oder daß sie abwechselnd vorhanden sind, wobei dann nur ein Verfahren die<br />
Gesamtlast der Funktion trägt oder die Last, diese auf symbolische Weise darzustellen, wenn sie auf<br />
andere Weise erfüllt wird, wie das auch geschehen kann, wenn keines der beiden Verfahren vorhanden<br />
ist.« (1962b: 130) Die vorstehenden Sätze zeigen auch, daß Lévi-Strauss mit seinem Konzept des<br />
Tauschs den Rahmen des Durkheimschen "Funktionalismus" keineswegs verlassen hat.<br />
136 Wenn man die <strong>Institut</strong>ion derart von ihren Wirkungen her erklärt, erspart man sich eine Argumentation,<br />
die von unterstellten Ursachen ausgeht. Die Frage nach den Ursprüngen, der Entstehung des<br />
Tauschs und seiner <strong>Institut</strong>ionalisierung ist m.E. ohnehin aufgrund des Fehlens einschlägiger historischer<br />
Evidenzen kaum zu beantworten.<br />
137 Wer die Differenzen leugnet, gibt seine Menschlichkeit preis. Dies gilt auch <strong>für</strong> das Inzesttabu: »Wer<br />
mit seiner Mutter schläft, wird in einen Tapir verwandelt; wer sich mit seiner Schwester vergnügt, in<br />
einen Brüllaffen; wer seine eigene Tochter verführt, wird zum Rehbock. Der Mann der Inzest begeht,<br />
zerstört die Menschlichkeit in sich, deren wesentliche Regel er mißachtet hat. Er gibt sich auf und stellt<br />
sich außerhalb der Kultur, er fällt in den Naturzustand zurück, er wird zum Tier. Man spielt nicht<br />
ungestraft damit, Unordnung in die Welt hineinzutragen. Man muß die verschiedenen Ebenen, aus<br />
denen sie sich zusammensetzt, an ihrem Platz belassen, hier die Natur mit ihren Tieren, dort die Kultur<br />
mit ihrer menschlichen Gesellschaft. Von einem zum anderen gibt es keinen Übergang.« (Clastres 1972:<br />
152)<br />
138 Die Konstruktion bzw. Konstitution der Differenzkategorien, und damit auch die Bestimmung der<br />
distinkten Oppositionsmerkmale, mag tatsächlich jener "Forderung nach Ordnung" entspringen, die<br />
nach Lévi-Strauss die Grundlage jeglichen menschlichen Denkens ist (vgl. 1962b: 21).
Die soziale als klassifikatorische Ordnung 83<br />
wie meine Ausführungen im vorigen Kapitel hinreichend deutlich gemacht haben<br />
sollten, untrennbar ineinander verwoben. Das Gebotene kann durchaus das Erstrebenswerte<br />
und Nützliche sein. In jedem Fall sind die Ziele, welche Menschen verfolgen<br />
(ihre "Interessen" und "Bedürfnisse"), ebenso wie ihr Selbstverständnis, zumindest<br />
weitestgehend von der klassifikatorischen Ordnung vorgegeben bzw. in diese<br />
eingeschrieben — sie ist auch eine Ordnung des (kulturell kodifizierten) Begehrens.<br />
Selbst die affektiven Bande sind dergestalt oft die gesellschaftlich präformierten,<br />
"vorgeschriebenen", sie entstehen nicht willkürlich und zufällig. Lévi-Strauss zitiert<br />
in diesem Zusammenhang Margaret Meads Dialog mit einem Arapesh:<br />
»Kommt es vor, daß ein Mann mit seiner Schwester schläft? Die Frage ist absurd. "Nein, wir<br />
schlafen nicht mit unseren Schwestern. Wir geben unserer Schwestern an andere Männer und<br />
bekommen da<strong>für</strong> ihre Schwestern." Die Ethnographin insistiert: Falls diese Möglichkeit trotz<br />
allem doch einmal einträte, was würdet ihr davon halten? — Daß einer von uns mit seiner<br />
Schwester schläft? Was <strong>für</strong> eine Frage! — Aber nehmt einmal an, daß so etwas passiert ...<br />
Schließlich erhält sie von ihrem Informanten, dem es schwerfällt, sich in die <strong>für</strong> ihn kaum vorstellbare<br />
Situation zu versetzen, in der er mit einem des Inzests schuldigen Gefährten diskutieren<br />
müßte, folgende Antwort in dem imaginären Dialog: "Was, du möchtest deine<br />
Schwester heiraten? Bist du denn nicht ganz richtig im Kopf? Möchtest du denn keinen Schwager?<br />
Siehst du denn nicht ein, daß du wenigstens zwei Schwager bekommst, wenn du die<br />
Schwester eines anderen Mannes heiratest und ein anderer Mann deine eigene Schwester bekommt?<br />
Mit wem willst du denn auf die Jagd oder in den Garten ziehen, und wen willst du<br />
besuchen?« (1967: 647f.)<br />
Ein Leben ohne Schwäger ist kein Leben. Schwäger zu erhalten erscheint als wahrer<br />
"Zweck" der Ehe. Der Inzest ist somit »eher sozial absurd als moralisch verurteilenswert<br />
[...] Der ungläubige Ausruf des Informanten ... liefert dem Gesellschaftszustand<br />
seine goldene Regel.« (Ibid.: 648)<br />
Und so dürfte auch die Verweigerung des Tauschs keine denkbare Option<br />
sein, zumindest nicht innerhalb der segmentären Gesellschaft. Menschliches Handeln<br />
ist allein im gesellschaftlichen Rahmen möglich und bedeutungsvoll; die institutionellen<br />
Grundlagen determinieren es weitgehend (aber niemals völlig). Der "befähigende"<br />
Aspekt jeglichen Ordnungssystems betrifft in diesem Sinne nicht allein die<br />
kognitive Ebene, er durchwaltet ebenso unsere Interessen und Bedürfnisse; das was<br />
wir wünschen, hoffen, begehren (dürfen). Man kann unser Hoffen und Streben nicht<br />
von den gesellschaftlichen Bedingtheiten trennen, die es durchwalten. Auf die Frage,<br />
warum er teilt, könnte der Indianer schließlich auch ganz schlicht antworten: "Ich<br />
bin ein Guayaki, und wir machen das nun einmal so. Täte ich es nicht, teilte ich nicht<br />
mit meinen Gefährten wäre ich kein Guayaki." Entgegen allem Anschein wäre das<br />
eine sehr aufschlußreiche Begründung, vielleicht sogar die aufschlußreichste. Selbst<br />
wenn man auf sich gestellt im Wald überleben könnte: was wäre das <strong>für</strong> ein Leben?<br />
139<br />
139 Die begriffliche Scheidung zwischen affektiv und kognitiv ist lediglich eine "künstliche", <strong>für</strong> unser<br />
kulturelles Selbstverständnis allerdings fundamentale Dichotomisierung, ein Teil der Art und Weise, wie<br />
wir uns denken — und empfinden.
84 Die soziale als klassifikatorische Ordnung<br />
Damit habe ich mich sehr weit vom vermeintlich <strong>für</strong> das Verständnis des Gabentauschs<br />
grundlegenden Widerspruch von (erzwungenem) Verzicht und ("natürlichem")<br />
Begehren, bzw. Norm und Eigeninteresse entfernt. Es sollte mittlerweile<br />
deutlich geworden sein, daß eine Entgegensetzung von (kultureller) Notwendigkeit<br />
und (individueller) Neigung der sozialen Logik des Gabentauschs nicht gerecht wird.<br />
Ich hatte weiter oben (im 1. Kapitel) die Frage erwähnt, mit der W.H.R. Rivers seine<br />
Gespräche mit den Eingeborenen zu beginnen pflegte: »Angenommen, Du hättest<br />
das Glück, eine Guinea zu finden, mit wem würdest Du sie teilen?« Man muß kurz<br />
innehalten und sein Augenmerk auf das "würdest" richten. Nicht wollen, nicht müssen.<br />
Das Wort entzieht sich der Dichotomie von Zwang und Streben, welche weder<br />
geeignet ist, die Haltung der Tauschenden noch das Wesen der Obligation, der<br />
wechselseitigen Verpflichtung zu erfassen — man bedenke nur die vielfältigen Konnotationen,<br />
die in unserem "ich bin ihm/ihr verpflichtet" mitschwingen. Eine Moralphilosophie,<br />
die im starren Schematismus von Pflicht und Neigung als antagonistischen<br />
d.h. unversöhnlichen Polen wurzelt, kann folglich nur einen kleinen Ausschnitt<br />
der moralischen Wirklichkeit erfassen und keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit<br />
erheben. 140<br />
Ein letzter Punkt ist an dieser Stelle nachzutragen: Lévi-Strauss' Analysen beziehen<br />
sich allein auf segmentär differenzierte Gesellschaften. Diese sind sein engerer<br />
Untersuchungsgegenstand, und auf sie bezogen ist sein Ansatz außerordentlich erhel-<br />
140 Moralisch ist das, was uns geboten ist, wozu wir verpflichtet sind. Aber »der Begriff der Pflicht<br />
[erschöpft] keineswegs den der Moral« (Durkheim 1906: 85). Durkheim wendet sich gegen Kant, wenn<br />
er schreibt: »Wir können nämlich eine Handlung, die uns nichts bedeutet, nicht einzig deshalb<br />
ausführen, weil sie geboten ist. Einen Zweck verfolgen, der uns kalt läßt, der uns nicht gut erscheint, der<br />
unser Gefühl nicht berührt, ist etwas psychologisch unmögliches. Unbeschadet seines obligatorischen<br />
Charakters muß der moralische Zweck also noch erstrebt werden und erstrebenswert sein; das<br />
Erstrebenswertsein bildet ein zweites Merkmal einer jeden moralischen Handlung. Nur trägt das dem<br />
moralische Leben eigentümliche Erstrebenswertsein auch Züge des erwähnten Merkmals der<br />
Obligation; es ähnelt nicht dem Erstrebenswertsein von Gegenständen, an die sich unsere üblichen<br />
Wünsche heften. Wir erstreben die durch eine Regel gebotene Handlung auf eine besondere Weise.<br />
Unser Elan, unser Trachten nach ihr wird stets von einer gewissen Mühe, einer Anstrengung begleitet.<br />
Auch dann, wenn wir die moralische Handlung mit enthusiastischem Eifer vollziehen, spüren wir, daß<br />
aus uns selbst heraustreten, daß wir uns überwinden, daß wir uns über unser natürliches Sein erheben,<br />
und das geht nicht ohne eine gewisse Spannung, einen gewissen Selbstzwang vor sich. Wir sind uns<br />
bewußt, daß wir einem erheblichen Teil unserer Natur Zwang antun.« (Ibid: 96) »Die Pflicht, der<br />
kantische Imperativ, bildet also nur einen abstrakten Aspekt der moralischen Wirklichkeit; in Wahrheit<br />
zeigt sie immer und gleichzeitig jene beiden Aspekte, die nicht voneinander zu trennen sind. Noch nie<br />
wurde eine Handlung einzig und allein aus Pflicht vollzogen; immer mußte sie in irgendeiner Weise als<br />
gut erscheinen. Umgekehrt gibt es wahrscheinlich auch keine Handlungen, die ausschließlich<br />
erstrebenswert wären, denn sie erfordern stets eine Anstrengung.« (Ibid: 97) Damit erzielt Durkheim<br />
zwar einen deutlichen Fortschritt gegenüber Kant, bleibt aber letztlich in dessen Dichotomie verhaftet,<br />
wie bereits die Programmatik deutlich macht, die er den vorstehend zitierten Ausführungen voranstellt:<br />
»Wir werden zeigen, inwiefern die Gesellschaft etwas Nützliches und Erstrebenswertes <strong>für</strong> das<br />
Individuum ist, das außerhalb ihrer nicht existieren kann, und das sie nicht verneinen kann, ohne sich<br />
selbst zu verneinen: inwiefern aber gleichzeitig, da die Gesellschaft über das Individuum hinausreicht,<br />
dieses Individuum sie nicht wollen und erstreben kann, ohne seiner individuellen Natur in gewissem<br />
Maße Gewalt anzutun.« (Ibid.: 87) Die Generalisierung ist durchaus zu bezweifeln, die Gewalt der<br />
moralischen Ordnung tritt erst dort zutage, wo sie als repressiv empfunden wird.
Die soziale als klassifikatorische Ordnung 85<br />
lend; er ermöglicht schließlich auch, die Gabe mit der Ware zu kontrastieren. 141 Sowohl<br />
in den "primitiven" als auch in den entwickelten Industriegesellschaften werden<br />
soziale Beziehungen mittels Dingen hergestellt, darin besteht der Unterschied<br />
nicht. Im Fall der Ware signifizieren die Güter aber keine Personen bzw. soziale<br />
Segmente (und die konkreten Verpflichtungen, die zwischen ihnen bestehen), sondern<br />
quantitative und sehr abstrakte Größen wie "Nutzen" und "Wert", welche den<br />
Dingen zugeschrieben werden. Und während beim Gabentausch die gegebene Sache<br />
als Teil der Persönlichkeit des Gebers gilt, erscheinen in den entwickelten Industriegesellschaften<br />
die Personen allzuoft als Anhängsel der Waren. Zumindest hat es den<br />
Anschein, als seien Beziehungen zwischen Subjekten in der bürgerlichen Gesellschaft<br />
weitgehend durch Beziehungen zwischen Objekten ersetzt worden.<br />
Bevor ich hierauf im 6. Kapitel dezidiert eingehe, will ich im folgenden zunächst erneut<br />
das Universum des Gabentauschs in seiner Vielfalt und scheinbaren Widersprüchlichkeit<br />
ausleuchten.<br />
4. Kapitel<br />
GLEICHE UND UNGLEICHE<br />
141 Lévi-Strauss stellt derartige Überlegungen nicht an, sein Weg führt vom Gabentausch fast direkt zu<br />
den "Strukturen des Geistes", in deren Angesicht die Differenz von Waren– und Gabentausch bedeutungslos<br />
wird. Für Lévi-Strauss sind die Imperative der Kultur schließlich diejenigen des menschlichen<br />
Geistes. Ihn verbindet laut Sahlins mit Durkheim ein »Naturalismus ausgeprägtester Art [...] Die ganze<br />
Rede von "zugrundeliegenden" Gesetzen des Geistes ordnet alle bestimmenden Kräfte der geistigen<br />
Seite zu, auf die die kulturelle Seite bloß antworten kann, so als ob die erste das aktive und die zweite<br />
nur das passive Element wäre. Vielleicht wäre es besser, wenn man sagt, daß die Strukturen des Geistes<br />
weniger die Imperative der Kultur als vielmehr deren Hilfsmittel sind. Sie bilden eine Reihe von<br />
organisatorischen Möglichkeiten, die dem kulturellen Vorhaben der Menschen zur Verfügung stehen —<br />
ein Vorhaben allerdings, das je nach seinem Charakter sowohl ihre Verwendung wie auch ihre Ausstattung<br />
mit verschiedenen bedeutungsvollen Gehalten bestimmt. Wie wäre es sonst zu erklären, daß es<br />
in der Kultur universelle Strukturen gibt, die dennoch nicht universell präsent sind?« (1976: 178f.) Es ist<br />
demnach notwendig, »die geistige Ausstattung des Menschen eher als Instrument statt als Determinante<br />
von Kultur zu bestimmen.« (Ibid.) Eine gute Darstellung und Kritik der Position Lévi-Strauss' liefert<br />
z.B. Umberto Eco (1968).
86 Gleiche und Ungleiche<br />
Die "primitive" Gesellschaft ist in vielerlei Hinsicht eine Vereinigung von Gleichen<br />
auf Basis der Gegenseitigkeit, des reziproken Tauschs. Die sog. "egalitären" Gesellschaften<br />
sind allerdings keinesfalls so "gleich", wie sie in ihrer Funktion als Negativfolie<br />
unserer Gesellschaft manchmal erscheinen. Ich hatte bereits im 1. Kapitel darauf<br />
verwiesen, daß selbst in den "einfachsten" Gesellschaften zumindest drei elementare<br />
Formen sozialer Ungleichheit anzutreffen sind: zwischen Männern und<br />
Frauen, zwischen Alten und Jungen und zwischen Stammesangehörigen und Fremden.<br />
142 Gleich, d.h. einander gleichwertig sind immer nur diejenigen, die gleichberechtigt<br />
Gleiches — oder "objektiv" Gleichwertiges — austauschen. 143 Ebenso, wie<br />
er diese Gleichheit der Tauschenden (und deren Grenzen) zum Ausdruck bringt,<br />
kann der Gabentausch zudem auch Quelle von Ungleichheit sein. Um dies zu illustrieren,<br />
werde mich im folgenden zunächst mit dem sogenannten wettstreitenden<br />
Gabentausch in Gestalt des Potlatch und der melanesischen "Verdienstfeste" befassen.<br />
Da diese Formen des Tauschs bereits in einer Mischung aus reziproken und redistributiven<br />
Strukturen gründen, werde ich anschließend auf letztere und die mit<br />
ihnen verbundene Herausbildung von Statusunterschieden und sozialen Schichten<br />
eingehen. In diesem Zusammenhang diskutiere ich schließlich das Verhältnis der gesellschaftlichen<br />
Ungleichwertigkeit von Personen, welches die Tauschbeziehungen<br />
nicht zuletzt auch in unserer Ökonomie determiniert. Die Reflexion über die<br />
Reichweite der Norm reziproker Erwiderung ist dergestalt gleichzeitig eine Reflexion<br />
über die Wurzeln sozialer Ungleichheit.<br />
RIVALITÄT UND ZERSTÖRUNG: DER POTLATCH<br />
In vielen Gesellschaften hat man allein, um zu geben. Das gilt auf allen Ebenen: »Das<br />
Ziel der Anhäufung von Reichtum ist häufig, diesen fortzugeben.« (Sahlins 1972:<br />
142 So ist z.B. die Fleischverteilung bei den Hadza nur bedingt "gleich und gerecht": »Das meiste Fleisch<br />
wird unter alle im Lager verteilt. Aber einige spezielle Stücke des besten Fleisches werden anders behandelt:<br />
sie sind der Gruppe der initiierten Männer vorbehalten.« (Barnard/Woodburn 1988: 17)<br />
143 Seyla Benhabib beschreibt in ihrer Diskussion der Habermas'schen Grundlegung einer kommunikativen<br />
Ethik (die im weitesten Sinn fraglos auch in den Tausch eingewoben ist) die Problematik sehr<br />
treffend: »Selbst wenn einige allgemeine Symmetrie– und Reziprozitätsnormen in allen Sprechakten und<br />
Interaktionen vorausgesetzt werden, so implizieren sie doch nicht nur einen einzigen semantischen Inhalt.<br />
Symmetrie und Reziprozität müssen nicht notwendig das Recht aller auf symmetrische und reziproke<br />
Teilnahme bedeuten. Um auch dies geltend machen zu können, bedarf es eines spezifischen Begriffs der<br />
Gleichheit, wozu wir einen Inhalt und die entsprechende Interpretation normativ vereinbaren müssen,<br />
denen gemäß den formal in der idealen Sprechsituation angelegten Symmetrie– und Reziprozitätsregeln<br />
eine genau bestimmte semantische Deutung verliehen wird.« (1986: 180f.) Benhabib präzisiert das, was<br />
sie als "semantische Dimension" bezeichnet, in einer Anmerkung: »Es gibt mannigfache soziologische<br />
Belege da<strong>für</strong>, daß alle bekannten Gesellschaften die Beziehungen zwischen ihren Mitgliedern gemäß<br />
Reziprozitätsnormen regulieren; wie jedoch Lévi-Strauss Ausführungen in Die elementaren Strukturen der<br />
Verwandtschaft eindrücklich zeigen, ist die Frage, wer als der "relevante andere", mit dem man in eine<br />
reziproke Beziehung eintritt, zu gelten hat, durch die Feststellung einer solchen Regel allein noch nicht<br />
beantwortet.« (Ibid.: 263) Der reziproke Tausch symbolisiert dergestalt sowohl die Gleichheit der<br />
Tauschenden — »in dem von Lévi-Strauss erörterten Fall: die männlichen Mitglieder, die ihre Frauen<br />
tauschen« (Ibid.) — wie die Ungleichheit derer, die vom Tausch ausgeschlossen sind.
Gleiche und Ungleiche 87<br />
213) Dieser Satz trifft wahrscheinlich auf keine Gesellschaften besser zu als auf jene<br />
in vielerlei Hinsicht reichen Kulturen der amerikanischen Nordwestküste, die den<br />
sog. Potlatch (oder Potlatsch), eine Art Tauschwettstreit, zelebrieren. 144 Marcel<br />
Mauss bezeichnete den Potlatch, zu seiner Zeit eine gigantische Verschwendung und<br />
Zerstörung materieller Güter, als »totale Leistung vom agonistischen Typ« (Mauss<br />
1925: 29), ein Terminus, der fast schon alles aussagt:<br />
»Der Verbrauch und die Zerstörung sind so gut wie unbegrenzt. Bei einigen Potlatchs ist man<br />
gezwungen, alles auszugeben, was man besitzt; man darf nichts zurückbehalten. Derjenige, der<br />
seinen Reichtum am verschwenderischsten ausgibt, gewinnt an Prestige. Alles gründet auf dem<br />
Prinzip des Antagonismus und der Rivalität. Der politische Status der Individuen in den Bruderschaften<br />
und Clans sowie überhaupt jede Art von Rängen, wird durch den "Eigentumskrieg"<br />
erworben [...] Die Heiraten der Kinder, die Rangstufen in den Bruderschaften werden<br />
einzig im Rahmen von Potlatchs und Gegen-Potlatchs bestimmt. Man verliert seine Stellung<br />
im Potlatch, wie man sie im Krieg, Spiel, beim Rennen oder beim Kampf verliert. In einigen<br />
Fällen geht es nicht einmal um Geben und Zurückzahlen, sondern um Zerstörung, nur um<br />
nicht den Anschein zu erweken, als legte man Wert auf eine Rückgabe. Man verbrennt ganze<br />
Kisten mit Kerzenfischen oder Walfischöl, Häuser und tausende von Wolldecken, man zerbricht<br />
die wertvollsten Kupferplatten oder wirft sie ins Wasser, um einen Rivalen auszustechen,<br />
"flach zu machen"« (Ibid.: 85ff.) 145<br />
Trotz dieser befremdlichen Details explizierte Mauss gerade am Beispiel des Potlatchs<br />
die Verpflichtungen des Gebens, Nehmens und Erwiderns. Tatsächlich sind<br />
die Regeln des Gabentauschs auch im Potlatch gegenwärtig, der an seiner Basis etwas<br />
durchaus unspektakuläres ist. Das Wort "Potlatch" stammt aus dem Chinook, einer<br />
an der Nordwestküste Nordamerikas weitverbreiteten Verkehrssprache, und bedeu-<br />
144 Die den Potlatch treibenden Indianerstämme lebten an den Küsten Alaskas (Tlingit und Haida) und<br />
British-Columbias (Haida, Tsimshian und Kwakiutl). Obwohl all diese Stämme keinen Ackerbau betreiben,<br />
und eher vom Fischfang denn von der Jagd leben, verfügen sie über großen Reichtum und eine<br />
bemerkenswert ausdifferenzierte Kultur und Sozialstruktur. »Der riesige Überfluß an Nahrungsmitteln<br />
und der schier unerschöpfliche Vorrat von Rohstoffen <strong>für</strong> den materiellen Kulturbesitz [...] gaben den<br />
Nordwestküstenindianern wie keiner anderen indianischen Bevölkerung Nordamerikas die Möglichkeit,<br />
auch komplexe gesellschaftliche Strukturen zu entwickeln, die sich im allgemeinen nur in archaischen<br />
Hochkulturen finden. Mit anderen Worten: einer Gesellschaft mit aneignender Produktionsweise<br />
standen hier Sozialordnungen gegenüber, die sonst nur bei den entwickelteren Gesellschaften mit<br />
produzierender Wirtschaftsform auftreten. Aufgrund des hohen Stellenwerts, den das ständige Streben<br />
nach Anhäufung von Nahrungsmitteln und Gebrauchsgütern, Sklaven und Luxusartikeln einnahm, kann<br />
hier von einer primitiven Form des Kapitalismus gesprochen werden, verbunden mit einer vom<br />
Reichtum bestimmten sozialen Klassenschichtung. Charakteristisch <strong>für</strong> die Nordwestküstengesellschaften<br />
war ferner die Betonung genealogischen Denkens, die zur Entstehung unilinearer<br />
Gruppen führte, die bei der Erlangung von Reichtum und Privilegien miteinander rivalisierten.«<br />
(Lindig/Münzel 1976, Bd.1: 59) Der Rede von "einer primitiven Form des Kapitalismus" ist allerdings<br />
völlig verfehlt, da die "Akkumulation" in diesen Gesellschaften gänzlich anderen Zwecken dient als die<br />
kapitalistische.<br />
145 Man kann den Potlatch tatsächlich <strong>für</strong> eine Art rituellen Kriegsersatz halten: Ziel ist der "Sieg im<br />
Potlatch" (vgl. Ibid.: 98) Die Feste waren teilweise derart exzessiver Natur, daß es Jahre dauerte, bis die<br />
benötigten Güter beisammen waren. Sie wurden den geladenen Gästen dann zeremoniell überreicht,<br />
»oder bei einem Potlatch-"Kampf" zwischen zwei rivalisierenden Häuptlingen zerschlagen, verbrannt,<br />
ins Meer geworfen oder, im Falle von Sklaven, getötet. Der "besiegte" Rivale mußte nun bei passender<br />
Gelegenheit seinerseits einen Potlatch abhalten und seinen früheren Gastgeber an Geschenken oder zerstörten<br />
Gütern zu übertreffen versuchen.« (Lindig/Münzel 1976, Bd.1: 61)
88 Gleiche und Ungleiche<br />
tet einfach "geben", im Sinne von eine Gabe geben. In jeder Eingeborenensprache<br />
gab es spezielle Begriffe, um die <strong>Institut</strong>ion zu kennzeichnen. Der Potlatch war allen<br />
Stämmen an der Nordwestküste mit Ausnahme der südlichsten vertraut, und während<br />
es zahlreiche Abweichungen im Detail gab, waren Basismuster und Funktion<br />
des Potlatch jeweils gleich. (vgl. Drucker 1965: 481)<br />
Bei einem Potlatch wurde anläßlich von Ereignissen mit großer gesellschaftlicher Bedeutung<br />
— der Heirat einer bedeutenden Person, der Geburt des möglichen Erben<br />
eines Titels, der Übertragung dieses Titels auf den Erben, der Befreiung von Kriegsgefangenen<br />
— von einem Häuptling (und der von ihm angeführten Gruppe) als<br />
Gastgeber einer Gruppe von Gästen (einem Häuptling oder Häuptlingen mit ihrem<br />
jeweiligen Gefolge) Wertgegenstände überreicht. Die Veranstaltung war hochgradig<br />
ritualisiert, umrahmt von Tänzen und Liedern; die wertvollsten Gaben (verschiedene<br />
Güter, aber auch Namen und Privilegien) wurden den hochrangigsten und<br />
die weniger wertvollen den niedriger rangierenden Gästen überreicht, woraufhin die<br />
Empfänger mit Dankesreden antworteten. Nach Drucker hatte der Potlatch sowohl<br />
die Funktion, die einzelnen beteiligten Gruppen in Beziehung zueinander zu setzen<br />
(bzw. diese Beziehung zu bekräftigen), als auch den Zusammenhang innerhalb der<br />
Gruppe zu stärken, denn auch wenn der Häuptling das Fest organisierte, galt doch<br />
die ganze als Gruppe Gastgeber, hochgestellte wie rangniedrige Personen. Jedes<br />
Mitglied der jeweiligen Gruppe agierte als deren Teil und gab sich öffentlich als ihr<br />
Angehöriger zu erkennen. 146 Die »gastgebende Gruppe versammelte sich am Strand,<br />
um die Gäste bei ihrer formellen Ankunft zu begrüßen. Alle halfen bei den Vorbereitungen,<br />
einschließlich der Zusammenstellung der Güter <strong>für</strong> die Verteilung. Alle<br />
wurden während der Prozeduren mit ihrer Gruppe identifiziert, wenn nicht als<br />
strahlende Darsteller, so doch als Sprecher, Warenhüter, Aufsichtspersonen, Tänzer<br />
oder Sänger. [...] Die Gäste wurden auf gleiche Weise als Mitglieder ihrer sozialen<br />
Einheit eingeladen und als Gruppe behandelt, auch wenn die Menge an Potlatch-<br />
Gütern, die ein Gemeiner erhielt, nicht erwähnenswert war.« (Ibid.: 485) Dieses<br />
von Philip Drucker gezeichnete unspektakuläre Bild unterscheidet sich sehr von der<br />
dramatischen, agonistischen Szenerie, die zunächst mit dem Begriff Potlatch assoziiert<br />
wird. Die Rivalitäts-Potlatches waren demnach nur der augenfälligste Auswuchs<br />
einer weit weniger spektakulären <strong>Institut</strong>ion; und zudem ein zumindest in der spezifischen<br />
"agonistischen" Ausprägung postkoloniales Phänomen:<br />
»Vor dem Erscheinen der Stapel von Decken und anderen massenhaft produzierten Handelswaren,<br />
wurden einheimische Wertgegenstände verwandt. Diese Dinge waren ... ihrer Natur<br />
nach selten, wie jene Nuggets aus reinem Kupfer, aus denen Kupferplatten hergestellt wurden.<br />
Oder es dauerte lange, sie herzustellen, wie die mit großem Arbeitsaufwand verfertigten Ka-<br />
146 »Entscheidend am Potlatch war die Gastgeber-Gast Beziehung [...] Die Indianer unterschieden<br />
zwischen Anlässen, zu denen nur Nahrung, die sofort gegessen oder von den Gästen mit nach Hause<br />
genommen wurde, dargeboten wurde, und solchen, zu denen andere Formen von Gütern verteilt<br />
wurden. Die ersteren können "Feste", die letzteren Potlatche genannt werden. [...] Ein Potlatch schloß<br />
normalerweise wenigstens einige vorbereitende Feste ein.« (Ibid.)
Gleiche und Ungleiche 89<br />
nus oder Umhänge. Oder es war schwierig, sie zu erbeuten, wie die Felle des scheuen Seeotters<br />
und des Murmeltiers. Folgerichtig benötigte selbst eine bevölkerungsreiche und fleißige<br />
Gruppe Jahre, um genug Wertgegenstände <strong>für</strong> einen Potlatch zusammenzutragen. Gut informierte<br />
Indianer aus Gruppen, die in früheren Zeiten <strong>für</strong> ihre zahlreichen und opulenten Potlatche<br />
berühmt waren, berichteten mir häufig ... daß in Zeiten vor Ankunft der Weißen Feste<br />
häufig stattfanden, aber Potlatche selten waren. Das heißt nicht, daß der Potlatch ein rein historisches<br />
Phänomen ist. Es bedeutet, daß der Überfluß an Handelsgütern zu einem neuen<br />
Überschwang bei der Verteilung bestimmter Artikel im Potlatch führte.« (Ibid.: 486f.)<br />
Der Kontakt mit den Europäern veränderte den Potlatch also nachhaltig. Der Wettstreit,<br />
nunmehr mit Gütern aus industrieller Produktion geführt, nahm teilweise<br />
derart exzessive Formen an, daß die kanadische Regierung ihn verbot. 147<br />
»Die spektakulären Rivalitäts-Potlatche erreichten einen Höhepunkt in den letzten Jahrzehnten<br />
des neunzehnten Jahrhunderts und den ersten Jahren des zwanzigsten. Bei diesen Ereignissen<br />
wurden große Mengen von Wertgegenständen fortgegeben oder zerstört — Kupferplatten<br />
wurden zerbrochen, Kanus zerschlagen, Geld ins Feuer geworfen, und in den Tagen vor dem<br />
Gesetz des weißen Mannes wurden Sklaven getötet — alles, um einen Rivalen zu demütigen.<br />
Die ruhige, extrem höfliche und gelegentlich joviale Atmosphäre des gewöhnlichen Potlatch<br />
war durch ein Klima der Bitternis ersetzt.« (Ibid.: 488)<br />
Der Wettstreit zweier Männer um einen bestimmten Status (einen Titel oder bestimmte<br />
Vorrechte) führte nun zu einer Reihe von Rivalitäts-Potlatches, die solange<br />
fortgeführt wurden, bis einer der Wettbewerber bankrott war und seine Ansprüche<br />
nicht länger aufrechterhalten konnte. — Wenngleich der Potlatch also offensichtlich<br />
pervertiert war, veränderte sich die ihm zugrundeliegende Ethik aber nicht: »Das<br />
Ansehen, das der willentliche Verzicht auf Reichtümer schafft, scheint ihnen [d.h.<br />
den Indianern] auch heute noch wichtiger zu sein als der Nutzen, der sich aus ihrem<br />
unmittelbaren Konsum oder ihrer langfristigen Akkumulation als Kapital ziehen ließe.«<br />
(Kohl 1993: 90) 148<br />
DER WETTSTREIT DER BIGMEN<br />
Großzügigkeit und gesellschaftliches Ansehen bedingen sich häufig wechselseitig. In<br />
Gesellschaften mit institutionalisierten (und erblichen) Rangunterschieden ermöglicht<br />
hoher sozialer Status die Anhäufung und Verteilung von Gütern. In anderen Gesellschaften<br />
hingegen entspringt dieser Status einer derartigen Umverteilung. So<br />
gründet die Stellung des melanesischen Bigman nicht in seiner Abstammung, er<br />
147 »Durch Handelsniederlassungen, Fischkonservenfabriken und Sägewerke war seit Mitte des 19.<br />
Jahrhunderts das Gebiet der Nordwestküste wirtschaftlich erschlossen worden. Die vielfältigen<br />
Möglichkeiten, durch Handel und Lohnarbeiten neue Reichtümer zu erwerben, nutzten die dortigen<br />
einheimischen Bevölkerungsgruppen aber nur zur Ausrichtung immer größerer Potlatchfeste, die<br />
zunehmend zerstörerische Formen annahmen.« (Kohl 1993: 90)<br />
148 <strong>Institut</strong>ionen wie der Potlatch könnten ganz allgemein die Funktion haben, das Entstehen extremer<br />
ökonomischer Ungleichheit zu verhindern, indem sie die Menge der vorhandenen Güter begrenzen:<br />
»Einige Typen von Prestige-Systemen haben den Zweck, sicherzustellen, daß der gesamte Reichtum<br />
innerhalb einer Gemeinschaft ein bestimmtes Niveau nicht übersteigt.« (Bariç 1964: 37)
90 Gleiche und Ungleiche<br />
nimmt keine ihm vorbestimmte Position der Führerschaft in einer definierten Gruppe<br />
ein, »das Erreichen des Status eines Bigman ist vielmehr das Resultat einer Reihe<br />
von Handlungen, welche eine Person aus der Masse herausheben und ihn mit einer<br />
Gruppe von loyalen, ihm untergeordneten Personen umgeben.« (Sahlins 1963: 289)<br />
Der Bigman, der "große Mann", wird in den verschiedenen melanesischen Ethnien<br />
auch als "wichtiger Mann", "Mann von Ansehen", "großzügiger reicher Mann" oder<br />
"center-man" bezeichnet, wobei der letzte Begriff auf seine zentrale Rolle im redistributiven<br />
Prozeß anspielt und gleichzeitig die Sozialstruktur der fraglichen Gesellschaften<br />
widerspiegelt: die Gemeinwesen setzen sich aus Gruppen zusammen, welche<br />
die segmentären Strukturen überlagern und deren Interessen vom Bigman, als<br />
"man of renown" d.h. "Mann von Ansehen", nach außen hin vertreten werden.<br />
Da der Rang eines Bigman ihm nicht qua Geburt zufällt, hängt sein Einfluß<br />
ganz und gar von der Zahl seiner Gefolgsleute ab. Um nach außen hin als Mann von<br />
Reichtum und Einfluß agieren zu können, ist es notwendig, Beziehungen der Loyalität<br />
und Verpflichtung zu einer Anzahl von Personen zu schaffen, die den Bigman mit<br />
jenem Reichtum versorgen, dessen er bedarf, um seine Rolle ausfüllen zu können.<br />
»Jeder ambitionierte Mann, dem es gelingt eine Gefolgschaft um sich scharen, kann<br />
eine gesellschaftliche Karriere starten. Der aufstrebende Bigman hängt zunächst<br />
notwendig von einem kleinen Kern von Gefolgsleuten ab, der in erster Linie aus seinem<br />
eigenen Haushalt und seinen engsten Verwandten besteht.« (Ibid.: 291) Auf<br />
diese Personen kann er sich ökonomisch stützen, von ihnen kann er auch Güter und<br />
Dienstleistungen einfordern. Zudem ist es nützlich, wenn ein ambitionierter Mann<br />
seinen Haushalt um "heimatlose" Personen erweitert, Witwen oder Waisen etwa.<br />
»Zusätzliche Ehefrauen sind besonders nützlich. Je mehr Frauen ein Mann hat, um so<br />
mehr Schweine hat er.« (Ibid.) 149 Zudem verschafft jede neue Eheschließung ihm zusätzliche<br />
Schwiegerverwandte, von denen er ökonomisch profitieren kann. Diese<br />
Bewegung kulminiert schließlich darin, daß der aufstrebende Mann andere, nicht näher<br />
mit ihm verwandte Männer und deren Familien an sich zu binden vermag und<br />
deren Erzeugnisse zur Verfolgung seiner Pläne nutzbar macht. Das geschieht mittels<br />
kalkulierter Großzügigkeit: diese Personen stehen dem Bigman gegenüber in einem<br />
Schuldverhältnis, nachdem er ihnen auf die eine oder andere Art geholfen hat.<br />
Zwischen dem "center-man" und seinen Anhängern besteht eine komplementäre<br />
Beziehung, jeder hofft, vom anderen (auf Kosten Dritter) zu profitieren.<br />
Nicht nur das Ansehen des Anführers, sondern auch dasjenige der durch ihn repräsentierten<br />
Gruppe hängt von seinem "Erfolg" bei öffentlichen Güterverteilungen ab.<br />
Und wenn die Verpflichtungen, die der "center-man" in diesem Rahmen eingeht,<br />
ihn häufig nötigen, Druck auf seine Gefolgschaft auszuüben, Gegenleistungen herauszuzögern,<br />
und empfangene Güter wieder nach außen zurück zu lenken, so nehmen<br />
die Gefolgsleute dies hin, weil der Erfolg des Bigman auch ihr Erfolg ist. Zwar<br />
sind die Dinge, die durch seine Hände gingen, um nach "außen" zu wandern, prinzi-<br />
149 »Die Beziehung ist eine der Funktion, nicht der Identität: wenn mehr Frauen die Gärten bestellen,<br />
ist mehr Futter <strong>für</strong> Schweine vorhanden und damit auch mehr Schweineherden.« (Ibid.)
Gleiche und Ungleiche 91<br />
piell mit anderen, zurückfließenden Gütern zu vergelten (die Norm der Reziprozität<br />
gilt auch zwischen Bigman und Gefolgsleuten), aber manchmal muß der Bigman seine<br />
Anhänger überreden (oder bedrängen), als Gegenleistung <strong>für</strong> ihre Anstrengungen<br />
"das Ansehen ihres Anführers zu essen", wie die Siaui sagen (vgl. Ibid.: 293). Da dieses<br />
Geflecht auf Beziehungen persönlicher Loyalität und wechselseitiger Verpflichtung<br />
ruht, 150 ist es Sahlins zufolge allerdings relativ instabil: dem Aufstieg des Bigman<br />
kann ebenso schnell der Abstieg folgen — dann nämlich, wenn er nicht in der<br />
Lage sein sollte, die Verpflichtungen zu erfüllen, welche er seiner Gefolgschaft und<br />
anderen Bigmen gegenüber einging; er kann dabei sein Ansehen oder seine Anhänger<br />
verlieren, wobei das eine das andere notwendig nach sich zieht.<br />
Auch wenn häufig davon gesprochen wird, daß diese "Merit-Ökonomien" in der<br />
Möglichkeit gründen, Reichtümer zu "akkumulieren", ist dieser Begriff zumindest<br />
irreführend, da die Anhäufung von Gütern allein dazu dient, diese freigiebigst im<br />
Rahmen einer "unproduktiven Verausgabung" (K. H. Kohl) zu verteilen. Diese<br />
"primitive Akkumulation" setzt keinen dynamischen Prozeß in Gang, schlußendlich<br />
ist der Wettstreit um Prestige ein ökonomisches Nullsummenspiel. 151 Prestige-<br />
Ökonomien sind keine kapitalistischen, der Bigman eignet sich nicht das Mehrprodukt<br />
seiner Gefolgsleute an, um es produktiv zu investieren. Die Güter, die ihm<br />
zufließen, sind lediglich Mittel, um über ihre "großzügige" Verausgabung Ansehen<br />
zu erlangen. Die gesellschaftliche Stellung eines Bigman hängt zwar von seinem Einfluß,<br />
d.h. der Größe seiner "Gefolgschaft" ab, sein Ansehen erlangt er aber im wettstreitenden<br />
Tausch. Bei den auf Bougainville lebenden Siaui kann z.B. ein Mann einem<br />
anderen materielle Güter geben, in der Hoffnung und Erwartung, daß der<br />
Empfänger unfähig sein wird, die Gabe angemessen zu erwidern. Das Ansehen, welches<br />
in einem solchen Akt erlangt wird, entspricht Douglas Oliver zufolge dem<br />
Wert der unerwiderten Gabe, während derjenige, der die Erwiderung nicht leisten<br />
150 In dieser Hinsicht ist es dem Patronage/Klientel-Verhältnis verwandt.<br />
151 Darüber sollte auch Bourdieus Feststellung nicht hinwegtäuschen, wonach in diesen Gesellschaften<br />
im Akt des Gebens ökonomisches in symbolisches "Kapital" verwandelt wird. Für viele nichtkapitalistische<br />
Gesellschaften gilt demnach: »Ökonomisches Kapital kann nur in Form symbolischen<br />
Kapitals akkumuliert werden [...] Das symbolische Kapital, gewöhnlich Prestige oder Autorität, stellt<br />
nur die umgewandelte, d.h. unkenntlich gemachte und damit offiziell anerkennbare Form der anderen<br />
Kapitalarten dar. Reichtum bleibt die Grundlage von Macht, kann jedoch nur unter symbolischen<br />
Formen des Kapitals seine Wirkung zeitigen. Der Chief gibt, wie Malinowski erläutert, sehr richtig<br />
einen "tribal banker" ab, der Nahrungsmittel nur anhäuft, um sie zu verausgaben und auf diese Weise ein<br />
Kapital an Verpflichtung und Schuld zu akkumulieren, die ihm in Gestalt von Ehrenbezeugungen, von<br />
Respekt und Treue, gegebenenfalls in Form von Arbeit und Dienstleistungen, den virtuellen Grundlagen<br />
einer neuen Akkumulation materieller Güter, abgegolten werden.« (1972: 375) Das hat bei den von<br />
Bourdieu untersuchten Kabylen durchaus eine praktischen Aspekt: »Die Strategie, die darin besteht, das<br />
Kapital an Ehre und Prestige zu akkumulieren, das ebenso die Klientel hervorbringt, wie es deren<br />
Produkt ist, gibt die optimale Lösung <strong>für</strong> jenes Problem an die Hand, das sich der Gruppe stellen würde,<br />
wenn sie kontinuierlich ... die gesamte menschliche wie tierische Arbeitskraft, derer sie während der<br />
Arbeitszeit bedarf, auch unterhalten müßte: Sie gestattet faktisch den großen Familien, während der<br />
Arbeitsperiode in ausreichendem Maß über Arbeitskräfte zu verfügen und zugleich während der<br />
unelastischen Produktionszeit die Konsumption auf ein Minimum zu reduzieren.« (Ibid.: 348)
92 Gleiche und Ungleiche<br />
konnte, entsprechend an öffentlichem Ansehen verliert (Oliver 1955: 388f.). Der<br />
"siegreiche" Geber beklagt sich nicht über die ausgebliebene Erwiderung, er macht<br />
auch keinen Versuch, sie zu erzwingen, er rühmt sich statt dessen seines Sieges in<br />
diesem Wettstreit, oder er gibt seinen "Gefolgsleuten" einen Wink, die dann an seiner<br />
Stelle damit prahlen — die geschicktesten und subtilsten Anführer verfahren so<br />
(Ibid.: 389). 152<br />
Eine andere Möglichkeit, seinen Ruhm zu mehren, ist <strong>für</strong> einen ambitionierten<br />
Siaui die Ausrichtung eines Muminai genannten "Verdienstfestes". Bei diesen<br />
Festen treten sich zwei Parteien gegenüber, diejenige des Gastgebers und diejenige<br />
des "Ehrengastes". 153 Während des Festes wird dem Ehrengast eine große Gabe<br />
überreicht, die hauptsächlich aus Schweinen und Muscheln besteht, und die er innerhalb<br />
eines gewissen Zeitraums ebenfalls im Rahmen eines Festes mindestens in<br />
gleichwertiger Form erwidern muß, will er nicht an Ansehen verlieren und in der<br />
Folge einen niedrigeren Rang als der ursprüngliche Gastgeber einnehmen. Entspricht<br />
die Erwiderung genau der Ausgangsgabe, findet kein weiterer Wettstreit zwischen<br />
den Rivalen statt, und zwischen ihnen besteht fortan eine Taovu genannte Beziehung,<br />
die in ihren Grundzügen in etwa einer Handelspartnerschaft entspricht. Übertrifft<br />
die Gegengabe hingegen die ursprüngliche, muß wiederum von dem ersten<br />
Gastgeber ein Fest ausgerichtet werden, um die Disparität zumindest auszugleichen<br />
oder den Kontrahenten zu übertreffen. Dieser Tausch kann zwischen zwei rivalisierenden<br />
Männern mehrmals hin und her gehen, bis einer der Rivalen den Wettstreit<br />
mangels Ressourcen aufgeben muß. (Ibid.: 390ff.) 154<br />
Nach diesem oder einem ähnlichen Muster laufen derartige Verdienstfeste (zum Teil<br />
regelrechte Verdienstfestzyklen) in einer großen Zahl von Gesellschaften Neuguineas<br />
und Melanesiens ab. 155 Somit ist im Prestigewettstreit der Bigmen die diesen regulierende<br />
Reziprozitätsnorm geradezu Quelle sozialer Ungleichheit, denn sein Ziel<br />
ist, den Kontrahenten in eine Position zu bringen, in der dieser nicht mehr zur reziproken<br />
Erwiderung imstande ist, was ihn als "Ungleichen", als Mann von geringerem<br />
Ansehen disqualifiziert.<br />
152 Die Demütigung eines anderen mit Gaben, die dieser nicht erwidern kann, erhöht das Ansehen des<br />
Gebers aber nur, wenn der Empfänger mindestens den gleichen Rang innehat; andernfalls macht er sich<br />
lächerlich (Ibid.: 390).<br />
153 Zusätzlich zu derjenigen seiner engeren "Gefolgschaft" sichert sich der Gastgeber zumeist die<br />
Unterstützung eines befreundeten Anführers, der als "Entlohnung" <strong>für</strong> die Dienste, die seine Männer auf<br />
dem Fest leisten, eine Anzahl von Schweinen erhält, die er unter seinen Leuten verteilt.<br />
154 Olivers Monographie ist eine herausragende Studie des Prinzips der "Führerschaft" in der fraglichen<br />
Region. Das Streben nach einem hohen Rang ist bei den Siaui (in Abwesenheit eines institutionalisiertes<br />
Häuptlingstum) demnach so mächtig und weitverbreitet, daß viele Männer ihr ganzes Leben diesem Ziel<br />
widmen (Ibid.: 83)<br />
155 Eine knappe Übersicht liefert auch Görlich (1992: 255-262). Vgl. zudem insbes. Andrew Stratherns<br />
Beschreibung der Moka-Tauschzyklen bei den Melpa im Hochland Neuguineas (1971).
Gleiche und Ungleiche 93<br />
FEINDSCHAFT UND EHRE<br />
Anstatt Schweine zu geben, kann man den Nachbarn auch Köpfe nehmen; in gewissem<br />
Sinne vergesellschaftet auch das. Man denke nur an die Doppeldeutigkeit der<br />
Begriffe "sich revanchieren" und "Vergeltung". Die Vendetta, die Blutrache ist dergestalt<br />
tatsächlich eine Form reziproken Tauschs, genauso wie das talionische Gesetz,<br />
das auf dem Prinzip der unbedingten Vergeltung beruht: "Auge um Auge, Zahn um<br />
Zahn". Man kann sich der Blutrache, als einer Art "negativen" Tauschs, ebensowenig<br />
entziehen wie den Gesetzen des "positiven" Tauschs. Bei größerer sozialer Distanz<br />
kann sich dergestalt die Norm der reziproken Vergeltung in der merkwürdigen <strong>Institut</strong>ion<br />
des "primitiven" Kriegs manifestieren. 156 Dieser ist, wie auch zumeist die<br />
"Kopfjagd", ebenso reguliert wie der Gabentausch: »Im Gegensatz zur evolutionistischen<br />
Annahme des regellosen Urkriegs entdeckte man auch unter Erbfeinden<br />
Kriegsbräuche, die vom Verbot bestimmter Waffen (z.B. Giftpfeile) über regulierte<br />
Duelle bis zur Schonung von Nichtkombattanten reichen. Das Bild wogender<br />
Schlachten, an deren Rande die Frauen beider Lager Kleinhandel treiben, hat die an<br />
den europäischen Volkskrieg gewöhnten Reisenden immer wieder erstaunt.« (Streck<br />
1987: 118) 157<br />
Auch Blutfehden und Kopfjagden sind Formen der Vergesellschaftung, negativer<br />
Vergesellschaftung allerdings, so wie das soziale Band in diesem Fall ein negatives<br />
ist. Es handelt sich dennoch um einen Tausch von Gleichem gegen Gleiches unter<br />
Gleichen: »Formal gesprochen unterscheiden sich Gesellschaften, die sich in Festessen<br />
messen nur wenig von denen, die sich in Fehden messen, die einen tauschen<br />
Schweine aus, die anderen Tode. Tatsächlich werden beide häufig als alternative<br />
Formen der Interaktion von Gruppen innerhalb ein und derselben Gesellschaft angesehen.<br />
So lange sich symmetrische Gruppen im Ungleichgewicht befinden muß die<br />
156 »Die Reziprozitätsnorm kann ..., sofern sie sich auf Vergeltung bezieht — "wer schädigt, soll<br />
geschädigt werden" —, ein Individuum dazu bringen, andere, die es geschädigt haben, zu schädigen und<br />
daraus eine moralische Berechtigung <strong>für</strong> aggressives Verhalten herzuleiten, also der Entwicklung eines<br />
Teufelskreises von sich ausbreitenden Konflikten und zunehmender Spannung Vorschub leisten.«<br />
(Gouldner 1973: 151f.)<br />
157 Zwar mag »die Bereitschaft, im jeweils Fremden auch den Feind zu sehen, ... im Wesen des Gruppengefühls<br />
begründet sein; andererseits besitzt der Krieg alle Eigenschaften einer Kultureinrichtung:<br />
bestimmte Symbole eröffnen ihn, er läuft nach gewissen Regeln ab und findet seinen rituellen<br />
Abschluß.« (Ibid.: 117) Streck führt folgende Merkmale des "primitiven Kriegs" an: »(1) Krieg ist Eroberung<br />
der natürlichen wie der sozialen Umwelt; darin zeigt sich seine Verwandtschaft zur Jagd und<br />
seine Beheimatung in der Männerkultur. Ob die Beute aus Wild, Frauen, Gefangenen oder Vieh besteht,<br />
oft gleichen sich Waffen und Kampforganisation. (2) Krieg ist ausgleichende Vergeltung und wird<br />
ausgefochten von gleichwertigen Kontrahenten. Der Gegner muß in Bewaffnung und Anzahl annähernd<br />
gleich sein; nur so gelten die Regeln der Ehre und ihrer Wiederherstellung ... Die Rache kann<br />
aufgeschoben werden, über Generationen, so daß Erbfeindschaften entstehen. Selbst wenn man<br />
Gefangene als Mitglieder aufnimmt, regiert noch das Reziprozitätsdenken, das Ausgleich <strong>für</strong> die<br />
Gefallenen fordert. (3) Krieg ist Prestigesache und dient der Erziehung zur Mannbarkeit. Nur der<br />
Besitzer von Kriegstrophäen — ob Kopf, Skalp, Penis, Nase oder Ohr — darf heiraten. Damit wird der<br />
"Kraftüberschuß" der Jugend kanalisiert, diszipliniert und nach außen geleitet. [...] (4) Krieg ist ein Fest,<br />
ein heiliges Spiel, das sich um Tod und Leben dreht. Er steigert das Gruppengefühl und schafft<br />
Gemeinschaft (Turners communitas)« (Ibid.:118)
94 Gleiche und Ungleiche<br />
Beziehung andauern.« (Gibson 1988: 167) So erscheinen denn auch die "Verdienstfeste"<br />
der Siaui mit ihren kriegerischen Zurschaustellungen wie eine mittels Schweinen<br />
ausgetragene Kampfhandlung (vgl. Oliver 1955, 390ff.). 158 Wo die Regeln der<br />
wechselseitigen rituellen "Vergeltung" gelten, d.h. die Reziprozitätsnorm in Kraft<br />
ist, rotten sich die Kontrahenten also nicht aus. Die Grenzen derartiger regulierter<br />
Formen von Konfrontation sind allerdings fließend und werden markiert von Frauen–<br />
und Sklavenraub, der Annexion von Land und damit verbundenen Vertreibungen,<br />
schließlich der Unterwerfungen von Völkern, zu denen keine reziproke<br />
Beziehung besteht, die als Feinde nicht geachtet werden.<br />
Auf Gegenseitigkeit gründende Normen und Verhaltensweisen kann es nur<br />
unter Gleichen geben; unter Ungleichen ist man weder zur Erwiderung einer Gabe<br />
(oder zur Annahme einer Herausforderung), noch zur Hilfeleistung und auch nicht<br />
zur Einhaltung bestimmter Regeln verpflichtet. Ein Tausch von Gleichem gegen<br />
Gleiches, ob er sich nun in Yamsknollen, Schweinen oder Köpfen manifestiert, ist<br />
zwischen Ungleichen nicht möglich, da dieser Tausch ein Verhältnis der Gleichheit<br />
impliziert und signifiziert. In dieser Beziehung stehen aber, wie bereits erwähnt,<br />
niemals alle Mitglieder einer Gesellschaft zueinander. "Gleichheit" ist stets eine begrenzte<br />
und relative Kategorie. Der Prestigewettstreit kann deshalb nur zwischen<br />
Personen ausgetragen werden, die gleiche Ansprüche erheben oder von gleichem<br />
Rang sind. Die Herausforderung einer Person, die nicht von vornherein signalisiert,<br />
daß sie sich dieser stellen will, oder von der "man" weiß, daß sie sich ihr nicht stellen<br />
kann, erniedrigt den Herausforderer. Das gilt <strong>für</strong> die Siaui ebenso wie <strong>für</strong> die von<br />
Pierre Bourdieu untersuchten Kabylen:<br />
»Damit es zu einer Herausforderung kommt, muß der, der sie ausspricht, seinen Gegner <strong>für</strong><br />
würdig erachten, sich herausfordern zu lassen, d.h. fähig zu sein, die Herausforderung anzunehmen.<br />
Jemanden herausfordern heißt, ihm seine Eigenschaft als Mann zuerkennen, und darin<br />
besteht die Vorbedingung eines jeden Austauschs und der Ehrenherausforderung, insofern<br />
sie das erste Moment eines Austauschs darstellt; das heißt weiterhin, ihm die Würde des Ehrenmannes<br />
zuerkennen, da ja die Herausforderung ihrer Natur nach eine Erwiderung fordert<br />
und sich also an einen Mann wendet, der das Spiel der Ehre zu spielen und gut zu spielen weiß.<br />
[...] Wer einen Mann herausfordert, der unfähig ist, die Herausforderung anzunehmen, d.h.<br />
den begonnenen Austausch fortzusetzen, der entehrt sich selbst. [...] Eine Herausforderung<br />
(oder eine Beleidigung) verdient nur dann, angenommen zu werden, wenn sie von einem an<br />
Ehre ebenbürtigen Mann ausgesprochen wird — anders gesagt: damit es zu einer Herausforderung<br />
kommt, muß der, gegen den sie sich richtet, seinen Gegner <strong>für</strong> würdig erachten, ihn<br />
herauszufordern.« (Bourdieu 1972: 15ff.) 159<br />
"Primitive" Gesellschaften unterscheiden sich diesbezüglich <strong>für</strong> Sahlins von unserer<br />
eigenen ganz allgemein auch durch eine ausgeprägte Tendenz, Moralität, wie Reziprozität,<br />
abgestuft zu organisieren. »Normen sind charakteristischerweise eher rela-<br />
158 Schon die Einladung wird bei den Siaui als "Überraschungsangriff" bezeichnet.<br />
159 »Das Gefühl der Ebenbürtigkeit in der Ehre, das durchaus mit faktischen Ungleichheiten koexistieren<br />
kann, liegt einer großen Anzahl von Verhaltensweisen und Bräuchen zugrunde und manifestiert sich<br />
besonders darin, daß man jedem Angebertum großen Widerstand entgegensetzt.« (Ibid.)
Gleiche und Ungleiche 95<br />
tiv und situationsabhängig denn absolut und universell. Eine gegebene Handlung ...<br />
ist nicht so sehr aus sich heraus gut oder schlecht, es hängt davon ab, wer der andere<br />
ist.« (Sahlins 1972: 199) 160<br />
Die Siaui machen diesbezüglich geltend, »daß Nachbarn freundlich und vertrauensvoll<br />
miteinander umgehen sollen, während Menschen von weit entfernt gefährlich<br />
und der moralischen Gleichbehandlung nicht wert sind. Die Eingeborenen<br />
legen zum Beispiel großen Wert auf Ehrlichkeit bei Transaktionen mit Nachbarn,<br />
während beim Tausch mit Fremden Lug und Trug im Spiel sein kann.« (Oliver<br />
1955: 82) 161 . Und auch das "Ethos der Ehre" der Kabylen<br />
»widersetzt sich schon seinem Prinzip nach einer universalen und formalen Moral, die allen<br />
Menschen ein gleiches Maß an Würde und demzufolge die gleichen Rechte und Pflichten zuspricht.<br />
So sind die <strong>für</strong> Männer verbindlichen Regeln anders als die, die <strong>für</strong> Frauen gelten, und<br />
die Pflichten den Männern gegenüber unterscheiden sich von den Pflichten, die man den Frauen<br />
gegenüber hat; vor allem aber könne die Gebote der Ehre, die jedesmal direkt auf den Einzelfall<br />
angewendet werden und je nach der Situation verschieden sind, in gar keinem Fall universale<br />
Gültigkeit erhalten. Ein und derselbe Ehrenkodex diktiert Verhaltensformen, die je<br />
nach dem gesellschaftlichen Feld völlig entgegengesetzt sein können: einerseits die Regeln, die<br />
den Beziehungen zwischen Verwandten zugrunde liegen und, im weiteren Sinne, allen gesellschaftlichen<br />
Beziehungen, die sich nach dem Modell der Verwandtschaftsbeziehungen richten<br />
("Hilf den Deinen, egal, ob sie recht oder unrecht haben"), andererseits die Regeln, die <strong>für</strong> die<br />
Beziehungen mit Fremden gelten. Diese Dualität in den Einstellungen ergibt sich … aus dem<br />
... fundamentalen Prinzip, das den Einzelnen zu einem von der Ehre diktierten Verhalten nur<br />
denjenigen gegenüber verpflichtet, die dessen würdig sind.« (Bourdieu 1972: 44f.)<br />
HIERARCHIE UND UMVERTEILUNG<br />
Im Unterschied zum reziproken Gabentausch, dessen Ergebnis soziale Ungleichheit<br />
in Gestalt von Rangunterschieden sein kann, korrespondiert der redistributive<br />
Tausch notwendig mit Strukturen sozialer Ungleichheit. Thomas Gibson definiert<br />
Redistribution als »Asymmetrie zwischen Geber und Empfänger, die ein organisches<br />
160 »Die Aneignung der Güter oder der Frau eines anderen Mannes, die ein schweres Vergehen im<br />
Schoße des eigenen Gemeinwesens ist, kann nicht allein geduldet sein sondern sogar von den eigenen<br />
Gefährten belohnt werden — wenn sie einen Außenseiter betrifft.« (Ibid.) Sahlins warnt aber davor, den<br />
Kontrast zur jüdisch-christlichen Tradition zu scharf zu betonen, denn keine moralische Norm ist<br />
absolut, und vielleicht keine völlig relativ und kontextgebunden.<br />
161 Das Prinzip der abgestuften Moralität gilt auch z.B. bei den Navaho. »Die Moral der Navaho ist eher<br />
kontextabhängig als absolut. Zu lügen ist nicht immer und überall falsch. Die Regeln variieren mit der<br />
Situation. Betrug beim Handel mit fremden Stämmen ist eine moralisch akzeptierte Praktik. Handlungen<br />
sind nicht aus sich heraus gut oder schlecht. Inzest [seiner Natur nach ein kontextabhängiges Vergehen]<br />
ist vielleicht die einzige Handlung, die unterschiedslos verurteilt wird. Es ist durchaus angemessen, beim<br />
Handel mit fremden Stämmen Hexerei zu gebrauchen... Abstrakte Ideale fehlen fast völlig. Unter den<br />
Bedingungen ihres ursprünglichen Lebens brauchten die Navaho sich nicht an Regeln abstrakter<br />
Moralität zu orientieren... In einer großen, komplexen Gesellschaft wie dem modernen Amerika, wo<br />
Geschäfte ... von Menschen abgewickelt werden, die einander nie zu Gesicht bekommen, ist es<br />
funktional notwendig, über abstrakte Standards zu verfügen, die über die unmittelbar konkrete Situation<br />
hinausreichen, in der zwei oder mehr Personen interagieren.« (Clyde Kluckhohn nach Sahlins 1972:<br />
200)
96 Gleiche und Ungleiche<br />
Ganzes mit hierarchischen Teilen schafft« (1988: 176). Ein derartiges Muster liegt<br />
bereits den gerade dargestellten Bigmen-Ökonomien (und auch dem Potlatch) zugrunde;<br />
erst die zentrale Stellung als Umverteilungsinstanz im Netzwerk ihrer Anhänger<br />
bzw. Gefolgsleute ermöglicht den Bigmen miteinander zu konkurrieren. Politische<br />
Macht verbindet sich dergestalt mit ökonomischer Macht. 162 Der Unterschied<br />
zum Gabentausch ist aber nur ein gradueller und kein absoluter, die Beziehung<br />
des Bigman zu jedem Angehörigen seiner Anhängerschaft (zumindest den<br />
männlichen) ist rein formal eine reziproke, er muß die empfangenen Güter vergelten;<br />
tut er dies nicht, wird ihm die Gefolgschaft aufgekündigt. Das redistributive<br />
Muster resultiert in diesem Fall aus einer Vielzahl reziproker Einzelbeziehungen.<br />
Auch beim "Teilen" (Sharing) und "Zusammenlegen" (Pooling) verschwimmen<br />
die Grenzen zwischen reziprokem und redistributivem Tausch. Im ersten Fall<br />
geben, wie bereits dargestellt, der Jäger oder seine Frau das erlegte Wild, den Ertrag<br />
der Sammeltätigkeit oder die zubereitete Nahrung an alle anderen Familien im Lager<br />
und erhalten im Gegenzug von diesen Nahrung. Im zweiten Fall wird die Beute zusammengelegt<br />
und anschließend verteilt. 163 Das Ergebnis ist in beiden Fällen das<br />
gleiche, dennoch bestehen fundamentale Unterschiede: »Pooling ist das Komplement<br />
sozialer Einheit und, in Polanyis Begriff, "Zentrizität"; wohingegen Reziprozität<br />
mit sozialer Dualität und "Symmetrie" einhergeht. Pooling bedingt ein soziales<br />
Zentrum, wo die Güter sich treffen und anschließend nach außen strömen.«<br />
(Sahlins 1972: 188f.) So besteht beim im 1. Kapitel beschriebenen Verteilungsmodus<br />
der Batek eine jeweils reziproke Beziehung zwischen den einzelnen Familien. »Die<br />
Batek selbst erklären, daß sie am einen Tag jemand anderem Nahrung geben, aber<br />
am anderen Tag von derselben Person welche erhalten, und daß sich dies auf lange<br />
Sicht ausgleicht.« (Endicott 1988: 118) Jede Familie ist prinzipiell "politisch" und<br />
"ökonomisch" unabhängig, die Zusammensetzung der Gruppen fluktuiert. 164 Bei<br />
den von Thomas Gibson untersuchten Buid ist es hingegen die "Gruppe", welche<br />
quasi als Redistributionsinstanz fungiert. Hier gilt die Regel, »daß eine Untereinheit<br />
im Austausch nur zu einer größeren Einheit in Beziehung tritt, die sie einschließt.<br />
Das heißt, jede Einheit ist nur verpflichtet dem Ganzen zu geben, von dem sie ein<br />
Teil ist, und hat Ansprüche nur an dieses Ganze.« (1988: 175) Geber und Empfänger<br />
stehen somit in keiner direkten wechselseitigen Tauschbeziehung, Rechte und Pflich-<br />
162 Der angehäufte Reichtum ermöglicht der Zentralinstanz Gemeinschaftsaufgaben zu organisieren. Das<br />
beginnt beim Kanubau der Trobriander, wo der Häuptling den Kanubauer "entlohnt" und führt über die<br />
Anlage komplexer Bewässerungssysteme, Getreidespeicher, Tempelanlagen oder Stadtmauern in den<br />
frühen Königreichen hin zum modernen Staat. Auch die von diesem wahrgenommenen hoheitlichen<br />
Aufgaben — von der Sozialhilfe bis zum Straßenbau — beruhen auf einer redistributiven Struktur.<br />
163 »Die gewöhnliche, alltägliche Variante der Redistribution ist das Zusammenlegen der Nahrung<br />
innerhalb der Familie. Das gemahnt an das Prinzip, daß die Früchte kollektiver Anstrengungen bei der<br />
Nahrungsmittelversorgung geteilt werden.« (Sahlins 1972: 189) Ganz allgemein gilt nach Sahlins in allen<br />
Kulturen das Prinzip, daß kollektiv erzeugte Güter an das Kollektiv verteilt werden.<br />
164 In der Tat scheinen sich Jäger/Sammler-Horden durch ein ständiges Kommen und Gehen<br />
auszuzeichnen. So läßt sich z.B. bei den Ituri-Wald-Pygmäen »ein beständiges Zu– und Abwandern von<br />
Individuen beobachten« (Douglas 1973: 29f.)
Gleiche und Ungleiche 97<br />
ten werden bei den Buid ganz allgemein nur in bezug auf die Gruppe als soziales<br />
Ganzes formuliert und bestehen nicht zwischen den einzelnen Individuen oder Familien.<br />
165<br />
Von hier aus scheint es nur ein kleiner Schritt zum Häuptling oder Ältesten zu<br />
sein, welcher die Verteilung organisiert. Es bedarf lediglich einer die Gruppe repräsentierenden<br />
Person, um einen Übergang zu vollziehen, der nach Durkheim nicht so<br />
tiefgreifend ist, »wie es den Anschein hat. Die Individuen ordnen sich nicht der<br />
Gruppe unter, sondern sie unterwerfen sich demjenigen, der sie repräsentiert.«<br />
(1902: 251) Dennoch macht es im Zweifelsfall einen gewaltigen Unterschied, ob eine<br />
gesellschaftliche Instanz die Verteilung ausführt oder nicht, und nur im zweiten<br />
Fall ist es angemessen, von hierarchischer Solidarität und Redistribution zu sprechen.<br />
Der Häuptling — <strong>für</strong> Durkheim historisch die erste individuelle Persönlichkeit, die<br />
sich aus der Masse herauslöst — ist zumeist nicht allein "Anführer", sondern hat<br />
auch eine ökonomische Funktion, die über die Koordination der Aktivitäten der<br />
Gruppe hinausgeht. Die wesentliche Eigenschaft, die diesbezüglich von einem indianischen<br />
Häuptling erwartet wird, ist Großzügigkeit: »Wenn ein Individuum, eine<br />
Familie oder die ganze Gruppe einen Wunsch oder ein Bedürfnis empfindet, wenden<br />
sie sich an den Häuptling, der ihn befriedigen soll.« (Lévi-Strauss 1955: 307) 166 Die<br />
materielle Basis dieser Großzügigkeit ist das dem Häuptling zugestandene Privileg<br />
der Polygamie. Die Gruppe stellt ihm mit den Frauen auch deren Arbeitsprodukte<br />
zur Verfügung und erwartet im Gegenzug die Verteilung dieser Güter durch den<br />
Häuptling. Dies ist zunächst ein quasi-kontraktuelles Konstrukt, wie Lévi-Strauss<br />
durchaus zu recht feststellt. »An der Basis selbst der primitivsten Formen der Macht<br />
haben wir ... einen entscheidenden Schritt festgestellt, der in bezug auf die biologischen<br />
Gegebenheiten eine neues Element einführt: dieser Schritt besteht in der Zustimmung,<br />
im Konsensus. Die Zustimmung ist sowohl der Ursprung wie die Grenze<br />
der Macht.« (Ibid.: 311) Eine zwischen den Männern mittels der Frauen getroffene<br />
Einigung also. Lévi-Strauss fährt fort: »Die Zustimmung, der Konsensus ist zwar<br />
psychologische Grundlage der Macht, drückt sich jedoch im täglichen Leben in einem<br />
Spiel von Leistungen und Gegenleistungen zwischen dem Häuptling und seinen<br />
Gefährten aus, einem Spiel, das den Begriff der Gegenseitigkeit zu einem weiteren<br />
165 »Die Buid vermeiden durchgängig jede soziale Interaktion zwischen symmetrischen Einheiten gerade<br />
wegen des Potentials an Wettstreit und Konfrontation, das diese beinhaltet.« (Ibid.: 172f.) Dieses<br />
Prinzip durchzieht nach Gibson ihr gesamtes soziales Leben. Reziproke Beziehungen sind ihnen somit<br />
fremd, gleiches behauptet Gibson <strong>für</strong> redistributive, da es bei den Buid keine personifizierten Zentralinstanzen<br />
gibt, welche die Verteilung vornehmen könnte. Aus wohl diesem Grund spricht Gibson auch<br />
durchgängig von "sharing", wiewohl die von ihm beschriebene Prozedur m.E. als "pooling" bezeichnet<br />
werden muß.<br />
166 Sahlins bemerkt hierzu: »In der primitiven Gesellschaft ist soziale Ungleichheit eher die<br />
Organisation ökonomischer Gleichheit. Tatsächlich ist ein hoher Rang häufig abgesichert oder aufrechterhalten<br />
durch überquellende Großzügigkeit: der materielle Vorteil ist auf der Seite des<br />
Untergeordneten. Es geht vielleicht zu weit, in der Eltern-Kind-Beziehung die elementare Form der<br />
verwandtschaftlichen Rangordnung und seiner ökonomischen Ethik zu sehen. Nichtsdestotrotz ist es<br />
wahr, daß Väterlichkeit eine geläufige Metapher des primitiven Häuptlingstums ist.« (1972: 205)
98 Gleiche und Ungleiche<br />
grundlegenden Attribut der Macht erhebt.« (Ibid.) 167 Zwischen dem Häuptling und<br />
der Gruppe besteht »ein sich ständig erneuerndes Gleichgewicht zwischen Leistungen<br />
und Privilegien, Diensten und Pflichten.« (Ibid.) Das redistributive Muster ist<br />
hier demnach lediglich die Summe der reziproken Einzelbeziehungen. 168<br />
Mit der "Vielweiberei" des Häuptlings wird schließlich auch der Modus der<br />
Vergesellschaftung variiert, zu den Bindungen, die durch die Heiraten zwischen den<br />
einzelnen Abstammungsgruppen geschaffen werden, tritt eine Bindung, die alle<br />
Segmente über die Zentralinstanz des Häuptlings verknüpft. Die Tauschbeziehungen<br />
zwischen den Schwägern laufen in diesem Fall nicht mehr auf der horizontalen Ebene<br />
von Segment zu Segment, sondern auf der vertikalen hin und fort vom Zentrum. Die<br />
Polygamie transformiert dergestalt reziproke schwagerschaftliche Beziehungen in eine<br />
redistributive Struktur. Je stärker und ausgeprägter die Stellung des Häuptlings<br />
und die <strong>Institut</strong>ion des Häuptlingstums sind, um so wichtiger werden diese Bindungen.<br />
Der Trobriand-Häuptling z.B. erhält eine Frau von jedem Unter-Clan, er ist<br />
somit, wie Lévi-Strauss schreibt, ein »universeller Schwager« (1967: 97). Diese Heiraten<br />
sind auch symbolische Akte, denn "universell" ist vor allem die Funktion des<br />
Häuptlings als redistributive Instanz (Malinowski erschien er als tribal banker), die<br />
konkreten verwandtschaftlichen Bande treten dabei in den Hintergrund. »Güter<br />
werden dem Häuptling überlassen, vielleicht auf Verlangen und nach Aufforderung,<br />
und ebenso können Güter von ihm demütig erbeten werden.« (Sahlins 1972: 206)<br />
Der Anlaß <strong>für</strong> derartige Transaktionen ist häufig die konkrete Notwendigkeit zur<br />
Hilfeleistung, d.h. die Bedürftigkeit eines Stammesangehörigen. »Die Erwiderung ist<br />
von daher unbestimmt. Die Gegengabe kann aufgeschoben werden, bis eine Notsituation<br />
sie erfordert, sie muß nicht notwendig der Ursprungsgabe und der materielle<br />
Fluß kann sich <strong>für</strong> lange Zeit in einem Ungleichgewicht zugunsten der einen oder der<br />
anderen Seite befinden.« (Ibid.) Trotz der herausgehobenen Stellung des Häuptlings<br />
handelt es sich hierbei auch um ein System wechselseitiger Verpflichtungen, dem<br />
sich keine der involvierten Parteien entziehen kann. Der Gabentausch hat somit<br />
Sahlins zufolge — zumindest innerhalb redistributiver Strukturen — immer auch<br />
eine originär politische Dimension: 169<br />
167 »Indem die Gruppe es anerkennt, hat sie die Elemente der individuellen Sicherheit, die mit der Monogamieregel<br />
einhergingen, gegen die kollektive Sicherheit eingetauscht, die aus der politischen Organisation<br />
erwächst.« (Lévi-Strauss 1967: 96)<br />
168 Die Polygamie widerspricht demnach nicht »der Forderung nach einer gerechten Verteilung der<br />
Frauen; sie ergänzt lediglich einen Verteilungsmodus durch einen anderen. Tatsächlich entsprechen<br />
Monogamie und Polygamie zwei komplementären Arten von Beziehungen; einerseits dem System von<br />
Leistungen und Gegenleistungen, das die individuellen Mitglieder der Gruppe miteinander verbindet;<br />
andererseits dem System von Leistungen und Gegenleistungen, das die Gesamtheit der Gruppe mit dem<br />
Häuptling verbindet.« (Lévi-Strauss 1967: 97)<br />
169 Was <strong>für</strong> den Paramount-Chief der Trobriander gilt, trifft z.B. auch auf den Bantu-Häuptling zu: »Er<br />
erhielt Tribut von seinem Volk, in Form von Naturalien und als Arbeitsleistung. Er erhielt einen Teil<br />
jedes geschlachteten oder bei der Jagd getöteten Tieres; der Brautpreis <strong>für</strong> seine Häuptlingsfrau wurde<br />
von den Angehörigen seines Stammes gezahlt; er hatte das Recht, von seinen Untertanen bestimmte<br />
Dienstleistungen zu verlangen, wie seine Hütten zu bauen und das Land <strong>für</strong> die Gärten seiner Frauen
Gleiche und Ungleiche 99<br />
»Wahrscheinlich immer "ökonomische Basis" primitiver Politik, ist die Großzügigkeit des<br />
Häuptlings auf der einen Seite ein Akt positiver Moralität; auf der anderen legt sie der Allgemeinheit<br />
eine Verpflichtung auf. Oder, um die Perspektive zu erweitern, die gesamte politische<br />
Ordnung wird getragen von einem zentrierten Güterstrom ... wo jede Gabe nicht allein<br />
eine Statusbeziehung anzeigt sondern, als nicht direkt erwiderte generalisierte Gabe, Loyalität<br />
erzwingt.« (Ibid.)<br />
YAMS UND GETREIDE<br />
Wie gesehen, sind die Grenzen zwischen reziprokem und redistributivem Tausch an<br />
dessen Wurzeln durchaus nicht klar zu ziehen. Zwar verortet Thomas Gibson wahrscheinlich<br />
durchaus zu recht »im Häuptlingstum den Keim sowohl der Redistribution<br />
als auch der Hierarchie: ein System mit einem Zentrum, und ein Teil des Ganzen,<br />
das <strong>für</strong> das Ganze steht und es repräsentiert.« (Gibson 1988: 169) Dieses System ist<br />
aber zunächst nur unscharf konturiert, der Häuptling erscheint lediglich als Erster<br />
unter Gleichen und die redistributive Struktur ist keinesfalls dominant. Es ist mehr<br />
als fraglich, ob der <strong>Institut</strong>ion des Häuptlingstums eine Eigendynamik innewohnt, die<br />
letztlich aus sich heraus zur politischen Dominanz des gesellschaftlichen Zentrums<br />
führt.<br />
So wurzelt denn auch die Triebkraft, welche reziproke in redistributive Strukturen<br />
und mechanische in hierarchische Solidarität transformiert, <strong>für</strong> Claude Meillassoux<br />
im Ökonomischen. Für ihn besteht ein Kausalzusammenhang zwischen Wirtschaftsweisen<br />
und Distributionsformen — insbesondere den Übergang von der<br />
Stecklingswirtschaft zum Ackerbau betreffend. Im Unterschied zu anderen Subsistenzweisen<br />
erzwingt und bedingt der Getreideanbau demnach eine Kohärenz der<br />
sozialen Einheiten, die sowohl Jägern und Sammlern, als auch Gartenbau treibenden<br />
Gesellschaften nicht eigen ist. Auf die relative Instabilität der Jäger– und Sammlerhorden<br />
hatte ich bereits verwiesen. Dort hindert theoretisch die Familie, welche<br />
ihre Horde verlassen will, nichts daran, dies zu tun. Gleiches gilt nach Meillassoux<br />
prinzipiell <strong>für</strong> Gartenbau treibende Gesellschaften. 170 Wenngleich die sozialen Einheiten<br />
dort einen stärkeren inneren Zusammenhalt besitzen als Jäger– und Samm-<br />
vorzubereiten; vor allem vereinnahmt er Abgaben <strong>für</strong> die Rechtsprechung und Strafen bei Vergehen,<br />
und bei Mordfällen zahlen die Schuldigen die Kompensation nicht den Angehörigen der Opfer, sondern<br />
ihm. All diese Akkumulation von Reichtum erfolgte ... im Namen des Stammes. Eine Qualität, die stets<br />
vom Häuptling erwartet wurde, war Großzügigkeit. Er hatte in Zeiten der Not <strong>für</strong> die Angehörigen<br />
seines Stammes zu sorgen. Bei einer Mißernte wandte sich ein Mann an den Häuptling um Hilfe; der<br />
Häuptling gab sein Vieh den ärmeren Mitgliedern, um es zu hüten, und erlaubte ihnen, die Milch zu verwenden;<br />
er belohnte die Dienste seiner Krieger mit Gaben von Vieh; seine Untertanen besuchten ihn<br />
häufig in seinem Kraal und während ihres Aufenthalts ernährte und unterhielt er sie.« (Schapera 1928:<br />
141)<br />
170 Im Unterschied zum Getreideanbau ist bei der Stecklingswirtschaft — d.h. dem Anbau von Yams,<br />
Maniok, Taro, Bananen, usw. — eine Vorratswirtschaft nur sehr begrenzt möglich, da die Feldfrüchte<br />
in der Regel nicht länger als ein Jahr konserviert werden können, ist. Der Aufwand <strong>für</strong> Anbau und Ernte<br />
ist hier teilweise geringer als derjenige <strong>für</strong> das Zubereiten der Nahrung. Zudem muß diese aufgrund<br />
ihrer Unausgewogenheit um andere Eiweißquellen, d.h. durch Erträge aus Jagd– und Sammeltätigkeit<br />
ergänzt werden (vgl. Meillassoux 1975: 39f.).
100 Gleiche und Ungleiche<br />
lerhorden, besteht auch in Gartenbaugesellschaften zumindest theoretisch die Möglichkeit,<br />
sich von der Gruppe abzuspalten: Es ist einfach, sich z.B. ausreichend Yams<br />
zu verschaffen, um damit einen neuen Produktionszyklus zu beginnen — die Knollen<br />
liegen auf den Feldern und sind in der Regel im Überfluß vorhanden. Zudem benötigen<br />
die Gärten wenig Vorbereitung und der Produktionszyklus ist kurz, es dauert<br />
nur wenige Wochen, bis der neue Yams geerntet wird. Bis dahin können sich die<br />
"Emigranten" mit der Jagd und dem Sammeln am Leben erhalten. Das trifft <strong>für</strong> den<br />
Anbau von Getreide nicht mehr zu. Aufgrund dessen Eigenarten besteht <strong>für</strong> Meillassoux<br />
ein funktionaler Zusammenhang zwischen Ackerbau und einem redistributiv<br />
organisierten Verteilungssektor. 171<br />
Getreide hat <strong>für</strong> das Überleben der Gruppe eine wesentlich größere Bedeutung<br />
als Yams, Maniok, etc., eine Bedeutung, die vor allem in der Schwierigkeit der<br />
Saatgutbeschaffung begründet ist. Man muß nicht nur Saatgut erhalten, um einen<br />
landwirtschaftlichen Produktionszyklus beginnen zu können, man muß große Mengen<br />
an unersetzlichem Saatgut erhalten. Es geht hier nicht um einige ohnehin im<br />
Überfluß vorhandene Yamsknollen, es geht um Leben und Tod. Hier liegt die ganze<br />
Differenz: Yams ist ein Überfluß-, Getreide ein Mangelartikel. 172 Dies zunächst vor<br />
allem aufgrund des beim Getreideanbau in Relation zum Ernteertrag extrem hohen<br />
Bedarfs an Saatgut. Nach Georges Duby lag im europäischen Mittelalter die Relation<br />
von Ernte zu Aussaat bei 1,6 bis 2,2 (1969: 39f.), dieser Wert dürften in der Jungsteinzeit<br />
kaum günstiger gewesen sein. Es war also gut die Hälfte dessen, was ein<br />
Mensch im Jahr an Getreide benötigte, als Saatgut in entsprechenden Speichern vorzuhalten.<br />
Damit überhaupt hinreichend Körner zur Aussaat vorhanden sind, mußten<br />
sie irgendwann einmal angehäuft werden. Die jeweils nachkommende Generation<br />
lebt in Ackerbau treibenden Gemeinwesen dergestalt von der Arbeit der vorigen:<br />
ihrem Saatgetreide und den Feldern, welche sie anlegten. Dieses Verhältnis spiegelt<br />
sich <strong>für</strong> Meillassoux in der Hierarchie wider,<br />
»die in den landwirtschaftlichen Gemeinschaften vorherrscht und sich herstellt zwischen "denen,<br />
die vorher kommen" und "denen, die nachher kommen". Sie gründet auf einem Begriff<br />
der Anteriorität. Die ersteren sind jene, denen man die Nahrung und das Saatgut verdankt: es<br />
sind die Älteren. Unter ihnen verdankt der Älteste im Produktionszyklus niemandem mehr<br />
etwas außer den Ahnen, während er die Totalität dessen auf sich konzentriert, was die jüngeren<br />
der Gemeinschaft schulden, die er nun auf diese Weise verkörpert.« (1975: 40)<br />
Nach Meillassoux "gehört" das Saatgut also zwangsläufig dem "Ältesten" (oder den<br />
171 Wiewohl das zweite nicht notwendig an das erste gebunden ist, redistributive Strukturen finden sich,<br />
wie gesehen, auch in anderen Gesellschaften.<br />
172 Die wahrscheinlich durch einen dramatischen Klimawandel erzwungene "neolithische Revolution"<br />
besiegte keinesfalls den Hunger, sie institutionalisierte ihn. Der Mensch war fortan verdammt, sein Brot<br />
im Schweiße des Angesichts zu essen. Das Leben der Menschen wurde mit dem Übergang zum<br />
Ackerbau keinesfalls leichter, die von Theya Molleson (1994) vorgenommene Rekonstruktion des<br />
Lebens in einem neolithischen Dorf vor 10.000 bis 11.500 Jahren steht in drastischem Kontrast zum<br />
fröhlichen Treiben der Trobriander. Es wäre allerdings verfehlt, die Lebensbedingungen unter<br />
vollkommen unterschiedlichen klimatischen Bedingungen vergleichen zu wollen.
Gleiche und Ungleiche 101<br />
Ältesten), er verwaltet die Erträge der landwirtschaftlichen Produktion. Die Feldfrüchte<br />
der gesamten Gruppe wandern in seine Speicher, um schließlich von dort zu<br />
den Mitgliedern der Gruppe zurückzukehren, sei es als Nahrungsmittel oder als<br />
Saatgut. Es findet also ein Austausch zwischen den Generationen statt. Der Älteste<br />
gibt das Saatgut, und die jüngeren liefern ihm die Ernte ab:<br />
»Aufgrund seiner Stellung an der Spitze der Gemeinschaftszelle fallen dem Ältesten logischerweise<br />
die Aufgaben des Einsammelns und der Speicherung des Produkts zu. Ebenso befindet er<br />
sich in der Position, es zu verwalten. Damit schafft die Notwendigkeit dieser Verwaltung zur<br />
Sicherung der Reproduktion des Produktionszyklus eine Funktion, während die Strukturierung<br />
der Produktionszelle denjenigen bestimmt, der sie ausüben muß. Der oben beschriebene Zyklus<br />
der Vorschüsse und Rückzahlungen findet zwischen dem Ältesten und seinen jüngeren<br />
Partnern statt. Er äußert sich formal in einem Leistungs– und Umverteilungs-Kreislauf, der die<br />
in diesem Gesellschaftstypus vorherrschende Zirkulationsweise ist.« (Ibid.: 55f.)<br />
Es ist wohl überflüssig zu betonen, daß die Stellung der Ältesten objektiv eine<br />
Machtposition ist. Diese Verfügungsmacht hat nach Meillassoux schließlich die Tendenz,<br />
»sich von der Kontrolle der Lebensmittel auf die Kontrolle der Frauen und<br />
von der Verwaltung der Nahrungsgüter auf die politische Autorität über Individuen<br />
zu verschieben.« (Ibid.: 59) 173 Von hier aus ist es nur noch ein kurzes Stück Wegs zu<br />
den Priesterkönigen und "Tempelökonomien" des frühen Altertums. Der Getreideanbau<br />
scheint mit jenen Strukturen zu korrespondieren, die er gleichzeitig ermöglicht.<br />
Zumindest in der alten Welt ist der Aufstieg der frühen Hochkulturen untrennbar<br />
mit der "neolithischen Revolution" (V.G. Childe), der Kultivierung des<br />
Getreides, verknüpft. 174 Der Gottkönig war auch der Herr der Kornspeicher, über<br />
deren Inhalt seine Schreiber die ersten "Bücher" führten. Getreide ist das Fundament<br />
der Zivilisationen, es ist sehr lange lagerfähig und aufgrund seines extrem geringen<br />
Wassergehalts (Gesamtgewicht in Relation zum Nährwert) bestens <strong>für</strong> den Transport<br />
geeignet. 175 Es ermöglicht (besser noch als das Vieh) die dauerhafte Anhäufung<br />
von Reichtum, der dem König in Gestalt von Abgaben zufließt und zu allen denkbaren<br />
Zwecken eingesetzt werden kann: um Armeen im Feld zu halten, Handwerker<br />
zu ernähren, in Hungersnöten die Bedürftigen zu speisen.<br />
Soviel soll im Rahmen dieser vergleichenden Untersuchung, die keine Universalgeschichte<br />
der Wirtschaftsformen sein kann und will, als Verweis ausreichen. Die<br />
Gegenwart redistributiver Muster in unserer Gesellschaft als zentraler Bestandteil<br />
staatlicher Organisation sollte evident sein. Ich will hierauf nicht näher eingehen,<br />
173 Das Exogamiegebot wird somit zu einem Instrument der Machterhaltung, wobei "Macht" in diesem<br />
Fall ganz andere Dimensionen hat, als beim südamerikanischen Häuptling, da sie (auf diesen Punkt läuft<br />
die marxistische Argumentation Meillassoux' hinaus) in einer ökonomischen Notwendigkeit gründet.<br />
Meillassoux bezieht sich bei diesen Schlußfolgerungen primär auf die in seiner "Anthropologie économique<br />
des Gouro de Côte-d'Ivoire" dargelegten Ergebnisse der eigenen Feldforschung. Eine recht ausführliche Darstellung<br />
dieses Werkes gibt Terray (1969).<br />
174 Die Maya und die Khmer betrieben allerdings Stecklingswirtschaft.<br />
175 Dies trifft in eingeschränktem Maße auch <strong>für</strong> getrocknete Hülsenfrüchte zu, die eine wichtige<br />
Ergänzung der Nahrung in rein bäuerlichen Gemeinwesen darstellen.
102 Gleiche und Ungleiche<br />
sondern mich im folgenden der sozialen Stratifizierung noch aus einer anderen Perspektive<br />
nähern.<br />
SCHICHTUNG UND ARBEITSTEILUNG<br />
Die <strong>Institut</strong>ion des redistributiven Tauschs hat nach Sahlins zwei unterschiedliche<br />
Funktionen, von denen in einer gegebenen Situation jeweils eine dominieren kann.<br />
Die erste ist praktisch-logistischer Art, das Prinzip der Umverteilung hilft, die unvermeidlich<br />
auftauchenden Ungleichgewichte bei der Versorgung mit Nahrung auszugleichen.<br />
Die zweite ist sozialer Natur: »Als Ritual der Vereinigung und der Unterordnung<br />
unter die zentrale Autorität unterhält die Redistribution die kooperative<br />
Struktur als solche, das heißt in ihrem sozialen Sinn. Die praktischen Vorteile mögen<br />
fragwürdig sein, aber ... die Verteilung erzeugt einen Geist der Einheit ..., kodiert<br />
die Struktur, festigt die zentralisierte Organisation der sozialen Ordnung und des sozialen<br />
Handelns.« (1972: 190) Daß Güterverteilungen häufig in einem zeremoniellen<br />
Rahmen stattfinden, dürfte dem zweiten Aspekt geschuldet sein. In "vormodernen"<br />
Gesellschaften sind Feste häufig mit einer (oft ausufernden) Präsentation und Umverteilung<br />
von Gütern (Nahrung, Handelsgüter, Prestigeobjekte) verbunden. Dies<br />
gilt nicht nur <strong>für</strong> die "Primitiven", sondern auch <strong>für</strong> die mittelalterliche Feudalordnung:<br />
»Die Großen des Königreichs mußten stets mit vollen Händen an den Hof kommen. Ihre regelmäßigen<br />
Geschenke waren nicht nur ein offenes Zurschaustellen ihrer Freundschaft und Ergebenheit,<br />
ein ähnliches Friedenspfand, wie jene Gaben, die <strong>für</strong> die Sicherheit zwischen den<br />
Völkern bürgten; sie bedeuteten mehr. Denn als Geschenke des Königs, den alle <strong>für</strong> den natürlichen<br />
Fürsprecher des gesamten Volkes bei den jenseitigen Mächten hielten, garantierten<br />
sie auch Wohlstand <strong>für</strong> jedermann, sie versprachen fruchtbaren Boden, reiche Ernten, das Ende<br />
der Pestausbrüche. Für all diese Gaben indes mußte die Freizügigkeit derer, die sie empfingen,<br />
einen Ausgleich schaffen. Kein einziger Reicher konnte den Bittstellern seine Tür verschließen,<br />
keiner die Hungrigen fortschicken, die vor seinen Speichern um Almosen bettelten,<br />
keiner konnte sich weigern, die Unglücklichen, die ihre Dienste anboten, unter seine Schutzherrschaft<br />
zu nehmen und ihnen Kleidung und Nahrung zu geben. Auf diese Weise wurde ein<br />
großer Teil der Güter, die dank des Grundbesitzes und dank der Autorität über die kleinen<br />
Leute in den Herrenhäusern zusammenflossen, notwendigerweise wieder unter jenen verteilt,<br />
die sie gebracht hatten. Über den Umweg der herrschaftlichen Munifizenz verwirklichte diese<br />
Gesellschaft eine Art Gerechtigkeit und hob die nackte Not durch gemeinsame Armut auf.<br />
Nicht nur die Klöster organisierten einen "Pfortendienst" mit der Aufgabe, <strong>für</strong> die Umverteilung<br />
und Wiederverteilung an die Armen zu sorgen. Auch das Ansehen der Fürsten hing unmittelbar<br />
mit der Großzügigkeit zusammen; sie raubten nur — und dies mit einer Gier, die<br />
unersättlich schien —, um noch freigiebiger Schenken zu können.« (Duby 1969: 68)<br />
Jene "unzivilisierte Welt" wurde nach Duby »vollständig von der Gewohnheit und<br />
der Notwendigkeit beherrscht, einerseits zu plündern und andererseits Opfer zu<br />
bringen.« (Ibid.: 64) Räuberische Aneignung und mildtätige Gabe ergänzten sich; sie<br />
markierten die Pole, welche »den Gütertausch weitgehend bestimmten. Das gesamte<br />
Sozialgefüge war durch und durch von einer intensiven Zirkulation der Geschenke
Gleiche und Ungleiche 103<br />
und Gegengeschenke, der zeremoniellen und sakralen Gaben geprägt.« (Ibid.) 176 Ein<br />
erheblicher Teil der Produktion ging in diese umfassende Zirkulation der Gaben und<br />
Gegengaben ein. 177<br />
Freigiebigkeit zeichnet also den Edlen aus und begründet sein gesellschaftliches Ansehen:<br />
»Der Ritter darf nichts <strong>für</strong> sich behalten. Alles, was ihm zufällt, verschenkt<br />
er. Aus seiner Freigiebigkeit gewinnt er seine Kraft und den Kern seiner Macht, in<br />
jedem Fall sein ganzes Ansehen und die herzliche Freundschaft, die ihn umgibt.«<br />
(Duby 1984: 114) Freigiebigkeit ist dergestalt in nahezu allen "vormodernen" Gesellschaften<br />
Privileg und Verpflichtung der Herrschenden, sie ist das Insignium der<br />
Macht (welche wiederum Großzügigkeit ermöglicht). 178 »Adel wird im Haus der<br />
Freigiebigkeit genährt«, heißt es in der Histoire de Guillaume le Maréchal aus dem<br />
13. Jh. (nach Starobinsky 1994: 31) Das Zentrum erstattet aber keineswegs all das,<br />
was es einnahm, in gleicher Form zurück. Zumeist waren die Güter, die ihm zuflossen,<br />
auch Basis demonstrativen Konsums, einer Prachtentfaltung, die das Licht des<br />
Hofes weithin leuchten ließ.<br />
Der Tausch von Tribut gegen materielle Wohltaten zwischen Peripherie und<br />
Zentrum stellt somit lediglich einen Grenzfall der Redistribution dar. Am anderen<br />
Rand des Spektrums entrichteten die Untertanen dem Adel und Klerus — die das<br />
gesellschaftliche Ganze repräsentierten, die weltliche und göttliche Ordnung ("von<br />
Gottes Gnade" sind) — Abgaben <strong>für</strong> gänzlich Immaterielles wie "Sicherheit", "Gnade",<br />
"Fruchtbarkeit" — oder was immer ihnen von König und Kardinal gewährt oder<br />
in ihrem Namen erbeten wurde. 179 Man darf auch hier die Trennline zwischen<br />
den einzelnen Typen sozialer "Solidarität" nicht allzu scharf ziehen. In gewisser Hinsicht<br />
verweist der <strong>für</strong> das Feudalsystem charakteristische Austausch zwischen den<br />
Schichten auf alle drei Formen, auch wenn das hierarchische Element eindeutig dominiert,<br />
das Zentrum das gesellschaftliche Ganze beherrscht und symbolisiert. Die<br />
Beziehung zwischen den Schichten wird aber durchaus auch als arbeitsteilige begriffen,<br />
die Funktionen der einzelnen "Organe" erscheinen als jeweils notwendige, sich<br />
wechselseitig ergänzende, d.h. als komplementäre: "Ich schütze euch, ich bete <strong>für</strong><br />
176 »Mit all diesen Opfern und Freigiebigkeiten wurden die Früchte der Arbeit zwar teilweise wieder<br />
zerstört, andererseits aber garantierten sie eine gewisse Umverteilung des Reichtums, und vor allem<br />
verhalfen sie den Menschen zu den Vorzügen, die ihnen am wertvollsten erschienen, nämlich in Gunst<br />
der geheimen Kräfte zu kommen, die das Universum regierten.« (Ibid.)<br />
177 »Viele der Abgaben und Leistungen, die von den Bauern zwangsweise in das Haus ihres Herren<br />
gebracht wurden, bezeichnete man in der damaligen Umgangssprache noch lange als Geschenke,<br />
eulogiae.« (Ibid.: 67)<br />
178 Die mildtätige Gabe kann nicht in gleicher Form erwidert werden, und die unerwiderte Wohltat ist<br />
stets Zeichen sozialer Überlegenheit. Starobinsky spricht in diesem Zusammenhang von vertikalen<br />
Gaben (1994: 27) Zudem macht der mildtätige und freigiebige Christ den Himmel zu seinem Schuldner:<br />
Gott vergilt die Gabe (vgl. Ibid.: 106 und Paul 1997: 446).<br />
179 Die Inka-Könige sicherten ihre Herrschaft, indem sie die vormals bestehenden Handelsbeziehungen<br />
zwischen den von ihnen unterworfenen Völkern und Regionen im Rahmen einer umfassenden redistributiven<br />
Struktur monopolisierten — was ihnen ermöglichte, großzügig zu geben (vgl. Murra 1980).
104 Gleiche und Ungleiche<br />
euch, ich arbeite <strong>für</strong> euch". Innerhalb eines solchen Systems werden die jeweiligen<br />
Pflichten zumindest ansatzweise auch als reziproke begriffen. Wie du mir, so ich dir<br />
— und jedem das Seine: Die Kontrahenten sind sich in der Hinsicht gleich, daß jeder<br />
gibt, was ihm bestimmt ist; was dabei als angemessene Erwiderung gilt, ist gesellschaftlich<br />
determiniert und nicht absolut gesetzt. So beten und rauben die einen,<br />
während die anderen sich im Schweiße ihres Angesichts auf dem Acker abplagen.<br />
Auch wenn die Gegenleistung der herrschenden Schichten in hierarchisch gegliederten<br />
Gesellschaften dergestalt häufig nur Fiktion in dem Sinne ist, daß sie der materiellen<br />
Substanz entbehrt, fühlt sich dennoch keiner betrogen, solange erfolgreich<br />
der Anschein aufrechterhalten wird, daß jeder das ihm Angemessene zum Ganzen<br />
beiträgt. Das System ist solange stabil, wie keine tiefgreifenden Brüche auftreten und<br />
der einzelne sich außerhalb dieser Welt nicht denken kann und will. Keine Gesellschaft<br />
dürfte dauerhaft der Fiktion entbehren, daß, wie immer auch die "objektiven"<br />
Verhältnisse beschaffen sind, alle Tauschbeziehungen der Norm der Reziprozität genügen.<br />
Die Tendenz, Beiträge übergeordneter Schichten zum sozialen Ganzen zu<br />
mystifizieren ist nach Thomas Gibson <strong>für</strong> Gesellschaften charakteristisch, »in welchen<br />
verschiedene funktional spezialisierte Einheiten existieren, die einen jeweils<br />
spezifischen Beitrag zum Ganzen liefern.« (1988: 169f.) Gibson bezieht sich vorrangig<br />
auf die Hindu-Gesellschaft, in welcher die Ideologie des ungleichen Austauschs<br />
unübertroffenes Raffinement erreicht hat. Diese Ideologie manifestiert sich im Kastenwesen,<br />
einer ökonomischen Struktur, deren Elemente endogame, arbeitsteilig<br />
differenzierte und hierarchisch gegliederte Abstammungsgruppen sind, und die<br />
ebenso in einer Theorie "spiritueller" Ungleichheit gründet wie in einer "künstlichen"<br />
komplementären Abhängigkeit ihrer Elemente. Jeder Kaste sind bestimmte<br />
Verrichtungen untersagt, sie ist notwendig auf andere angewiesen. Keine derartige<br />
Gesellschaft kann z.B. ohne Wäscher oder Barbiere existieren, »nicht, weil sie nicht<br />
wissen, wie man sich wäscht oder rasiert, sondern weil sie ohne Wäscher oder Barbier<br />
ebensowenig anständig geboren werden, heiraten oder sterben können wie ein<br />
Katholik ohne Priester.« (Hocart nach Ibid.: 311) Daß die einzelnen Kasten in einer<br />
komplementären Beziehung der wechselseitigen Abhängigkeit zueinander stehen,<br />
heißt aber nicht, daß sie als gleichwertig gelten. Das genaue Gegenteil ist der Fall. In<br />
der hinduistischen Welt<br />
»stellt man sich vor, daß jede beruflich spezialisierte Gruppe eine qualitativ verschiedene Art<br />
von Gut oder Dienstleistung zum sozialen Ganzen beiträgt, mit einem jeweils anderen Wert an<br />
sich. In einem derartigen System kann die Hierarchie der den Gütern und Dienstleistungen zugemessenen<br />
Werte auf die spezialisierten Berufsgruppen übertragen werden, um eine durchgängige<br />
soziale Hierarchie mit den Priestern an der Spitze zu erzeugen.« (Ibid.)<br />
Diese Hierarchie innerhalb der arbeitsteiligen Struktur ist in Termini von Reinheit<br />
und Unreinheit kodifiziert, die Mißachtung der gesellschaftlich gezogenen Grenzen<br />
führte zu schwerer spiritueller Verunreinigung, eine Abweichung vom "Weg der
Gleiche und Ungleiche 105<br />
Pflicht" hat die Reinkarnation als Unberührbarer oder als Tier zur folge. 180 Unterschiedlichen<br />
Tätigkeiten wird also jeweils eine bestimmte Wertigkeit beigemessen.<br />
Gibson bezeichnet dieses System als eine Form hierarchisch-komplementären Austauschs:<br />
»Hierarchisch aufgrund der Orientierung auf das Ganze hin ... und komplementär<br />
wegen der Anwesenheit funktional geschiedener Einheiten.« (Gibson<br />
1988: 170) Herrschaft und Unterordnung realisieren sich dergestalt als Arbeitsteilung,<br />
die hierarchische maskiert sich als organische Solidarität. Hierauf verweist<br />
schon der hinduistische Schöpfungsmythos: Die Götter schufen demnach die Hierarchie<br />
unter den Menschen, die auf der elementarsten Ebene aus vier Varnas (Seinsstufen)<br />
besteht, die den Körperteilen Purusas entsprangen, der die Menschheit erschuf,<br />
indem er sich selbst zerteilte. Die Brahmanen (Priester) entsprechen dem<br />
Mund, die Kshatrias (Krieger) den Armen, die Vaishyas (Kaufleute und Handwerker)<br />
den Schenkeln, die Shundras (Diener) schließlich den Füßen des Gottes. Die<br />
Varnas weisen den Individuen ihren gesellschaftlichen Status zu und liefern damit das<br />
Grundmuster <strong>für</strong> das Kastenwesen (vgl. Bowker 1997: 1015). Eine spezifische Ausprägung<br />
des Kastensystems ist das zuerst 1936 von Wiser beschriebene jajmani-<br />
System, das (mit lokalen Variationen) in Indien weit verbreitet ist. Pauline M. Kolenda<br />
liefert diesbezüglich eine knappe instruktive Beschreibung:<br />
»Das Jajmani-System ist ein System der Distribution in indischen Dörfern, wo landbesitzende<br />
Familien hoher Kasten, jajman genannt, mit Produkten und Dienstleistungen von verschiedenen<br />
niederen Kasten wie Zimmerleuten, Schmieden, Töpfern, Wasserträgern, Straßenkehrern<br />
und Wäschern versorgt werden. Rein rituelle Dienste können von brahmanischen Priestern ...<br />
geleistet werden, und fast alle dienenden Kasten haben zeremonielle und rituelle Pflichten bei<br />
den Geburten, Hochzeiten, Begräbnissen ihres Jajman und bei einigen religiösen Festen. Bedeutsam<br />
<strong>für</strong> letztere Pflichten ist die Fähigkeit der unteren Kasten, Verunreinigung zu absorbieren<br />
... Die landbesitzenden Jajmans zahlen den dienenden Kasten Naturalien [...] Manchmal<br />
wird den Dienenden Land überlassen, speziell ... den brahmanischen Priestern. In diesem System<br />
nehmen die mittleren und niedrigen Kasten entweder ihre jeweiligen Dienstleistungen<br />
gegen Kompensationen und Zahlungen in Anspruch, oder sie tauschen ihre Dienste aus.«<br />
(1963: 287)<br />
Die Hierarchie verdoppelt sich hier um ein Patronage-Klientel Verhältnis; eine Art<br />
Gefolgschaftsbeziehung zwischen dem Jajman und den ihm Dienenden (kamins)<br />
vermengt sich mit den komplementären Abhängigkeitsbeziehungen des Kastensystems.<br />
Spezialisierung und Schichtung, Austausch und Umverteilung gehen somit<br />
scheinbar zwanglos Hand in Hand und ergänzen sich offenbar. Der erfolgreiche Bestand<br />
dieses Systems über die Zeit wird nach Wiser schließlich auch durch die noblesse<br />
oblige der Brahmanen in ihrer Rolle als Jajmans sichergestellt.<br />
Dieser knappe Exkurs in die hinduistische Welt hatte vor allem den Zweck, einigen<br />
möglichen Mißverständnissen bezüglich des Wesens der organischen Solidarität vor-<br />
180 Der Gläubige beschreitet den Weg der Pflicht (Dharma), die Seelenwanderung ermöglicht die<br />
Verwandlung in höheres und niedrigeres Sein (Kharma).
106 Gleiche und Ungleiche<br />
zubeugen. 181 Stratifizierung und Arbeitsteilung stehen sich mitnichten als unversöhnliche<br />
Gegensätze gegenüber, Spezialisierung signifiziert keinesfalls notwendig Gleichheit<br />
im Sinne von Gleichwertigkeit. Hierarchisch-komplementäre Beziehungen sind<br />
integraler Bestandteil auch unserer Gesellschaft. Und wenngleich wir geneigt sind,<br />
das Gegenteil zu glauben, unterscheidet sich unsere Ökonomie zumindest in einem<br />
zentralen Punkt strukturell nicht im geringsten vom Kastenwesen: ebenso wie dieses<br />
wurzelt sie in einer Ideologie der Ungleichheit bzw. Ungleichwertigkeit — von Kapital<br />
und Arbeit, Kopf– und Handarbeit, Männern und Frauen, schließlich den einzelnen<br />
Berufsgruppen: Managern und Arbeitern. 182 Die "Organe" unseres Gesellschaftskörpers<br />
sind einander keineswegs gleichwertig, und das idyllische Bild einer<br />
arbeitsteilig organisierten Gesellschaft, in der freie Produzenten wechselseitig (und<br />
"gerecht") die Produkte ihrer Tätigkeit austauschen, ist unseren ökonomischen Verhältnissen,<br />
die nicht zuletzt von einen hierarchisch strukturierten Produktionssektor<br />
bestimmt sind, völlig unangemessen.<br />
Wie der "Primitive Handel" zeigt, ist Spezialisierung als solche zwar nicht per se eine<br />
Quelle sozialer Ungleichheit. Wenn man sich aber zu einer der Wurzeln der Arbeitsteilung<br />
innerhalb des Gemeinwesens begibt, nämlich zur geschlechtlichen, erscheint<br />
diese tatsächlich als Prototyp eines institutionalisierten Verhältnisses der Ungleichwertigkeit.<br />
Die Kritik, die ich Godelier folgend an Lévi-Strauss' Logifizierung<br />
männlicher Dominanz geübt hatte (vgl. oben, Kapitel 3), sollte keineswegs darüber<br />
hinwegtäuschen, daß Frauen unter der Ägide männlicher Herrschaft tatsächlich getauscht,<br />
häufig gar ge– und verkauft werden. Was <strong>für</strong> "den Fremden" allzu oft gilt,<br />
trifft auch auf die Frauen zu: sie sind von den heiligen Ritualen ausgeschlossen, tauschen<br />
(scheinbar) nicht und schweigen: »Jemanden nicht zu grüßen heißt ihn wie ein<br />
Ding, ein Tier oder eine Frau behandeln.« (Bourdieu 1972: 16). 183 Wenngleich das<br />
181 Die vorstehenden Sätze sind nicht mehr als eine grobe Stilisierung dieses Systems und sollen lediglich<br />
ein Bild davon vermitteln, wie sich Arbeitsteilung und Schichtung verknüpfen. Zur Komplexität der<br />
indischen Gesellschaft vgl. z.B. Dumont 1966.<br />
182 Der mögliche Einwand, daß im Gegensatz zu uns, wo angeblich jeder seines Glückes Schmied ist<br />
(dem der "Weg nach oben" offensteht, vom Tellerwäscher zum Millionär), der Hindu qua Geburt einer<br />
bestimmten Berufsgruppe angehört, wiegt nicht sonderlich viel angesichts der Tatsache, daß die<br />
jeweilige Kastenzugehörigkeit davon abhängt, ob der Gläubige in seinen vorigen Leben dem "Weg der<br />
Pflicht" folgte. Auch hier ist ein gesellschaftlicher "Aufstieg" (allerdings erst im nächsten Leben)<br />
möglich. Der Unterschied zwischen beiden Ideologien ist lediglich ein gradueller. Und daß die<br />
Wiedergeburtslehre noch viel märchenhafter ist als die Rede von "Chancengleichheit", macht letztere<br />
nicht unbedingt glaubwürdiger.<br />
183 Man darf nicht meinen, daß Frauen nicht tauschen. Sie sind aber sehr wohl von den männlichen<br />
Tauschzyklen ausgeschlossen — und umgekehrt. Das große Verdienst Anette Weiners liegt darin, daß<br />
sie, wie schon im 1. Kapitel erwähnt, auf den Trobriand-Inseln komplexe Tauschzyklen von Frauen<br />
aufspürte (was <strong>für</strong> sie als Frau offenbar nicht sonderlich schwer war) und beschrieb. Die Macht der<br />
Frauen ist <strong>für</strong> Weiner eine regenerative, und in diesem Zusammenhang ist zumindest in Melanesien und<br />
Polynesien der "weibliche Reichtum" zu sehen. Die Gegenstände des weiblichen Reichtums sind Bündel<br />
aus Bananenblättern und Baströke, die sie verfertigen. »Die Kontrolle, welche Frauen an den beiden<br />
Enden des Lebenszyklus ausüben — sowohl in Geburts– als auch in Todesritualen — erhält größere<br />
Signifikanz durch die Verkörperung ihrer Macht in Wertgegenständen: Röcke und Bündel.« (Weiner
Gleiche und Ungleiche 107<br />
Geschlechterverhältnis in den vorindustriellen Gesellschaften jeweils sehr unterschiedlich<br />
ausgeprägt ist, wurde und wird die Arbeit der Frauen in wahrscheinlich<br />
den meisten Gesellschaften abgewertet: »Obwohl die sexuelle Arbeitsteilung den<br />
Frauen eine entscheidende Rolle zuweist (da das Überleben der Familie weitgehend<br />
von der weiblichen Tätigkeit des Sammelns abhängt), gilt ihre Tätigkeit doch als<br />
minderwertig, das ideale Leben wird nach dem Muster der landwirtschaftlichen<br />
Produktion und der Jagd begriffen.« (Lévi-Strauss 1955: 281) Die durchaus exemplarische<br />
Passage aus den "Traurigen Tropen" bezieht sich auf die Nambikwara.<br />
Lévi-Strauss fährt fort:<br />
»Dieser Gegensatz zwischen den psychologischen Haltungen und den ökonomischen Funktionen<br />
spiegelt sich auf philosophischer und religiöser Ebene wider [...] Nach dem Tod verkörpern<br />
sich die Seelen der Männer in den Jaguaren, die Frauen und Kinder hingegen werden in<br />
die Atmosphäre getragen, wo sie sich <strong>für</strong> immer auflösen. Dieser Unterschied erklärt, warum<br />
die Frauen von den geheiligsten Zeremonien ausgeschlossen sind.« (Ibid.: 282f.)<br />
Ähnliches gilt <strong>für</strong> die in Neuguinea lebenden Baruya. Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung<br />
verbietet den Männern, sowohl zu ernten als auch zu kochen, sie müssen<br />
sich von den Frauen ernähren lassen. Dennoch (oder vielleicht gerade deshalb) betrachten<br />
die Männer die Frauen als minderwertige Geschöpfe. Begegnete ein Mann<br />
auf seinem Weg einer Gruppe von Frauen, so blieben diese sofort stehen, »wandten<br />
den Kopf ab und zogen, wenn sie eine Hand frei hatten, lebhaft einen Zipfel ihres<br />
Rindencapes vor ihr Gesicht. Der Mann ging vorbei, ohne sie eines Blickes zu würdigen,<br />
und sie setzten ihren Weg fort.« (Godelier 1982: 27) Die Baruya-Frauen sind<br />
ebenso ausgeschlossen vom Eigentum an Grund und Boden wie von der Herstellung<br />
der materiellen Produktionsmittel, man ist fast versucht, diesbezüglich von "Entfremdung"<br />
zu sprechen: »Sogar der Grabstock, das wichtigste Werkzeug der Frau,<br />
mit dem sie pflanzt und erntet, wird nicht von ihr hergestellt. Ein Vater macht einen<br />
<strong>für</strong> seine Tochter, ein Ehemann einen <strong>für</strong> seine Frau, und sie geben sie ihnen.«<br />
(Ibid.: 30) Spezialisierung, d.h. ökonomische Ungleichheit korrespondiert somit im<br />
Denken dieser (männlichen) Eingeborenen mit einer Theorie der Ungleichwertigkeit<br />
der Geschlechter. Was wir bei den Baruya vorfinden, ist eher Regel als Ausnahme,<br />
Variation eines scheinbar universellen Musters, welches die arbeitsteiligen Beziehungen,<br />
nicht nur das zwischen Männern und Frauen, sondern innerhalb des Produktionssektors<br />
insgesamt bestimmt.<br />
Die in diesem und dem vorstehenden Kapitel skizzierte Topographie des Tauschs,<br />
die Darstellung des Zusammenhangs zwischen Sozialstruktur und Tauschformen be-<br />
1976: 227) Diese werden anläßlich der genannten rituellen Ereignisse in überwältigender Zahl<br />
getauscht, ein Umstand der Malinowskis männlichem Blick offenbar entging, obwohl diese Gegenstände<br />
auf seinen Photographien zu sehen sind. Die symbolischen Qualitäten der Tauschobjekte spiegeln wider,<br />
wie sehr der Zyklus von Leben und Tod das Denken der Trobriander beherrscht. »Steinerne Axtklingen<br />
(männlicher Reichtum), Röcke und Bündel (weiblicher Reichtum) und Yams (die Mischung aus<br />
weiblichem und männlichem Reichtum) stellen die elementaren Gegenstände der Tauschs ... dar, und<br />
jedes Objekt repräsentiert symbolisch ein bestimmtes Maß der Erneuerung.« (Ibid.: 231)
108 Gleiche und Ungleiche<br />
leuchtete in wesentlichen nur die formalen Aspekte. Um die Differenzen zwischen<br />
den unterschiedlichen Gesellschaften in aller Schärfe herauszuarbeiten, werde ich in<br />
den beiden folgenden Kapitel die inhaltlichen Facetten diskutieren, d.h. die von den<br />
Tauschenden jeweils verfolgten Zielen, ihre Interessen und Bedürfnisse, und mich zu<br />
diesem Zweck zunächst nochmals dem Kula-Tausch zuwenden.
5. Kapitel<br />
TAUSCH UND EIGENINTERESSE<br />
Die weiter oben bereits diskutierte Entgegensetzung von Norm und Interesse erscheint<br />
aus modernisierungstheoretischer Perspektive vielfach als zentraler Schlüssel<br />
zum "Verständnis" der Differenz von Gaben– und Warentausch und damit ganz allgemein<br />
der Unterschiede zwischen den "primitiven", "vormodernen" Kulturen und<br />
der westlichen Industriegesellschaft. Während sich demnach der Eingeborene seinen<br />
Pflichten unterwirft, folgen wir unseren Neigungen. Es sollte mittlerweile deutlich<br />
geworden sein, daß eine derartige Kontrastierung mehr verschleiert, als sie erhellt.<br />
Abgesehen davon, daß eine gewisse Diskrepanz zwischen Pflicht und Neigung in allen<br />
Gesellschaften aufzufinden sein dürfte, sind auch die Unterschiede zwischen den<br />
einzelnen Formen des Gabentauschs gravierend. Nichts wäre unangemessener, als in<br />
diesem eine in toto allein auf Zwang (oder Einsicht in soziale Notwendigkeit) beruhende<br />
Angelegenheit zu sehen.<br />
Wie im vorigen Kapitel dargelegt, kommt in bestimmten Formen des zeremoniellen<br />
Gabentauschs im Gegenteil das unverhüllte Eigeninteresse der Akteure, in<br />
Gestalt eines ausgeprägten Strebens nach Prestige, ganz offen zum Ausdruck. Dies<br />
gilt selbst <strong>für</strong> das Idealbild des Gabentauschs: die Zirkulation der Yamswurzeln bei<br />
den Trobriandern. Diese wird mitnichten allein durch den von Malinowski verorteten<br />
wechselseitig ausgeübten Zwang, sondern auch durch eine "positive" Motivation<br />
angetrieben; denn nichts »hat einen größeren Einfluß auf das Denken der Melanesier<br />
als Ehrgeiz und persönliche Eitelkeit in Verbindung mit Zurschaustellung von Nahrung<br />
und Wohlstand. In der Übergabe von Geschenken, in der Verteilung ihres<br />
Überschusses erleben sie eine Manifestation der Macht und eine Steigerung der Persönlichkeit.«<br />
(Malinowski 1926: 138) Die weiblichen Blutsverwandten mit Yams zu<br />
versorgen ist nicht allein eine Frage der Verpflichtung (zu geben) oder der Ehre (angemessen<br />
zu geben), sondern auch des Strebens (viel zu geben). Die von einem<br />
Trobriander angehäuften Yamswurzeln sind somit nicht allein neutrales Nahrungsmittel,<br />
sondern auch Prestigeobjekt, in diesem Sinne nachgerade kulturell "überdeterminiert".<br />
Die Trobriander schichten den geernteten Yams zu Stapeln auf, die<br />
öffentlich zurschaugestellt und von der Dorfgemeinschaft begutachtet und kommentiert<br />
werden: 184<br />
184 Die Trobriander sind nicht etwa eine Mangel– sondern im Gegenteil eine Überschußgesellschaft.<br />
Die Ernteerträge übersteigen in der Regel bei weitem den Bedarf an Nahrungsmitteln, »in einem durchschnittlichen<br />
Jahr ernten sie vielleicht mehr als das zweifache dessen, was sie verzehren können.«<br />
(Malinowski 1922: 86) Sie erzeugen diesen Überschuß zudem »in einer Art, die ihnen weit mehr Arbeit<br />
aufbürdet, als zur Gewinnung der Ernte unbedingt nötig wäre. Viel Zeit und Mühe verwenden sie auf<br />
ästhetische Ziele, darauf, daß die Gärten ordentlich, sauber, von allen Felsstücken frei sind, auf den Bau<br />
schöner, stabiler Zäune und die Beschaffung starker und großer Yamsstangen.« (Ibid.) Das erscheint auf<br />
den zweiten Blick vielleicht weniger sonderbar, wenn man die Rolle der Yamswurzeln als Prestigeobjekte<br />
berücksichtigt; Malinowskis Beschreibung vermittelt den Eindruck, daß diese Funktion fast<br />
wichtiger ist als ihre Rolle als Grundnahrungsmittel. Die Gärten und ihre Erträge sind der Stolz der<br />
Gärtner: »Alle Feldfrüchte werden nach der Ernte noch einige Zeit in den Gärten ausgestellt und dann in
110 Tausch und Eigeninteresse<br />
»Der einzige Zweck all dieses Aufwands und all dieser Anstrengungen <strong>für</strong> die Zurschaustellung<br />
der Nahrung ist es, den Ehrgeiz des Gärtners zu befriedigen... Ein großer Stapel verkündet, in<br />
den Worten meines Informanten: "Schaut, was ich <strong>für</strong> meine Schwester und ihre Familie getan<br />
habe. Ich bin ein guter Gärtner, und meine engsten Verwandten, meine Schwester und ihre<br />
Kinder, werden niemals unter Nahrungsmangel leiden." [...] Diese ganze zeremonielle Seite<br />
der Handlung hat eine verbindliche Kraft ... Die Zurschaustellung, die Vergleiche, die öffentliche<br />
Bewertung erlegen dem Gebenden einen bestimmten psychologischen Zwang auf — sie<br />
befriedigen und belohnen ihn, wenn die erfolgreiche Arbeit es ihm ermöglicht, ein großzügiges<br />
Geschenk zu machen, und sie strafen und demütigen ihn <strong>für</strong> Unfähigkeit, Geiz oder Glücklosigkeit.«<br />
(Ibid.: 142)<br />
Man könnte also sagen: Die Eingeborenen strengen sich an, um ihr Streben nach Anerkennung,<br />
nach Prestige zu befriedigen, und sie tauschen unter dem Zwang der<br />
Obligation. Der Gärtner würde demnach am liebsten seine Yamsknollen <strong>für</strong> sich behalten,<br />
muß sie aber geben, weil nur dies ihm das erstrebte Ansehen erschafft. —<br />
Diese vermeintliche Diskrepanz zwischen Behalten-Wollen und Geben-Müssen ist<br />
scheinbar auch <strong>für</strong> das Kula charakteristisch, dem ich mich im folgenden erneut zuwenden<br />
will.<br />
DER WERT DER VAYGU'A<br />
Die Diskussion, die von Malinowskis Beschreibung des Kula-Tauschs ausgelöst wurde,<br />
dauert bis heute an. Das liegt nach Jerry W. Leach nicht zuletzt daran, daß Malinowski<br />
nur unzureichend erklären konnte, warum die <strong>Institut</strong>ion des Kula existiert:<br />
»Auch wenn man ein umfassendes Verständnis der Regeln und Muster des Kula genannten<br />
Komplexes von Transaktionen hat, bleibt die Frage nach der allem zugrunde<br />
liegenden Triebkraft. Was bringt das Kula den Menschen, die ihm ihre Zeit, Energie,<br />
Ressourcen und Reputation widmen? Wie und warum entstand es? Warum dauert<br />
es an?« (J.W. Leach in Leach & Leach 1983: 5) Derartige Fragen wurden zum<br />
Ausgangspunkt zahlloser ethnographischer und theoretischer Arbeiten, 185 die nach<br />
Leach in drei interpretativen Hauptsträngen mündeten. Der erste läuft darauf hinaus,<br />
im Kula lediglich das Mittel zu sehen, welches als eigentlichen Zweck den notwendigen<br />
"Nebenhandel" zwischen ansonsten (potentiell) feindlichen Ethnien ermöglicht;<br />
der zweite begreift das Ringen um Prestige als Daseinszweck des Kula; der<br />
dritte schließlich sieht im Kula-Tausch ein Medium, welches keinen "externen"<br />
Zweck verfolgt, sondern das soziale Band zwischen den Kula-Partnern (und –Gemeinschaften)<br />
festigen soll. Alle drei Ansätze sind <strong>für</strong> Leach defizitär. Das erste Ar-<br />
ordentlichen, kegelförmigen Haufen unter dem Schutz von Dächern aus Yamsreben aufgeschichtet. Die<br />
Ernte jedes einzelnen wird so auf seinem eigenen Grundstück zur Kritik ausgestellt, und die Eingeborenen<br />
gehen in Gruppen von Garten zu Garten, bewundern, vergleichen und loben die besten Ernteresultate.<br />
Man mag die Bedeutung der Präsentation der Feldfrüchte daran ermessen, daß es in alter Zeit, als<br />
die Macht des Häuptlings noch weit beachtlicher war als heute, <strong>für</strong> den, der nicht selbst von Rang war<br />
oder in den Diensten eines Mannes von Rang stand, gefährlich war, Früchte zu zeigen, die im Vergleich<br />
mit denen des Häuptlings zu vorteilhaft abgeschnitten hätten.« (Ibid.: 89, vgl. auch Malinowski 1935)<br />
185 Eine Übersicht des Forschungs– und Diskussionsstands findet sich in der eben zitierten<br />
Zusammenstellung von Leach & Leach.
Tausch und Eigeninteresse 111<br />
gument kann demnach die Existenz des Kula nicht begründen, da der Handel ganz<br />
offenbar des Kula nicht bedarf. 186 Das zweite Argument läuft leer, da der Statuswettbewerb<br />
auch auf andere Weise ausgetragen, Prestige auf andere Art erlangt<br />
werden kann und in anderen Bigman-Gesellschaften auch wird (siehe unten). Das<br />
dritte Argument schließlich beschreibt eher den Modus der Bildung und Aufrechterhaltung<br />
intertribaler Allianzen, als daß es die Frage nach dem "warum" klären kann.<br />
Es wäre meines Erachtens verfehlt, diese einzelnen Argumente gegeneinander ausspielen<br />
zu wollen, denn sie stehen offensichtlich in komplementären Verhältnis zueinander.<br />
Zum Beispiel könnte man sagen: der (nützliche) Handel wird ermöglicht<br />
durch den Frieden der (nutzlosen) Gabe, wobei der Gabentausch gleichzeitig den<br />
Statuswettstreit ermöglicht; oder (in einer anderen möglichen Lesart): der vorgängige<br />
Handelsfrieden ermöglicht auf Grundlage der bestehenden intertribalen Beziehungen<br />
das Kula als Medium des Wettstreits um Prestige. Auch bezogen auf den<br />
"Kula-Komplex" sollte man Durkheims Diktum ernst nehmen, wonach das Ganze<br />
mehr ist als die Summe seiner Teile.<br />
In dieser Hinsicht ist auch Anette Weiners prominente Interpretation des Kula reduktionistisch,<br />
da sie das Kula primär als Prestigewettstreit begreift. Ich will ihre<br />
diesbezüglichen Ausführungen im folgenden dennoch recht ausführlich nachzeichnen,<br />
da sie zum einen vorzüglich die Mechanismen des Kula erläutert, und zum anderen<br />
bei Weiner die Beschränktheit einer einseitigen Interpretation "primitiver"<br />
<strong>Institut</strong>ionen, welche den ethnozentristischen Blickwinkel nicht völlig abzuschütteln<br />
vermag, beispielhaft zum Ausdruck kommt. Weiner (die die Trobriand-Inseln 50<br />
Jahre nach Malinowski besuchte, um dessen Ethnographie zu reexaminieren), will<br />
anhand des Kula aufzeigen, inwieweit die "klassischen" Theorien des Tauschs mittels<br />
einer ahistorischen Mystifizierung der Reziprozitätsnorm sowohl die dem Tausch innewohnende<br />
politische Dynamik als auch die ihm zugrunde liegenden (in der Ungleichheit<br />
der Geschlechter wurzelnden) Machtstrukturen verschleiern. Mit anderen<br />
Worten: ihr Erkenntnisinteresse gilt schwerpunktmäßig den von den Tauschenden<br />
verfolgten Interessen (vgl. Weiner 1992: 17). Wie Malinowski befaßt sich auch<br />
Weiner mit "subjektivem Verlangen". Aber anders als dieser, der »kulturelle Bedeutung<br />
in subjektivem Verlangen zu finden suchte« (Weiner 1976: 211), 187 will sie<br />
»die Objekte des Tauschs als die symbolischen Repräsentationen des eigenen Denkens<br />
der Trobriander deuten«. Auf den Trobriand-Inseln, wo der Tausch den Rahmen<br />
abgibt, um den herum die formalen Muster sozialer Interaktion organisiert sind,<br />
186 Außerdem könnte man angesichts gerade dieser Tatsache ebensogut behaupten, es sei überhaupt erst<br />
der Güteraustausch, der das Kula ermögliche.<br />
187 Diese Formulierung spielt auf Malinowkis "Funktionaltheorie" an (vgl. ders. 1939). Für Malinowski<br />
sind gesellschaftliche Phänomene das "natürliche" Ergebnis "natürlicher" Bedingungen. So schreibt er<br />
z.B. zur Frage, warum Tiere und Pflanzen als totemistische Bezeichner eine derart wichtige Rolle<br />
spielen: »Der Weg von der Wildnis zum Magen des Primitiven und infolgedessen zu seiner Seele ist sehr<br />
kurz, und <strong>für</strong> ihn ist die Welt ein neutraler Hintergrund, gegen den sich die nützlichen und vor allem die<br />
eßbaren Spezies der Tiere und Pflanzen abheben.« (1925: 30)
112 Tausch und Eigeninteresse<br />
sind die getauschten Gegenstände hochgradig bedeutungsvoll, »weil sie nach der Art<br />
und Weise ihrer Darbietung — Qualität, Quantität und desgleichen — als Objektivierungen<br />
von Verlangen und Absicht gelesen werden können.« (Ibid.: 211f.) 188<br />
Während Malinowski ihrer Ansicht nach die von ihm beobachteten umfangreichen<br />
und vielfältigen Tauschakte auf die vereinfachte Formel von Gabe und Gegengabe<br />
reduzierte und im Prinzip der Reziprozität die Grundlage der sozialen Beziehungen<br />
in primitiven Gesellschaften sah, enthüllt <strong>für</strong> Weiner ihre eigene Feldforschung<br />
ein dynamisches soziales Handeln von viel größerer Dichte und Komplexität.<br />
»Ethnographische Daten können nicht einfach auf eine einzige semantische Markierung,<br />
die <strong>für</strong> Reziprozität steht, zurechtgestutzt werden«. (Weiner 1992: 2) Malinowskis<br />
Sichtweise erscheint ihr als Ausfluß evolutionärer Vorstellungen von der<br />
"gemeinschaftlichen" Natur der primitiven Ökonomie, ein Relikt des 19. Jahrhunderts.<br />
Weiner richtet ihr Augenmerk weniger auf die Strukturen der Gleichheit als<br />
auf diejenigen der Ungleichheit: Demnach ist der Tausch bei den Trobriandern vor<br />
allem eine bevorzugte Möglichkeit, auf andere Einfluß zu nehmen, sich mit ihnen zu<br />
verbinden in einer Beziehung wechselseitiger Verpflichtung, hinter der sich aber<br />
stets konkrete Interessen des einzelnen verbergen. 189 Im Wettstreit um Rang und<br />
Ansehen ist Reziprozität <strong>für</strong> Weiner nur das äußere Erscheinungsbild der sozialen<br />
Interaktion. Damit stellt sie Mauss' (und auch Lévi-Strauss') Argumentation auf den<br />
Kopf: lagen <strong>für</strong> diese Autoren die Norm der Reziprozität und ein sozialer Zweck den<br />
einzelnen Tauschakten zugrunde, gründet <strong>für</strong> Weiner der Tausch nicht in der Reziprozitätsnorm<br />
und notwendigen wechselseitigen Verpflichtungen, sondern entspringt<br />
dem Eigeninteresse der Akteure. Einer solchen Lesart scheinen die Imperative des<br />
Gabentauschs zunächst völlig zu widersprechen. Weiner hält dem entgegen, daß wer<br />
selbst nicht gibt, auch nichts erhält; <strong>für</strong> den knauserigen Mann legt der Schwager nur<br />
einen kleinen Yamsgarten an, der großzügige hingegen wird reichlich versorgt und<br />
kann seine Yamswurzeln in einem prächtigen Haus zu Schau stellen. »Das Yamshaus<br />
ist ein ... Symbol der Macht eines Mannes [...] wenn ein Mann die Bindung an andere<br />
Männer verliert, muß er daß Symbol dieser Beziehung entfernen und sein Yams-<br />
188 Ein interpretativer Ansatz also, der auf die Intentionen der handelnden Subjekte rekurriert. »Wenn<br />
Tauschakte nur innerhalb einer einzigen Dimension beschrieben werden, d.h. als Transaktionen von<br />
Gabe und Gegengabe, erscheinen die Prozesse sozialer Interaktion vom Ursache-Wirkungs-Prinzip<br />
determiniert. Der Fehler, der hier begangen wird, besteht darin, den Akt innerhalb der Beschränkungen<br />
der Gegenwart zu betrachten anstatt zu analysieren wie die Tauschakte ein System der Regeneration<br />
einschließen, in welchem der temporäre Kontext ... ebensoviel Gewicht hat wie ökonomische und<br />
politische Faktoren.« (Weiner 1976: 220) D.h., die dynamischen Faktoren werden vernachlässigt und<br />
die statischen überbetont. »Was einem Ansatz, der die soziale Natur des Tauschs als eine Form der<br />
sozialen Organisation hervorhebt, zu fehlen scheint, ist das Verständnis des Tauschs als Handeln — ein<br />
Handeln, welches Geber und Empfänger in Spiele der Kontrolle verwickelt, die die reinen Domänen des<br />
Sozialen, Ökonomischen und Politischen überschreitet.« (Ibid.)<br />
189 Weiner betrachtet den Tausch zudem unter dem Aspekt der Kommunikation. Die Trobriander<br />
kommunizieren im Tausch, sie »beurteilen die Gedanken und Gefühle der anderen im Licht des Werts<br />
spezifischer Tauschakte, und sie achten darauf, daß die Disposition, die sie zum Ausdruck bringen<br />
wollen, von den anderen richtig erkannt wird.« (Ibid.: 212) Es geht ihr dabei aber (in Habermas'scher<br />
Terminologie) nicht um kommunikative, sondern strategische Handlungsorientierungen
Tausch und Eigeninteresse 113<br />
haus abreißen.« (Ibid.: 215) 190 Auch beim Kula stellt die Reziprozitätsnorm <strong>für</strong><br />
Weiner nur einen Teil des "offiziellen" Rahmens dar. Primär geht es ihr zufolge gerade<br />
darum, die Norm der reziproken Erwiderung zu "überlisten" in einem Spiel, in<br />
welchem jeder "Spieler" so viel und so wertvolle Muscheln wie nur irgend möglich<br />
anhäufen will.<br />
Das Kula ist Quelle von Prestige, sozialer Hierarchie, und damit politischer<br />
Macht in Gesellschaften ohne — mit Ausnahme der Trobriander — institutionelle<br />
Basis der sozialen Rangunterschiede. Diejenigen, die die größten Erfolge beim Kula<br />
erzielen, werden zu politischen Anführern in ihren Dörfern oder gar zu Abgeordneten<br />
(vgl. Weiner 1988: 148). Wie bereits im 1. Kapitel erwähnt, resultiert der<br />
Ruhm eines Kula-Mannes aus der Verknüpfung seines Namens mit den wertvollsten<br />
Muscheln, die er erlangen konnte. Diese Beziehung ist eine wechselseitige: »So wie<br />
ein Mann Ansehen dadurch gewinnt, daß sein Name zusammen mit bestimmten Muscheln<br />
zirkuliert, gewinnen auch die Muscheln, während sie sich von einem Partner<br />
zum anderen bewegen, auf ähnliche Weise an Wert durch ihre Verbindung mit bestimmten<br />
Männern.« (Weiner 1988: 144) Die Wege, auf welchen die Halsketten<br />
und Armreife von Hand zu Hand wandern, werden Kula-Pfade (Keda) genannt; ein<br />
Begriff, der in der neueren Diskussion der Kula-Strategien eine wichtige Rolle spielt.<br />
Das Keda ist der "Pfad", auf dem die Kula-Wertgegenstände sich bewegen; der Begriff<br />
bezieht sich im doppelten Sinn auf das Band zwischen den Partnern: eine geographische<br />
Verbindung und eine persönliche Beziehung. Zudem sind die Keda Wege<br />
zu Ansehen und Macht: 191 »Das Keda kann als Allianz zwischen Männern aus unterschiedlichen<br />
sozialen Umgebungen gesehen werden, die zusammenarbeiten um die<br />
Macht und den Einfluß jedes der Mitglieder des Keda in seiner eigenen sozialen Umgebungen<br />
zu erhöhen.« (Campbell 1983a: 203) Auch <strong>für</strong> Shirley Campbell ist ein<br />
wesentliches Merkmal des Kula die Rivalität der Teilnehmer untereinander, ein<br />
Wettstreit der aber nicht zwischen den Kula treibenden Gemeinschaften ausgetragen<br />
wird, sondern indirekt innerhalb der jeweiligen Gemeinwesen mittels der Kula-<br />
Partnerschaften eines Keda. Diese Partnerschaften sind allerdings nach Campbell<br />
190 Diese Bindungen sind aber nicht auf alle Zeit fixiert: ein Mann kann <strong>für</strong> seinen Mutterbruder<br />
arbeiten, aber ebenso <strong>für</strong> den Ehemann einer klassifikatorischen Schwester; er hat die Wahl (vgl. Ibid.)<br />
191 »In der abstraktesten Bedeutung bezieht sich Keda auf den Weg (erschaffen durch den Tausch von<br />
Wertgegenständen) zu Wohlstand, Macht und Ansehen <strong>für</strong> diejenigen Männer, die mit diesen<br />
Wertgegenständen umgehen. Keda ist ein vielfältiges Konzept, in welchem die Zirkulation der Dinge,<br />
die Herstellung von Erinnerung und Ansehen und das Streben nach sozialer Distinktion mittels der<br />
Strategien der Partnerschaft zusammentreffen.« (Appadurai 1986b: 18) Eine weitere Konnotation des<br />
Wortes Keda hebt z.B. den "Spiel und Spaß"-Aspekt des Kula hervor. Ein Synonym <strong>für</strong> Kula ist Mwasawa,<br />
was Spaß oder Spiel bedeutet. Dies bezieht sich nach Campbell vor allem auf zwei Aspekte des Kula:<br />
erstens sexuelle Beziehungen zu Frauen in den Partnergemeinden, und zweitens das Segeln im Kanu.<br />
»Alles, was mit dem Ausleger-Kanu zu tun hat; der Bau, die Takelage, der Anstrich und das Herstellen<br />
der Segel wird als "Spaß" betrachtet und in Erwartung der Freuden des Segelns ausgeführt.« (1983a:<br />
204) Die Keda stellen weiterhin Wege <strong>für</strong> den Handel und andere Beziehungen außerhalb des Kula<br />
bereit. »Das Kula wird geschätzt, weil es Gelegenheiten bietet, Handelsbeziehungen aufzubauen, die<br />
eine Kula-Gemeinschaft in die Lage versetzt, exotische Materialien von anderen Kula-Gemeinschaften zu<br />
erlangen.« (Ibid.)
114 Tausch und Eigeninteresse<br />
keine stabilen und lebenslangen (wie Malinowski schrieb; wobei es durchaus möglich<br />
ist, das sich das Kula in den 60 Jahren, die zwischen beiden Untersuchungen lagen,<br />
verändert hat), sondern im Gegenteil relativ instabil. 192<br />
Männer beenden Partnerschaften, bauen neue auf oder reaktivieren alte, wenn<br />
sie die Möglichkeit sehen, ihre persönliche Macht und ihren Einfluß in ihrer Gemeinde<br />
zu vergrößern. Dergestalt ist das Kula der Weg<br />
»zur Unsterblichkeit eines Mannes, sowohl innerhalb seines Gemeinwesens als auch außerhalb.<br />
Wenn ein Mann während seines Lebens erfolgreich einen Keda betreibt, der über mehrere<br />
vollständige Zyklen läuft, erhöht er nicht allein den Wert der Muschel und den Ruhm der<br />
Partnerschaft, durch deren Hände sie geht, auch sein Name bleibt mit der Geschichte der Muschel<br />
verbunden, solange diese im Kula-Ring verbleibt. Unsterblichkeit zu erlangen, ist indes<br />
in keiner Hinsicht ein leichtes Unterfangen, angesichts der Tatsache, daß andere Kula-Männer<br />
ebenfalls das System beeinflussen, um gleiche Ziele zu erreichen.« (Ibid.)<br />
Der Wert der Vaygu'a, der Kula-Wertgegenstände, gründet dergestalt zwar in den<br />
Tauschzyklen, die sie durchlaufen, trotzdem ist nach Weiner »jede einem anderen<br />
Spieler gegebene Kula-Muschel ... ein großer Verlust, weil ihre Geschichte und ihr<br />
Ruhm nicht ersetzbar sind. 193 Aus diesem Grund versucht ein Kula-Spieler, der eine<br />
berühmte Muschel erlangen konnte, diese dem Kreislauf zu entziehen und sie <strong>für</strong><br />
zehn, fünfzehn, oder sogar dreißig Jahre zu behalten.« (Weiner 1992: 133) In einer<br />
Gesellschaft, die ansonsten von Tausch und Gegenseitigkeit durchdrungen ist,<br />
scheint das demnach so etwas wie die Erfüllung zu bedeuten. Daß ein Mann eine<br />
Muschel über Jahrzehnte behält, widerspricht aber ganz eindeutig Malinowskis ethnographischem<br />
Befund. Wie könnte er einen Armreif oder eine Halskette dem<br />
Kreislauf entziehen, ohne als "Hart im Kula" zu gelten und an Ansehen einzubüßen?<br />
An dieser Stelle kommt das <strong>für</strong> Weiners (und auch Campbells) Argumentation zentrale<br />
Konzept der Kitomu ins Spiel, ein Aspekt des Kula, von dem Malinowski nichts<br />
berichtete. Der Begriff bezeichnet Armreife und Halsketten, die persönliches "Eigentum"<br />
ihres Besitzers sind, (noch) nicht im Kula zirkulieren und demnach nicht<br />
mit Verpflichtungen belegt sind. 194<br />
192 Kein Mann auf Vakuta kann eine Partnerschaft mit einem anderen Inselbewohner aufbauen, dies<br />
gefährdete nicht nur die relative Ruhe und Stabilität ihres Gemeinwesens, es würde <strong>für</strong> Campbell auch<br />
die raison d'être des Kula negieren.<br />
193 Um im Kula erfolgreich zu sein, muß ein Mann über umfassende Kenntnisse des Systems und seiner<br />
Möglichkeiten verfügen und in einer Vielfalt von Entscheidungssituationen die richtige Wahl treffen, und<br />
zudem noch ein Quentchen Glück haben. (vgl. Ibid.: 205)<br />
194 Wichtigstes Ziel im Kula ist nach Weiner, die berühmtesten der Halsketten und Armreife zu<br />
erlangen und dann zu "behalten"; der ganze beständige Fluß weniger bedeutsamer Halsketten und<br />
Armreifen dient lediglich dazu, die Wege offen zu halten. Campbell vertritt im Unterschied zu Malinowski,<br />
der schrieb, daß die Vaygu'a »ein höchstes Gut an sich, nicht aber austauschbaren Besitz, ein<br />
Schmuckstück oder gar ein Machtinstrument darstellen.« (1922: 551), die Auffassung, Armreife und<br />
Halsketten seien sehr wohl konvertierbar. Auf Vakuta können diese Wertgegenstände in das interne<br />
Tauschsystem einführt werden und so andere Formen von Reichtum wie "Yams, Magie, Land und<br />
Frauen" sichern oder beschaffen. Kitoumu können demnach zum Beispiel <strong>für</strong> zeremonielle Zahlungen<br />
bei Hochzeiten und Begräbnissen benutzt werden, oder um einen Kanubauer zu "entlohnen". Man kann<br />
sie auch gegen Schweine oder Yams tauschen. Männer aus Kiriwina reisen häufig mit Yams nach
Tausch und Eigeninteresse 115<br />
»Wenn der Besitzer einer großen Kitomu sie in den Kreislauf des Kula einführen will, kann er<br />
mit Glück und Geschick neue Partner und schließlich neuen Reichtum gewinnen. Die Zirkulation<br />
der Kitomu im Kula unterscheidet sich von anderen Kula-Transaktionen, und aus diesem<br />
Grund ist es extrem profitabel, aber auch gefährlich, eine Kitomu-Muschel zu besitzen, speziell<br />
eine große. [...] Hochrangige Kitomu-Muscheln sind der Schlüssel zu den Gewinnen die in einem<br />
guten Kula-Spiel gemacht werden können und den Gefahren, denen begegnet werden<br />
muß. Der schwierigste Schritt bei der Zirkulation einer Kitomu-Muschel ist die Installation<br />
ihres speziellen Pfades, weil der Pfad öffentlich vom Wert der Muschel kündet und unter Umständen<br />
vom Talent und Ruhm ihres Besitzers.« (Ibid.: 149f.) 195<br />
Weiner beschreibt diese Transaktion mit einem Beispiel: »Als Bunemiga mit zehn<br />
Körben Yams nach Kaileunea fuhr und mit einem sehr großen Armreif zurückkehrte,<br />
waren drei Männer aus Sinaketa ... daran interessiert, diese Muschel zu erwerben.<br />
Jeder gab ihm eine kleine Halskette« (Ibid.: 150) — um ihr Interesse zu bekunden<br />
und Bunemiga zu bewegen, ihm die Kitomu zu überlassen. Bunemiga gab diese Halsketten<br />
an Kula-Partner auf Kitava weiter, behielt aber zunächst seine Kitomu. Er befand<br />
sich in einer vorteilhaften Situation, denn er besaß etwas, was die anderen begehrten<br />
und konnte sie gegeneinander ausspielen, d.h. darauf spekulieren, daß sie ihr<br />
Interesse noch stärker bekunden würden: mit Geld, Nahrung, weiteren Vaygu'a.<br />
»Monate später sandte Bunemiga zweien der Männer, die ihm eine Halskette gegeben<br />
hatten, einen Armreifen als Abschlußgabe. Als sie die Armreife erhielten, wußten<br />
sie, daß sie nicht auserwählt waren.« (Ibid.) Bunemiga gab den Kitomu-Armreif<br />
einem Sinaketer mit einem "starken" Kula-Partner auf Gumasila. Nach einem halben<br />
Jahr erhielt Bunemiga über diesen Weg eine schöne Halskette, die nun sein Kitomu<br />
war. 196<br />
Damit begann das Spiel von neuem, und zwar mit Männern auf Kitava, von<br />
denen Bunemiga nach gewisser Zeit ebenfalls einen auswählte, dem er die Kitomu-<br />
Halskette übergab; 197 in der Hoffnung, daß seine Halskette einen berühmten Armreif<br />
"anziehen" würde. Von Zeit zu Zeit schickte der Kitaver Bunemiga Wertgegenstände,<br />
Vaga und Basi (mit den ersteren konnte er sich die Wartezeit mit etwas Kula<br />
vertreiben), um ihm zu signalisieren, daß er nach einer adäquaten Erwiderung suchte.<br />
Damit stellte er sicher, daß Bunemiga ihm weiterhin vertraute. Nach acht Jahren<br />
empfing Bunemiga schließlich einen großen Armreif von dem Partner auf Kitava, als<br />
Kaileunea, um dort hergestellte Armreife zu erwerben, die dann zu ihren Kitomu werden. Ähnliches gilt<br />
<strong>für</strong> die Einwohner von Muyua und Tubetube, die seetüchtige Kanus bzw. Schweine gegen diese Kitomu<br />
tauschen. Die Bewohner der Rossel-Insel veräußerten sie in den 70er Jahren bereits gegen Geld (vgl.<br />
Campbell 1983a).<br />
195 Seit der Unabhängigkeit im Jahr 1973 versuchen junge Trobriander ihre politischen Karrieren durch<br />
den Eintritt in das Kula zu befördern.Sie kaufen Halsketten <strong>für</strong> mehrere hundert Dollar weil »sie<br />
glauben, daß alles was sie brauchen, ein großer Wertgegenstand ist. Aber sie verlieren ihn schnell, weil<br />
sie vergessen "daß Kula viel Arbeit beansprucht — die ganze Zeit mußt du dich um deine Freunde kümmern.<br />
Die Jungs verstehen diese Arbeit nicht."« (Ibid.) — so ein Informant Weiners.<br />
196 »Bunemigas ursprünglicher Armreif ist nun die Kitomu seines Partners auf Gumasila, der seine<br />
eigene Kitomu-Halskette <strong>für</strong> diesen Armreif gab. Er kann sie als seinen Besitz behalten oder sie jederzeit<br />
in einen anderen Kula-Pfad einführen.« (Ibid.: 152)<br />
197 Damit begründete er gleichzeitig einen neuen Kula-Pfad: »Nachdem er einmal eine Kitomu in jede<br />
Richtung gesandt hatte, werden sich noch viele Muscheln auf diesem Pfad bewegen.« (Ibid.: 152)
116 Tausch und Eigeninteresse<br />
Gegengabe <strong>für</strong> die Kitomu-Halskette. Zusammen mit dem Armreif wurde Bunemiga<br />
eine zusätzliche Muschel gesandt, kunivilevila genannt. Sie war eine Art Ertrag <strong>für</strong><br />
Bunemiga. Sein Partner auf Kitava schickte ihm diese Muschel, weil der Kula-Pfad so<br />
gut funktioniert hatte und er ihn vor dem Absterben bewahren wollte, wo doch nun<br />
jede Schuld beglichen war. Auch Bunemigas Partner auf der anderen Seite, also in<br />
Sinaketa und auf Gumasila waren nicht untätig. Bereits als die Nachricht zirkulierte,<br />
daß ein großer Armreif, der seiner Kitomu-Halskette entsprach, sich auf dem Kula-<br />
Segment von Iwa nach Kitava bewegte, schickten sie ihm mehrere Muscheln zugleich,<br />
um "den Pfad lebendig zu halten" und den neuen Armreif "anzuziehen". 198<br />
Dieser war nun sein Kitomu, »aber weil seine Partner in Sinaketa und auf Gumasila<br />
so hart gearbeitet hatten, wußte Bunemiga, daß sie seinen Armreif wollten.« (Ibid.:<br />
153) Er konnte ihn behalten, oder aber einen neuen Zyklus beginnen.<br />
Dieses "Spiel" ist nicht frei von Risiken. 199 So beschreibt Shirley Campbell, wie die<br />
Abbildung 6: Teil des Kula-Gebiets<br />
Teilnehmer im Rahmen derartiger Transaktionen versuchen, den Tausch zu ihren<br />
Gunsten zu manipulieren, und welche Folgen dies haben kann:<br />
»Den Keda zu wechseln ist eine im heutigen Kula übliche Praxis, von der man sagt, daß sie in<br />
der Vergangenheit <strong>für</strong> viele Tode durch Zauberei verantwortlich war. Wurde eine Muschel<br />
einmal umgeleitet, gibt es <strong>für</strong> die vormaligen Kula-Partner kaum eine Möglichkeit, sie wiederzuerlangen.<br />
So hatte zum Beispiel während eines Besuchs auf Kitava im Mai 1977 ein Vakuter<br />
einen Kitaver erfolgreich überredet, ihm einen Armreif zu geben und damit seinen Keda zu<br />
wechseln. Im September 1977 kam der Kitaver nach Vakuta, um den Armreif zurückzuholen,<br />
198<br />
Es ist nach Weiner beeindruckend zu betrachten, welche Menge an Muscheln auf dem Pfad der<br />
Kitomu zirkuliert.<br />
199<br />
»Das Schicksal der Halskette ist niemals völlig gewiß, denn einer der Partner entlang des Pfades mag<br />
dahingehend beeinflußt werde, die große Kette jemand anderem auf einem anderen Pfad zu geben.<br />
Andere hören von der schönen Halskette und begehren sie. Wenn ein Mann die Muschel "abzweigt",<br />
muß er sehr hart arbeiten, um eine äquivalente Gegengabe <strong>für</strong> diesen Pfad zu finden, ansonsten gehört er<br />
nicht länger zu diesem Pfad.« (Weiner 1992: 152) Das kümmert ihn vielleicht nicht, weil sein "neuer"<br />
Partner ihn mit der Aussicht auf einen besseren Pfad mit mehr Wertgegenständen lockt. In diesem Fall<br />
ist es nur Furcht vor Zauberei, die ihn von Plänen abbringen kann. Die Kitomu sind also nicht<br />
ungefährlich.
Tausch und Eigeninteresse 117<br />
weil seine Partner aus dem alten Keda sich als schwierig erwiesen.« (1983a: 208)<br />
Der Vakuter weigerte sich aber, zu kooperieren. In seiner Verzweiflung versuchte<br />
der Kitaver, den Armreif aus dem Haus zu stehlen, in dem er aufbewahrt wurde. Er<br />
wurde dabei ertappt und nach heftigem Streit der Insel verwiesen. In der öffentlichen<br />
Meinung war der Kitaver <strong>für</strong> den Zwischenfall verantwortlich, er hatte die Situation<br />
wahrscheinlich falsch eingeschätzt. »Er war derjenige, der in seiner Gier seine<br />
alten Partner vergessen und den Armreif umgeleitet hatte, um eine "größere"<br />
Halskette zu erlangen.« (Ibid.) Der Vakuter hingegen hatte sich mit seinem Versuch,<br />
den Kitaver zu überreden, im Rahmen des Kula ganz "normal" verhalten. Wenngleich<br />
(worauf auch Campbell hinweist) einige Punkte der Geschichte im Dunkel<br />
bleiben (z.B. ob mit dem Armreif eine Schuld zu begleichen oder dieser Kitoum<br />
war, und die Partner nur auf die Fortsetzung des Keda drängten), kann eine solche<br />
Umleitung fraglos zu einer Ausweitung des Kula führen — wenn die Partner geduldig<br />
genug sind, Vertrauen besitzen und darauf hoffen, daß ihnen aus dem neuen<br />
Keda ein "größerer" Wertgegenstand zufließt (es sollte sehr verwundern, wenn dem<br />
nicht so wäre, auch wenn Campbell diese Möglichkeit nicht erwähnt). 200<br />
Inwieweit das, was Campbell und Weiner beschreiben, tatsächlich postkoloniale<br />
Phänomene neueren Datums sind, die zur Zeit von Malinowskis Aufenthalt auf<br />
den Trobriand-Inseln noch nicht existierten, kann ich nicht beurteilen. 201 Die Frage<br />
ist <strong>für</strong> die vorliegende Arbeit ohnehin nicht von Bedeutung, da die neueren Analysen<br />
der im Kula von den Tauschenden zur Erlangung von Prestige verfolgten Strategien<br />
letztlich mit der von Malinowski gelieferten Beschreibung kompatibel sind und sie<br />
lediglich präzisieren und ergänzen. Wichtig ist vielmehr, daß auch beim Kula die<br />
Norm der Reziprozität Bedingung der Möglichkeit einer geregelten und damit friedfertigen<br />
Verfolgung des Eigeninteresses der Tauschenden ist, ihres Strebens nach<br />
Prestige, nach Macht, Ansehen und "Unsterblichkeit".<br />
NORM VS. INTERESSE REVISITED<br />
Das Kula ist zweifellos ein Faszinosum, nicht nur <strong>für</strong> die Melanesier. Ob sein Studium<br />
aber zu weitläufigen Verallgemeinerungen berechtigt, scheint mir mehr als fraglich.<br />
Manchmal sind die Dinge so wie sie sind, und »die von Ethnographen gestellten<br />
Fragen nach dem "Warum" ... <strong>für</strong> immer unbeantwortbar.« (E. Leach 1983: 530) 202<br />
200 »Der Grad, in welchem ein Mann seine Kula-Keda manipulieren kann, und damit auch die internen<br />
Tauschnetze durch seinen Wohlstand in Form von Muschel-Wertgegenständen, bestimmt seinen Status<br />
im Machtspiel der örtlichen Politik.« (Campbell 1983a: 203)<br />
201 Dies gilt insbesondere <strong>für</strong> die Kitoumu, die offenbar veräußerlich sind. Unter Umständen wurde<br />
diese Entwicklung, wie Chris Gregory meint, begünstigt durch die Tatsache, daß auf einigen Inseln der<br />
Tourismus die Herstellung von Muschelketten und Armreifen zum Zweck des Verkaufs stimulierte (vgl.<br />
1983: 108)<br />
202 Edmund Leach merkt zur Diskussion der raison d'être des Kula an: »Wenn ich ein Paar von<br />
Schachspielern beobachte und bemerke, daß dann und wann ein Tausch von Bauern, weiß <strong>für</strong> schwarz,<br />
oder vielleicht ein weißer Läufer <strong>für</strong> einen schwarzen Springer stattfinden, ist es unangemessen zu
118 Tausch und Eigeninteresse<br />
Die Trobriander spielen schließlich nicht nur Kula, sondern auch Cricket, mit einigen<br />
aufschlußreichen Abweichungen vom englischen Vorbild. 203 Europäer spielen<br />
Fußball. Und auch wenn sich fraglos viele persönliche Dramen an diesen Sport knüpfen<br />
— und er in der spezifischen Form seiner <strong>Institut</strong>ionalisierung ein durchaus interessantes<br />
und der wissenschaftlichen Untersuchung würdiges soziologisches und psychologisches<br />
Phänomen ist —, käme wohl niemand ernsthaft auf den Gedanken, das<br />
Fußballspiel zum Sinnbild des "menschlichen Dramas" erheben zu wollen. Das Kula<br />
ist, wie die anderen hier skizzierten Formen des wettstreitenden Tauschs, dergestalt<br />
meines Erachtens primär Beleg <strong>für</strong> die Vielfalt der Tauschmuster in "primitiven" Gesellschaften,<br />
und zeigt in dieser Hinsicht lediglich auf, daß erstens der Gabentausch<br />
weder frei von Eigeninteresse noch ein ökonomisches Nullsummenspiel sein muß,<br />
und daß zweitens auch die Norm der Reziprozität nicht allein vorschreibt, sondern<br />
auch befähigt. Einige Autoren führt die ethnographische Evidenz allerdings zu sehr<br />
viel weitreichendere Schlußfolgerungen. So postuliert Anette Weiner, wie bereits<br />
erwähnt, einen ursächlichen Zusammenhang von Reziprozitätsnorm und individuellem<br />
Eigeninteresse. Sie schreibt:<br />
»Ohne die logisch vorrangige Obligation der Reziprozität könnte es keine Investition geben,<br />
kein Risiko und so weiter. Die Möglichkeit, das System zur Beförderung des Eigeninteresses zu<br />
benutzen, ist im Ganzen bedingt durch die Norm der Reziprozität. [...] Aber logischer Vorrang<br />
impliziert nicht notwendig eine zentrale Stellung in der Struktur. Normen der Reziprozität<br />
existieren nicht außerhalb der Mitglieder einer Gesellschaft und auch nicht vor diesen. Im<br />
Gegenteil, Normen müssen ständig ausgehandelt und neu verhandelt werden mit den Begründungen<br />
und Rechtfertigungen, die spezifische Handlungen umgeben. Logischer Vorrang dient<br />
den Zwecken der Argumentation, weil Normen nur in konkreten Fällen der Befolgung oder<br />
Nichtbefolgung eine Rolle spielen. Um ihre individuellen Ansprüche abzusichern, verschleiern<br />
Menschen ihr Eigeninteresse durch die Argumentation, daß jedes Scheitern der reziproken<br />
Erwiderung in einem speziellen Fall einer Gegennorm des Eigennutzes den Vorrang verleihen<br />
fragen: "warum passiert das?". Es ist einfach so, daß dies die Art und Weise ist, auf die das Spiel gespielt<br />
wird, jede Partei hat einer unterschiedliche Einschätzung der wahrscheinlichen weiteren Entwicklung<br />
des Spiels. Und wenn man sagt: "Aber warum wird Schach so gespielt?" ist die einzig mögliche Antwort<br />
eine, die sich auf die Historie bezieht: das moderne Schachspiel entwickelte sich vor langer Zeit aus<br />
anderen irgendwie schachähnlichen Spielen, nicht weil es besonders effizient <strong>für</strong> einen bestimmten<br />
Zweck war, sondern weil die Menschen der Ansicht waren, daß es Spaß macht, es zu spielen. Heutzutage<br />
gelangen große Schachspieler zu internationalem Ansehen, aber daß ist nicht der Grund da<strong>für</strong>, daß sie<br />
Schach spielen!« (Ibid.)<br />
203 Von dem Glauben an die zivilisatorische Kraft dieses Sports durchdrungen, führten englische<br />
Missionare das Spiel zu Beginn des Jahrhunderts auf den Trobriand-Inseln ein. Die Eingeborenen<br />
adaptierten es tatsächlich recht schnell und paßten es an ihre Gegebenheiten und Bedürfnisse an. Ein<br />
ebenso hinreißender wie beeindruckender Dokumentarfilm von Jerry Leach mit dem Titel "Trobriand<br />
Cricket" zeigt ein solches Cricket-Match, das zwischen zwei Mannschaften aus benachbarten Dörfern<br />
ausgetragen wurde, den "Aeroplanes" und den "P.Ks". Die "totemistischen" Mannschaftsnamen gehen<br />
auf den 2. Weltkrieg zurück, die U.S.-Streitkräfte unterhielten damals eine Luftwaffenbasis auf den<br />
Inseln. Während die "Flugzeuge" als hervorragende Läufer gelten, sind die "P.Ks" als Fänger berühmt<br />
— "P.K" ist eine (heute fast vergessene) Kaugummimarke —, ihr Schlachtruf lautet "sticks like glue!".<br />
Das Spiel wird mit einigen kriegerisch anmutenden Zurschaustellungen der Teams eröffnet, die das<br />
Spielfeld nicht etwa in weißer Kleidung, sondern in vollem Kriegsputz betreten und Tänze und Gesänge<br />
zum besten geben. Ich will nicht weiter auf die Variationen des Spiels eingehen, sondern nur ein Detail<br />
hervorheben: es gehört zum guten Ton, daß die Gastmannschaft verliert. Das gibt nicht nur beiden<br />
Teams Gelegenheit, sich als "wahrer" Sieger zu fühlen, es beugt auch möglichen Streitereien vor.
Tausch und Eigeninteresse 119<br />
könnte. Darum liegt es im Interesse des Tauschpartners, die Norm aufrecht zu erhalten, damit<br />
er selbst zu einem späteren Zeitpunkt einen Vorteil hat.« (1992: 222)<br />
Für Weiner, die sich nicht damit begnügt, den befähigenden Charakter der Reziprozitätsnorm<br />
hervorzuheben, muß diese demnach nicht nur mit dem Interesse der<br />
Handelnden korrespondieren, um befolgt zu werden; die zitierte Passage legt zumindest<br />
nahe, daß die Norm dem Streben der Individuen nach Absicherung ihrer eigennützigen<br />
Bestrebungen nachgerade entspringt. Die <strong>Institut</strong>ion wäre somit Resultat<br />
strategischer Handlungsorientierungen. Weiners Position ähnelt derjenigen Pierre<br />
Bourdieus, der behauptet,<br />
»daß man eine Regel nur insofern befolgt (wenn sie als solche besteht), als man bedeutend<br />
mehr Interesse daran hat, sie zu befolgen, als sie außer acht zu lassen. Aber auch wenn sich die<br />
Ethnologen zu dem radikalsten Materialismus bekennen, sind sie nur allzu bereit, sich durch<br />
die sorgfältig unterhaltene Zweideutigkeit täuschen zu lassen, durch die jede Gruppe ihr spiritualistisches<br />
Ehrgefühl behauptet, und auf die sie ihre Einheit ideologisch begründet, indem sie<br />
sich selber und den anderen die tatsächlich ihre Praxis beherrschenden Faktoren zu verschleiern<br />
sucht, oder besser gesagt, indem sie zu verschleiern sucht, daß ihre Praxis von Determinismen<br />
und besonders von materiellen und symbolischen Interessen bestimmt wird: Von Regel<br />
und Vorschrift sprechen heißt, glauben und anderen glaubhaft machen, daß man kein anderes<br />
Gesetz kennt als das, was man sich selbst vorgeschrieben hat; das heißt, sich und den anderen<br />
von seinen Beweggründen die ehrenvollste Vorstellung geben, die nämlich, die dem am nächsten<br />
kommt, was sich die Gruppe unter ehrenhaften Beweggründen vorstellt: geeignet, offiziell<br />
dargestellt und öffentlich vorgestellt zu werden.« (1972: 89f.)<br />
Konformes Verhalten, d.h. die Einhaltung gesellschaftlicher Normen, wird von den<br />
Individuen demnach als etwas "Nützliches" betrachtet; nicht (oder zumindest nicht<br />
allein), weil im Fall der Normverletzung Sanktionen drohen, sondern weil die Verhaltensvorschriften<br />
strategisches ökonomisches Handeln ermöglichen. Gleichzeitig<br />
verschleiern eben diese Normen das (ökonomische) Eigeninteresse. Nach Bourdieu<br />
werden in den Gaben tauschenden Gesellschaften ökonomische Beziehungen<br />
»nicht als solche erfaßt und konstituiert, d.h. als Beziehungen, die vom Gesetz des Interesse<br />
sgeprägt werden, sondern sie bleiben immer wie unter dem Schleier der von Prestige und Ehre<br />
geprägten Beziehungen verborgen. Es ist, als ob diese Gesellschaft sich weigerte, sich der ökonomischen<br />
Realität zu stellen, sie als eine Realität zu erfassen, die anderen Gesetzen unterliegt<br />
als denen, die <strong>für</strong> die Familienbeziehungen gelten. Daher erklärt sich auch die strukturelle<br />
Ambiguität jeder Austauschbeziehung: Man spielt immer auf zwei Ebenen zugleich, der des<br />
Interesses, die uneingestanden bleibt, und der der Ehre, die proklamiert wird. Und ist die Logik<br />
des Schenkens nicht eine Form, den rechnerischen Charakter des Interesses zu überwinden<br />
oder zu verschleiern?« (Ibid.: 45f.) 204<br />
204 »Obwohl jede Ehrangelegenheit, wenn sie von außen und als fait accompli, d.h. vom Standpunkt des<br />
fremden Beobachters aus betrachtet wird, wie eine geregelte und absolut notwendige Folge von<br />
unerläßlichen Handlungen erscheint und darum wie ein Ritual beschrieben werden kann, bleibt doch die<br />
Tatsache, daß jedes ihrer Momente, deren Notwendigkeit sich post festum enthüllt, im objektiven Sinne<br />
Resultat einer Wahl und Ausdruck einer Strategie ist. Was man das Ehrgefühl nennt, ist nichts anderes<br />
als die kultivierte Disposition, der Habitus, der jedes Individuum in die Lage versetzt, von einer kleinen<br />
Anzahl implizit vorhandener Prinzipien aus alle die Verhaltensformen, und nur diese, zu erzeugen, die<br />
den Regeln der Logik von Herausforderung und Erwiderung der Herausforderung entsprechen, und<br />
zwar dank eines solchen Erfindungsreichtums, wie ihn der stereotype Ablauf eines Rituals keineswegs
120 Tausch und Eigeninteresse<br />
Man darf den letzten Satz nicht mißverstehen. Wenn im "Schenken" (d.h. Geben)<br />
das Interesse überwunden wird, ist letzteres vorgängig, und das "Schenken" ein Reflex<br />
darauf. Bei Bourdieu erscheint der Gabentausch vor allem als Ausfluß individuellen<br />
Gewinnstrebens. Seine Argumentation gipfelt in der Forderung nach »Aufgabe<br />
der Dichotomie von Ökonomischem und Nicht-Ökonomischem«, 205 weil diese verhindere,<br />
»die Wissenschaft von den ökonomischen Praktiken als einen besonderen<br />
Fall einer allgemeinen Wissenschaft der Ökonomie praktischer Handlungen zu fassen.«<br />
Demnach muß man »alle Handlungen, und selbst noch jene, die sich als interesselose<br />
oder zweckfreie, also von der Ökonomie befreite verstehen, als ökonomische,<br />
auf die Maximierung materiellen oder symbolischen Gewinns ausgerichtete<br />
Handlungen ... begreifen.« (Ibid.: 356f.) Statt "aller Handlungen" hätte er m. E.<br />
besser von "bestimmten Handlungen" gesprochen, die pauschale Verallgemeinerung<br />
erscheint mir mehr als fragwürdig. Was Bourdieu beschreibt und analysiert, mag<br />
zwar <strong>für</strong> die Kabylen gelten — bezogen auf deren Prestigewettstreit sind seine Ausführungen<br />
durchaus instruktiv und scharfsinnig — und auch <strong>für</strong> etliche andere Gesellschaften,<br />
aber nicht zwingend <strong>für</strong> alle (und wahrscheinlich nicht einmal <strong>für</strong> sämtliche<br />
Verhaltensmuster in der von ihm untersuchten Gesellschaft). Das in einer Anzahl<br />
von Kulturen gewonnene ethnographische Material berechtigt keineswegs dazu,<br />
den Gabentausch generell als Ausdruck und Mittel des Ringens um Macht und Einfluß<br />
zu interpretieren, wie es Bourdieu nahelegt, der zur Trennung von Kauf und<br />
Tausch anmerkt:<br />
»Die historischen Situationen, in denen jene Trennung sich vollzieht, die von den instabilen<br />
und künstlich aufrechterhaltenen Strukturen der auf Treu und Glauben beruhenden Ökonomie<br />
zu den eindeutigen und — im Gegensatz zu kostspielig — ökonomischen Strukturen der Ökonomie<br />
des unverschleierten Interesses führt, lassen erkennen, welche Kosten aufgebracht werden<br />
müssen, damit eine Wirtschaftsform funktioniert, die, indem sie es ablehnt, sich als solche zu<br />
erkennen und anzuerkennen, zwangsläufig ebensoviel Geschick und Energie darauf verwenden<br />
muß, die Wahrheit der ökonomischen Akte zu verschleiern wie sie zu vollziehen: Die Verallgemeinerung<br />
der monetären Tauschbeziehungen, die die objektiven Mechanismen der Ökonomie<br />
überhaupt offenlegt, deckt damit auch die eigentümlichen Mechanismen der archaischen<br />
Wirtschaftsform auf, deren Funktion darin liegt, das Spiel des ... ökonomischen Interesses und<br />
Kalküls zu begrenzen und zu verbergen.« (Ibid.: 337) 206<br />
erfordern würde. Mit anderen Worten: Wenn man auch <strong>für</strong> jede Wahl zumindest retrospektiv eine<br />
Erklärung geben kann, so bedeutet das jedoch nicht, daß jede Verhaltensform voll und ganz voraussehbar<br />
wäre, so wie bei einem Ritus die einzelnen Handlungen sich in die völlig stereotypen Sequenzen<br />
einfügen müssen. [...] sogar in den am stärksten ritualisierten Austauschbeziehungen, wo alle Handlungsmomente<br />
und deren Ablauf völlig im voraus festgelegt sind, kann eine Konfrontation zwischen<br />
verschiedenen Strategien durchaus zulässig sein, und zwar in dem Maße, wie die Individuen über das<br />
Intervall zwischen den obligaten Momenten selbst verfügen, also auf den Gegner einwirken können,<br />
indem sie gegebenenfalls das Tempo des Austauschs zu ihren Gunsten modulieren.« (Ibid.: 31)<br />
205 "Ökonomisch" heißt bei Bourdieu vor allem: auf die individuelle Bereicherung ausgerichtet.<br />
206 Abgesehen davon, daß ihre Verallgemeinerungen höchst problematisch sind, leuchtet mir nicht recht<br />
ein, warum sowohl Weiner als auch Bourdieu davon sprechen, daß bei den von ihnen diskutierten<br />
Tauschformen das Eigeninteresse "verschleiert" oder "verborgen" ist. Mir scheint es nur allzu deutlich<br />
zum Ausdruck zu kommen. "Begrenzt" wird es durchaus, teilweise ganz handfest in dem Sinne, daß der<br />
Einzelne sich nur in sehr beschränktem Maße auf Kosten seines Nächsten bereichern kann; deshalb ist es
Tausch und Eigeninteresse 121<br />
Aber was nicht (oder zumindest nicht so) vorhanden ist, muß auch nicht verschleiert<br />
und verborgen werden; wenn die "primitive" Gesellschaft bestimmte Handlungsmuster<br />
vorschreibt, scheint es uns unter Umständen nur so, als würde sie sich anderen<br />
widersetzen bzw. diese damit unterbinden. 207 Man hat es hier mit einem der<br />
nicht seltenen Fälle zu tun, in denen ein Ethnograph aufgrund einiger (ihm aus unserer<br />
Gesellschaft vermeintlich wohlvertrauten) Merkmale der Eingeborenengesellschaft<br />
versucht, ein universelles Prinzip zu konstruieren. Aber dieses Prinzip<br />
wird nicht, wie es scheint, aus dem Material abgeleitet, es wird auf das Material<br />
projiziert. Bourdieu geht von einer gemeinsamen Substruktur aller Gesellschaften<br />
aus. Da die menschliche Natur <strong>für</strong> ihn unwandelbar ist, muß das bei oberflächlicher<br />
Betrachtung Abwesende verborgen, verschleiert oder unterdrückt sein. 208 Aber das<br />
Konstrukt der conditio humana ist, wie Roland Barthes einmal sehr treffend bemerkte,<br />
lediglich Ausfluß einer sehr alten Mystifikation, »die seit jeher darin besteht, auf<br />
den Grund der Geschichte die Natur zu setzen.« (Barthes 1957: 17)<br />
Bourdieu sitzt dergestalt einer klassischen pars-pro-toto Täuschung auf, er<br />
fühlt sich aufgrund der vordergründigen Ähnlichkeiten zwischen "ihnen" und "uns"<br />
zu weitreichenden Gleichsetzungen berechtigt. Sein an sich durchaus verdienstvolles<br />
Unterfangen, die "klassische" Gegenüberstellung von "Primitiv" = Norm versus<br />
"Modern" = Interesse aufbrechen zu wollen, scheitert, weil die Anthropologie des<br />
Eigeninteresses Handlungsmuster aus ihrem Kontext reißt und die tiefgreifenden<br />
Differenzen zwischen den Gesellschaften verwischt. Der von Bourdieu im Rahmen<br />
seiner Analyse der dem (orientalischen) reziproken Tausch zugrunde liegenden Realität<br />
vorgenommene Rückschluß vom Besonderen aufs Allgemeine reproduziert dergestalt<br />
lediglich eine andere (okzidentale) Ideologie, nämlich die in unserer Gesellschaft<br />
vorherrschende Auffassung, welche die unser ökonomisches Handeln fundierenden<br />
sehr spezifischen "Interessen" ontologisiert, d.h. als Teil der menschlichen<br />
aber nicht weniger deutlich sichtbar.<br />
207 »Die "Idolatrie der Natur", die die Konstitution der Natur als primäre Materie und ebenso die Konstitution<br />
des menschlichen Handelns als Arbeit, d.h. als aggressiven Kampf des Menschen gegen die<br />
äußere Natur, verwehrt, sowie die systematische Hervorhebung des symbolischen Aspekts der<br />
Produktionsakte und –verhältnisse zielen darauf ab, die Konstitution der Ökonomie als solcher, d.h. als<br />
von Gesetzen des interessegebundenen Kalküls, von der Konkurrenz oder der Ausbeutung beherrschten<br />
Systems zu unterbinden.« (Ibid.: 336)<br />
208 Demnach hat alles den Anschein, »als beruhe das der "archaischen" Ökonomie Eigentümliche in der<br />
Tatsache, daß das ökonomische Handeln die ökonomischen Zwecke, auf die hin es doch objektiv<br />
ausgerichtet ist, explizit nicht anerkennen könnte.« (Ibid.: 336) Aus dieser Perspektive erscheinen dann<br />
auch Verwandtschaftsbeziehungen als nützlich, d.h. dem eigenen Interesse zuträglich; sie haben nicht<br />
allein eine soziale Funktion: »Sobald man explizit die Frage nach den Funktionen der Verwandtschaftsbeziehungen<br />
stellt oder, direkter, nach dem Nutzen der Verwandtschaftsbeziehungen — eine Frage, die<br />
die Verwandtschaftstheoretiker wohlweislich als geklärt ansehen, vielleicht, weil sie die Frage des<br />
Interesses ins Spiel bringen würde, während man lieber die dezentere Sprache der Regel spricht —,<br />
stellt man zwangsläufig fest, daß der sozusagen genealogische Gebrauch der Verwandtschaft offiziellen<br />
Situationen vorbehalten ist, in denen er die Funktion erfüllt, die gesellschaftliche Welt zu ordnen und<br />
diese Ordnung zu legitimieren; dadurch hebt er sich gegen andere Arten von praktischem Gebrauch der<br />
Verwandtschaftsbeziehungen ab, die wiederum ein besonderer Fall innerhalb der Verwendung von<br />
Beziehungen überhaupt sind (Beziehungen, von denen man sagt, daß man sie hat und pflegt).« (Ibid.: 74)
122 Tausch und Eigeninteresse<br />
Natur deklariert. 209<br />
Um keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen: selbstverständlich ist es im<br />
Rahmen einer gegebenen Gesellschaft wichtig, die Strategien zu analysieren, welche<br />
Individuen, soziale Gruppen oder auch Klassen bei der Verfolgung ihrer jeweiligen<br />
Ziele wählen; zu "verstehen" versuchen, wie im Bewußtsein der Handelnden bestimmte<br />
Handlungen zum angestrebten Zweck führen. 210 Das ist so lange unproblematisch,<br />
wie man sich damit begnügt, die jeweiligen Ziele (und damit die Interessen<br />
und Bedürfnisse) in Relation zu den Handlungsweisen, die in diesem Kontext "geboten"<br />
erscheinen, zu analysieren. Wenn man aber auf ein universalistisches Konstrukt<br />
humanspezifischen Eigeninteresses rekurriert, wird die Fülle, Vielfalt und Flexibilität<br />
der Kulturen dem Dämon der Nützlichkeit geopfert. So erscheint dann selbst Weiners<br />
brillante Analyse des Kula fragwürdig. Sie ist allzu sehr Allegorie auf unsere Gesellschaft:<br />
der Mensch, ohne "Namen" und Geschichte strebt in einem riskanten<br />
Spiel nach Ansehen und Dauerhaftigkeit — und kann dieses Ziel letztlich nie erreichen,<br />
denn die Vaygu'a müssen weiterhin zirkulieren, neue Namen an sich binden,<br />
während die alten verblassen und ins Vergessen treiben. Bedeutsame Differenzen<br />
zwischen uns und ihnen verschwimmen angesichts der Illusion des "ewig Menschlichen",<br />
die Weiner (absichtlich oder unbeabsichtigt) evoziert; die Trobriander werden<br />
uns ein wenig zu vertraut. Letztlich, so scheint es, strebt der Eingeborene nach<br />
den gleichen Dingen wie wir, was ihn zu unserem Bruder im Geiste macht, und sein<br />
Streben und Handeln plausibel, verständlich.<br />
URSPRUNGSMYTHEN<br />
An diesem Punkt scheint es mir geboten, die eben kritisierte Ideologie (wie sie nicht<br />
nur in der bürgerlichen Ökonomie zum Ausdruck kommt, sondern auch in vielen<br />
prinzipiell kritischen Ansätzen ihren Niederschlag findet) näher zu explizieren. Ich<br />
will in diesem Zusammenhang zunächst einige grundlegende Anmerkungen zu dem<br />
in unserer Gesellschaft dominierenden Blick auf das Verhältnis von Individuum und<br />
Gesellschaft machen. Dieser Auffassung zufolge steht das Naturwesen Mensch einer<br />
209 Auch David Cheal kritisiert Bourdieu. Demnach ist dessen Sichtweise auch <strong>für</strong> den Geschenkaustausch<br />
in modernen Gesellschaften unangemessen, es geht bei diesem weniger darum zu<br />
konkurrieren als (emotionale) Bindungen zu bekräftigen: »Das Muster des weihnachtlichen Schenkens in<br />
den anglo-amerikanischen Gesellschaften scheint Bourdieus Austausch-These zu widersprechen, und sein<br />
elegantes Modell zwischenmenschlicher Transaktionen ist nicht geeignet, die beste Basis zum<br />
Verständnis moderner Gabenökonomie zu bieten. Der alternative Ansatz ... versteht diese als rituelle<br />
Ordnung der Anwesenheit oder Abwesenheit oder, in anderen Worten, als Annäherungs– und Vermeidungsrituale.<br />
Der unter diesem Blickwinkel nützlichste konzeptuelle Rahmen ist der von Goffman<br />
entwickelte. [...] Gaben sind Beispiele <strong>für</strong> die Klasse von Ereignissen, die er als "Bindungs-Zeichen" [tiesigns]<br />
titulierte. Das heißt, sie sind Transaktionen die Zeugnis ablegen über die Natur der Beziehung<br />
zwischen Geber und Empfänger. Ein Austausch von Gaben bestätigt üblicherweise, daß eine Beziehung<br />
in einem Rahmen wechselseitiger Anerkennung der sozialen und persönlichen Identitäten der<br />
Teilnehmer verankert ist.« (Ibid.: 22; vgl. Goffman 1971: 262ff.)<br />
210 So ist das Paradigma der politischen Ökonomie zwar <strong>für</strong> die Analyse von Tauschbeziehungen<br />
durchaus angemessen, aber nur in sehr speziellen Fällen.
Tausch und Eigeninteresse 123<br />
Gesellschaft gegenüber, die ihm letztlich fremd und aufgezwungen ist, und nur aus<br />
der Notwendigkeit, der ursprünglichen, immerwährenden und unauslöschlichen<br />
"Lebensnot" (Freud) heraus begründet werden kann. Das Bild eines ewigen und<br />
überzeitlichen "Mangels" als fundamentale Basis der menschlichen Existenz bildet<br />
dergestalt einen Grundstein des landläufigen Verständnisses von Geschichte und Gesellschaft.<br />
Der Mensch als solcher erscheint als doppeltes Mängelwesen: nackt, schutzlos<br />
und seiner Instinkte beraubt, bedarf er einerseits der Kooperation mit anderen, d.h.<br />
der Gesellschaft (sowie technischer Artefakte), um das Überleben zu sichern; andererseits<br />
ist er aufgrund seiner maßlosen und unstillbaren Begierden dem Leben in<br />
dieser Gesellschaft nur schlecht angepaßt. Der fundamentale Mangel an Lebensnotwendigem,<br />
welcher sie zwingt, zusammenzuarbeiten, setzt die Menschen demnach<br />
gleichzeitig notwendig in Widerspruch zueinander; aus diesem Grund müssen<br />
sie Strategien und <strong>Institut</strong>ionen entwickeln, um ihr Zusammenleben zu regeln, das<br />
Chaos zu bannen. 211 Dies ist in etwa der kleinste gemeinsame Nenner jener dem<br />
Selbst(miß)verständnis unserer Gesellschaft zugrunde liegenden Mystifizierung, die<br />
Kultur aus der Natur heraus begründet. 212 Aus dieser Perspektive erscheint Gesellschaft<br />
in toto als Reflex auf "natürliche" Gegebenheiten, als im Rahmen einer<br />
Zweck-Mittel-Relation notwendig und nützlich — kulturelle Muster können folglich<br />
allein als "Überbauphänomene" begriffen werden, die einen gesellschaftlichen<br />
Zweck erfüllen.<br />
Wie ist, ausgehend von Thomas Hobbes' Theorem des Krieges aller gegen alle im<br />
"Naturzustand", Gesellschaft (jenseits der Bande der Familie) überhaupt möglich?<br />
Wie kann bei vermeintlich knappen Ressourcen dieser Krieg vermieden werden?<br />
Derartige, auf die raison d'être des Tauschs zielende Fragen stellte sich nicht erst<br />
Marcel Mauss. Dieser Blick auf sich selbst markiert nach Marshall Sahlins in aller<br />
Deutlichkeit den Unterschied zwischen der westlichen Industriegesellschaft und anderen<br />
Kulturen:<br />
»Soweit ich weiß, sind wir die einzigen, die sich <strong>für</strong> die Nachkommen von Wilden halten. Alle<br />
andren Menschen glauben, daß sie von Göttern abstammen. Das kennzeichnet wohl am besten<br />
den Unterschied. Jedenfalls haben wir aus dieser Vorstellung sowohl eine Folklore wie auch<br />
211 Wäre die "äußere" Natur perfekt, träten diese Mängel der menschlichen Natur nicht zutage. Aber<br />
wir leben nicht im Garten Eden, die verfügbaren Ressourcen sind stets ungenügend und die Lebensnot<br />
somit nicht auflösbar.<br />
212 Menschliches Handeln schließlich wird in dieser Lesart vom Mangel diktiert, es zielt allein auf<br />
Nutzenmaximierung. Sahlins zitiert in diesem Zusammenhang Lionel Robbins' Gegenstandsbestimmung<br />
der Ökonomie: »Wir wurden aus dem Paradies verstoßen. Wir sind weder unsterblich noch verfügen<br />
wir über unendliche Mittel zur Bedürfnisbefriedigung. Wohin wir uns auch wenden, wenn wir ein Ding<br />
wählen, müssen wir auf andere verzichten, auf die wir, unter anderen Umständen, wünschen nicht verzichtet<br />
zu haben. Unzureichende Mittel um Ziele wechselnder Bedeutung zu erreichen ist eine fast<br />
allgegenwärtige Bedingung menschlichen Verhaltens. Hier liegt die Einheit des Gegenstands der Ökonomischen<br />
Wissenschaft: die Formen, die menschliches Verhalten bei der Disposition knapper Mittel<br />
annimmt.« (nach Sahlins 1996: 397)
124 Tausch und Eigeninteresse<br />
eine Wissenschaft gemacht, bisweilen ohne große Unterschiede dazwischen. Die Fortentwicklung<br />
aus einem Hobbes'schen Naturzustand ist der Ursprungsmythos des westlichen<br />
Kapitalismus. Und so wenig, wie Hobbes meinte, daß der Commonwealth die Natur des Menschen<br />
als Wolf gegenüber den anderen Menschen aufhebe, sondern lediglich behauptete, daß<br />
er der Natur erlaube, sich in vergleichsweiser Sicherheit auszudrücken, so halten wir an der<br />
Vorstellung vom Wilden in uns fest, einem Wilden, dessen wir uns ein wenig schämen.«<br />
(Sahlins 1976: 82) 213<br />
Zu der gerade skizzierten Auffassung gesellt sich eine zweite, nicht minder gängige,<br />
die ebenfalls auf den "Nutzen" rekurriert und in der Idee gründet, »menschliche<br />
Kulturen seien der Ausdruck praktischer Tätigkeiten, denen ein utilitaristisches Interesse<br />
zugrunde liege.« (Sahlins 1972: 7) Der »eigentliche Utilitarismus, dessen Logik<br />
die Maximierung von Zweck-Mittel-Relationen ist«, vertritt nach Sahlins die Auffassung,<br />
»daß Kultur ein Sediment der rationalen Tätigkeit von Individuen ist, die ihre<br />
individuellen Interessen verfolgen.« (Ibid.) 214 Damit wäre die Kultur bzw. Gesellschaft<br />
ein Apparat zur Sicherung der individuellen "Bedürfnisbefriedigung". Menschen<br />
finden sich demnach zu Gruppen zusammen und entwickeln soziale Beziehungen,<br />
weil es entweder zu ihrem wechselseitigen Vorteil ist, oder weil sie herausfinden,<br />
daß sie andere Menschen als Mittel <strong>für</strong> ihre Zwecke einsetzen können (vgl.<br />
Sahlins 1996: 398). 215<br />
Die bürgerliche Ökonomie erhob dergestalt die menschlichen Bedürfnisse zu<br />
ihrem Fetisch, indem sie diese, »die ihrem Wesen und Ursprung nach immer gesellschaftlich<br />
und damit objektiv sind« (Sahlins 1996: 401), zur Manifestation einer subjektiven<br />
Erfahrung des Mangels stilisierte. Somit erscheint das Verlangen des Kör-<br />
213 "Ein wenig schämen" ist allerdings ziemlich schwach formuliert angesichts der unterstellten<br />
bestialischen menschliche Natur: homo homini lupus. Seit Gott vom Thron gestoßen war und die<br />
Menschen nicht mehr seine Kinder, stammen sie von Bestien ab — die Fürsten erhalten ihre Autorität<br />
bei Hobbes nicht mehr von Gott sondern aus der Notwendigkeit. Das ist wenig mehr als eine neue<br />
Variante der (Selbst-)Legitimierung repressiver gesellschaftlicher Verhältnisse. Die "Natur" des höchsten<br />
Wesens Mensch muß herhalten <strong>für</strong> die Begründung der Herrschaft des Menschen über den Menschen.<br />
214 Der wiederholte Versuch, individuelle Bedürftigkeit und Gier zur Basis der Soziabilität zu machen,<br />
ist <strong>für</strong> Sahlins eines der »interessanteren Projekte der traditionellen Anthropologie«. Von Machiavelli<br />
und Vico über die Philosophen der Aufklärung und die englischen Utilitaristen bis hin zu deren letzter<br />
Inkarnation, der Chicago School of Economics, reicht die Reihe derer, <strong>für</strong> die das menschliche Eigeninteresse<br />
das fundamentale Band darstellt, welches die Gesellschaft in ihrem Innersten zusammenhält (1996:<br />
398).<br />
215 Diese Version unserer native Theory besagt, »daß das soziale Gebilde der kumulative Ausdruck<br />
individueller Handlungen ist, hinter denen die vorherrschenden Bedürfnisse und Ansichten der<br />
Menschen stehen, welche sich insbesondere aus ihren materiellen Nöten ergeben. Die Gesellschaft ist als<br />
die institutionelle Summe ihrer individuellen Praktiken konstruiert. Der klassische Ort dieser Folklore<br />
ist natürlich der Markt, wo der relative Erfolg der autonomen individuellen Handlungsträger [...] durch<br />
den quantitativen Anteil meßbar ist, der in der öffentlichen Feilscherei auf Kosten beliebiger Personen<br />
errungen wird. Und doch wird dieser Prozeß von den beteiligten selbst als die maximale Befriedigung<br />
ihrer persönlichen Bedürfnisse erlebt. Und da all diese Formen der Bedürfnisbefriedigung — vom Hören<br />
des Chicago Symphony Orchestra bis hin zu einem Ferngespräch — auf die Reduzierung der<br />
unterschiedlichen sozialen Bedingungen und Beziehungen auf ihren kleinsten gemeinsamen Nenner des<br />
finanziellen Aufwands erfordert, um eine rationale Allokation der begrenzten Ressourcen zu gewährleisten,<br />
wird der Eindruck vermittelt, die gesamte Kultur sei durch das geschäftsmäßig-haushalterische<br />
Gebaren der Menschen organisiert.« (Sahlins 1985: 62)
Tausch und Eigeninteresse 125<br />
pers als Quelle der Gesellschaft, und die Kultur als Epiphänomen der Ökonomie<br />
(resp. Gesellschaft). 216 Sahlins' berechtigte und notwendige Skepsis gilt jeder Art<br />
von Erklärung, die auf die materielle Basis zur Erklärung gesellschaftlicher Phänomene<br />
rekurriert. 217 Im Gegensatz zu dem, was die von Sahlins kritisierten Ideologien<br />
behaupten, ist Kultur demnach nicht aus der Natur, sondern nur aus sich selbst heraus<br />
begründbar. 218 Das vermeintlich naturgegebene "Individuum" ist folglich ein gesellschaftliches<br />
Produkt. Wie Louis Dumont schreibt, verkörpert <strong>für</strong> die modernen<br />
Gesellschaften<br />
»jeder einzelne Mensch ... in gewissem Sinn die ganze Menschheit. Er ist das Maß aller Dinge<br />
... Die allgemeinen Ziele fallen mit den legitimen Zielen jedes Menschen zusammen, und auf<br />
diese Weise werden die Werte umgekehrt. Was man noch "Gesellschaft" nennt, ist das Mittel,<br />
das Leben eines jeden ist der Zweck. Ontologisch gesehen gibt es die Gesellschaft nicht mehr,<br />
sie ist nur mehr eine nicht reduzierbare Gegebenheit, von der man verlangt, daß sie sich den<br />
Forderungen nach Freiheit und Gleichheit nicht entgegensetzt. Natürlich geht all dem eine Beschreibung<br />
der Werte, eine verstandesmäßige Betrachtung voran. [...] Eine Gesellschaft, wie<br />
sie der Individualismus sich vorstellt, hat nirgendwo jemals existiert, und zwar ... deshalb, weil<br />
das Individuum von sozialen Vorstellungen lebt.« (1966: 25)<br />
Karl Polanyi merkt zum gleichen Thema an: »Wenn die sogenannten ökonomischen<br />
216 Die Anthropologie des Mangels ist auch in neuesten Veröffentlichungen gegenwärtig: »Das Begehren<br />
ist Ausdruck eines Mangels, und dieser wiederum kennzeichnet die anthropologische Situation. Etwas zu<br />
ermangeln und auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein, dürfte die erste Erfahrung eines jeden<br />
Menschen sein.« (Paul 1997: 445)<br />
217 »Es ist sowohl <strong>für</strong> die bürgerliche wie auch <strong>für</strong> die sog. primitive Gesellschaft evident, daß sich die<br />
materiellen Aspekte nicht sinnvoll von den gesellschaftlichen trennen lassen, so als ob erstere sich auf die<br />
Bedürfnisbefriedigung durch die Ausbeutung der Natur bezögen und letztere auf die Probleme der<br />
Beziehungen zwischen den Menschen.« (Sahlins 1976: 288)<br />
218 Es sollte überflüssig sein, darauf hinzuweisen, daß auch affektive, libidinöse Bande uns verbinden und<br />
den Kitt der Gesellschaft bilden. Was Freuds Konstruktion in "Totem und Tabu" so wertvoll macht, ist<br />
die Hervorhebung der Tatsache, daß Einsicht und rationales Eigeninteresse nicht ausreichen, um die<br />
Individuen dauerhaft aneinanderzubinden. Wie schon David Hume in seinem Traktat über die menschliche<br />
Natur schrieb, tritt »in allen Geschöpfen, die keine Raubtiere sind, und nicht von heftigen Affekten<br />
bewegt werden, ... ein deutliches Bedürfnis nach Gesellschaft zu tage; dies führt sie zusammen, ohne<br />
daß sie jemals irgendwelche Vorteile von ihrer Vereinigung erwarten. Dies springt aber noch mehr in<br />
die Augen bei dem Menschen, demjenigen Geschöpf des Weltalls, das das heißeste Verlangen nach<br />
Gesellschaft hat, und durch viele Vorzüge da<strong>für</strong> am geeignetsten ist. Wir hegen keinen Wunsch, der sich<br />
nicht auf die Gesellschaft bezöge. Vollständige Einsamkeit ist vielleicht die denkbar größte Strafe, die wir<br />
erdulden können. Jede Lust erstirbt, wenn sie allein genossen wird, und jeder Schmerz wird grausamer<br />
und unerträglicher. Welche anderen Affekte uns auch antreiben mögen, Stolz, Ehrgeiz, Geiz,<br />
Neugierde, Rachedurst oder sinnliche Begierde, die Seele, das belebende Prinzip in ihnen allen, ist die<br />
Sympathie. Sie alle hätten gar keine Macht, sähen wir bei ihnen gänzlich von den Gedanken und<br />
Gefühlen anderer ab. Wenn alle Naturkräfte und Elemente sich verbänden, um einem Menschen zu<br />
dienen und zu gehorchen, wenn die Sonne auf seinen Befehl auf– und unterginge, das Meer und die<br />
Flüsse nach seinem Belieben fluteten, wenn die Erde freiwillig alles hervorbrächte, was ihm nützlich<br />
oder angenehm ist, er würde doch elend sein, bis Ihr ihm wenigstens einen Menschen gebt, mit dem er<br />
sein Glück teilen, und dessen Wertschätzung und Freundschaft er genießen kann.« (Hume 1740: 96f.)<br />
Diese "Sympathie" ist <strong>für</strong> Hume »die formale moralpsychologische Bedingung, unter der wir als<br />
Naturwesen gesellschaftliche Wesen sind.« (Ebel 1992: 80) Warum diese »Vergesellschaftung des<br />
Emotionsbegriffs qua Naturalisierung« unzureichend und unbefriedigend ist, ist in Ebels Arbeit nachzulesen<br />
(insbes. 81ff.)
126 Tausch und Eigeninteresse<br />
Motivationen dem Menschen natürlich wären, dann müßten wir alle frühen und<br />
primitiven Gesellschaften als ausgesprochen unnatürlich betrachten.« (1957a: 136)<br />
Nach Polanyi war mit der Industrialisierung geradezu eine »Zwangsbekehrung zu einem<br />
utilitaristischen Weltbild« verbunden, die »zu einer verhängnisvollen Verzerrung<br />
des Selbstverständnisses des westlichen Menschen« führte (1957a: 133). So<br />
wurde »auf überzeugende Weise der Anschein hervorgerufen, daß Hunger und Gewinnstreben<br />
die entscheidenden Triebkräfte sind, auf denen jegliches ökonomische<br />
System beruhen muß.« (Ibid.: 135) 219 Für Polanyi ist das reine Fiktion: »In Wirklichkeit<br />
war der Mensch niemals so selbstsüchtig, wie es die Theorie verlangte.«<br />
(Ibid.: 139) Es ist demnach viel eher so, daß die »Ideologie des Wirtschaftslebens«<br />
ein bestimmtes Verhalten erzwingt. Er fährt fort: »So wie die Nahrungsmittelversorgung<br />
des einzelnen und seiner Familie normalerweise nicht auf dem Motiv des<br />
Hungers beruht, so beruht auch die <strong>Institut</strong>ion der Familie nicht auf dem Sexualtrieb.«<br />
(Ibid.: 142) 220<br />
Das vorstehende Zitat könnte mißverstanden werden und ist deshalb zu präzisieren:<br />
Selbstverständlich existieren einige fundamentale und universelle menschliche<br />
Bedürfnisse, die "naturgegeben" und sowohl materieller als auch immaterieller<br />
Natur sind. Wir benötigen Nahrung, Unterkunft und Schutz (vor wilden Tieren),<br />
ebenso wie wir im Leben nach (sexueller) Befriedigung und Anerkennung streben;<br />
vielleicht haben wir auch ein Grundbedürfnis nach "Ordnung", wie Claude Lévi-<br />
Strauss behauptet. Die menschliche Gesellschaft (bzw. die Kooperation der Menschen<br />
in dieser Gesellschaft) stellt aber üblicherweise all das bereit. Die gerade ange-<br />
219 »Man nehme eine beliebige Motivation und organisiere die Produktion auf eine solche Weise, daß<br />
diese Motivation <strong>für</strong> den einzelnen zum Produktionsanreiz wird, dann hat man damit ein Bild geschaffen,<br />
das den Menschen als von dieser Motivation völlig abhängig darstellt. Man nehme als Motivation die<br />
Religion, die Politik oder die Ästhetik, man nehme den Stolz, das Vorurteil, die Liebe oder den Neid,<br />
und der Mensch wird als essentiell religiös, politisch, ästhetisch, stolz, vorurteilsbehaftet oder von Liebe<br />
und Neid erfüllt erscheinen. Andere Beweggründe werden dann im Vergleich dazu fern und schattenhaft<br />
erscheinen, da sie nicht geeignet sind, den lebenswichtigen Vorgang der Produktion voranzutreiben. Die<br />
jeweils ausgewählte Motivation wird dann den "wirklichen" Menschen repräsentieren.« (Ibid.: 138f.)<br />
220 Polanyi formuliert die Prinzipien der von ihm begründeten "substantivistischen" Ökonomie in<br />
Abgrenzung zur "formalistischen"; es geht ihm dabei aber nicht darum, »die ökonomische Analyse zu<br />
verwerfen, sondern ihre historischen und institutionellen Grenzen festzulegen ... und diese Grenzen in<br />
einer allgemeinen Theorie der ökonomischen Organisation zu überschreiten.« (in<br />
Polanyi/Arensberg/Pearson 1957: xviii). Die entscheidende Differenz wird schon bei der<br />
Gegenstandsbestimmung deutlich: »In seiner substantivistischen Bedeutung leitet sich der Begriff<br />
"ökonomisch" aus der Abhängigkeit her, in welcher Menschen in bezug auf ihren Lebensunterhalt von<br />
Natur und Mitmenschen stehen. Er verweist auf die gegenseitigen Einwirkungen zwischen dem<br />
Menschen einerseits und seiner naturhaften und gesellschaftlichen Umgebung andererseits, insofern<br />
diese Einwirkungen mit seiner materiellen Bedürfnisbefriedigung zusammenhängen. In seiner formalen<br />
Bedeutung leitet sich "ökonomisch" aus dem logischen Charakter einer Zweck-Mittel-Beziehung ab ...<br />
und verweist auf die Grundsituation einer Wahl zwischen verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten<br />
von Mitteln, falls die Notwendigkeit der Wahl dadurch gegeben ist, daß die Mittel nicht zureichend<br />
sind.« (1957b: 243) Für eine vergleichende Untersuchung der Ökonomie in unterschiedlichen<br />
Gesellschaften ist demnach allein der substantivistische Standpunkt angemessen, der von der<br />
institutionellen Einbindung des ökonomischen Handelns in den gesamtgesellschaftlichen Kontext<br />
ausgeht.
Tausch und Eigeninteresse 127<br />
führten "natürlichen" Bedürfnisse sind zudem viel zu unspezifisch, um konkrete<br />
Sachverhalte erklären zu können. Die angeblich invarianten und überzeitlich gültigen<br />
Interessen der Menschen, die bemüht werden, um den historischen Prozeß zu erklären,<br />
sind denn auch viel speziellerer Natur. 221<br />
Das <strong>für</strong> die Menschen in den okzidentalen Gesellschaften der Neuzeit (vermeintlich)<br />
charakteristische Streben nach Macht, Dominanz, nach Akkumulation materieller<br />
Güter, die Habgier und der Drang, sich auf Kosten seines Nächsten zu bereichern<br />
sind viel eher Ausfluß spezifischer gesellschaftlicher Bedingungen als daß sie<br />
aus der menschlichen Natur heraus zu erklären wären. Die psychischen Dispositionen,<br />
von denen Hobbes und Smith ausgehen, sind mithin alles andere als "natürlich"<br />
und universell, sondern ein Spezifikum der Gesellschaft, welcher sie entstammen.<br />
Dennoch dominiert in unserer Gesellschaft eine Auffassung, die das Partikulare und<br />
Kontingente in den Rang einer naturgesetzlichen Zwangsläufigkeit erhebt, was letztlich<br />
dazu führt, die Entwicklung hin zur kapitalistischen Warenökonomie als notwendig<br />
und "natürlich" zu stilisieren und darüber zu legitimieren. Diese Sichtweise<br />
verkennt den Charakter des Gewordenen und vor allem die Tatsache, daß jede Gesellschaftsform<br />
bis zu einem gewissen Grad ihre eigene Anthropologie hervorbringt,<br />
— als soziale Tatsache. Eine solche Einsicht kann im Rahmen von universalisierenden<br />
ethnozentristischen Lesarten von Geschichte und Gesellschaft aber ganz schlichtaber<br />
nicht formuliert werden, denn jede universalistische Position bedarf der Konstruktion<br />
eines "Gattungssubjekts", welches (in) sich über die Geschichte gleich<br />
bleibt; sich an unwandelbaren, ewigen Handlungsimperativen (abstrakt menschlichen<br />
Interessen und Bedürfnissen) orientiert. Ein derartiges Subjekt hat aber niemals<br />
existiert. 222<br />
Die "primitive Gesellschaft" gründet folglich nicht in sublimierten "materialisti-<br />
221 Für Claude Lévi-Strauss ist dieses "Bedürfnis nach Ordnung" sogar die ultima ratio der Kultur. Vielleicht<br />
ist schon bei Freud (der über keine explizite Theorie des Affekts verfügte), das angelegt was Lévi-<br />
Strauss gegen ihn wendet: »Ich leugne die Triebe, die Emotionen, die Aufwallungen der Affektivität<br />
durchaus nicht, räume diesen reißenden Kräften aber keinen Vorrang ein: sie brechen in eine bereits<br />
konstruierte, von mentalen Zwängen aufgebaute Szene ein. [...] Den Durchbrüchen [des affektiven<br />
Geschehens] erlegt ein primitiver Schematismus immer eine Form auf. In ihren spontansten Aufschwüngen<br />
versucht sich die Affektivität Breschen durch die Hindernisse zu schlagen, die ebenso auch<br />
Richtpunkte sind; sie setzen ihr Widerstand entgegen, bezeichnen ihr aber auch mögliche Bahnungen,<br />
deren Zahl sie begrenzen und die unerläßliche Stationen umfassen.« (1985: 322) Im "Ende des Totemismus"<br />
schreibt Lévi-Strauss zu Totem und Tabu: »Umgekehrt zu dem, was Freud vertritt, lassen sich die<br />
positiven und negativen sozialen Zwänge weder hinsichtlich ihres Ursprungs noch hinsichtlich ihrer<br />
Beharrlichkeit durch die Wirkung von Trieben oder Emotionen erklären.« (1962a: 92f.) Der Anwurf<br />
wird schließlich auch gegen Durkheim gewendet: »Die Theorie Durkheims vom kollektiven Ursprung<br />
des Sakralen beruht ... auf einer petitio principii: nicht die augenblicklichen Emotionen, die anläßlich der<br />
Vereinigungen und Zeremonien empfunden werden, zeugen Riten und verleihen ihnen Dauer, sondern<br />
die rituelle Tätigkeit läßt Emotionen entstehen. [...] In Wahrheit erklären die Triebe Emotionen nichts,<br />
immer ergeben sie sich: entweder aus der Kraft des Körpers oder aus der Ohnmacht des Geistes. Sie sind<br />
in beiden Fällen Folgeerscheinungen, sie sind niemals Ursachen.« (Ibid.: 94)<br />
222 Eine solche Konstruktion ist notwendig idealistisch (und wohl auch ideologisch), sie ist den<br />
Unterschieden zwischen den Gesellschaften und auch der Geschichte gegenüber blind. Selbst wenn man<br />
z.B. zugesteht, daß alle Menschen zu allen Zeiten dem Lust/Unlust-Prinzip folgten, sagt das noch lange<br />
nichts über das Wesen ihrer "Lust".
128 Tausch und Eigeninteresse<br />
schen" Impulsen oder der notwendigen Unterdrückung dieser Impulse in Ermangelung<br />
von Staat und Markt. Das Hobbes'sche Dilemma, d.h. der hypothetische "Urzustand",<br />
hat entweder nie existiert oder war immer schon überwunden. Was nicht<br />
heißt, daß das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft unproblematisch wäre;<br />
Menschen müssen zusammen leben und arbeiten, was notwendig zu Reibungen und<br />
Interessenkonflikten führt, schon bevor sich in der Gesellschaft konfligierende Interessengruppen<br />
und Machtstrukturen herausbilden. Das Verhältnis des Menschen zur<br />
Gesellschaft dürfte aber weder grundlegend affirmativ noch notwendig feindselig<br />
sein; Menschen sind ganz einfach gesellschaftliche Wesen, der Mensch ist ohne Gesellschaft<br />
nicht denkbar. 223 Die Gesellschaft ist Teil der menschlichen Natur, sie ist<br />
das Gegebene, von der jede soziologische Erklärung auszugehen hat. Da der Mensch<br />
die Bühne der Geschichte (bzw. Vorgeschichte) als gesellschaftliches Wesen betreten<br />
hat und jedes Neugeborene die Welt als solches betritt, ist die Gesellschaft sowohl<br />
aus phylogenetischer als auch ontogenetischer Perspektive historisch vorgängig; ihr<br />
kommt aber auch systematisch der Vorrang zu, da erst die Kultur dem Menschen<br />
ermöglicht, sich als Mensch zu denken und auszudrücken, d.h. als Individuum zu erfahren.<br />
Um es in einem Satz zusammenzufassen: Menschliche "Interessen" und "Bedürfnisse"<br />
erklären nichts, sie sind vielmehr dasjenige, was der Erklärung bedarf — immer<br />
dann, wenn sie innerhalb einer Gesellschaft zur dominanten, das Handeln bestimmenden<br />
institutionalisierten Form werden. 224 Die Rede vom angeblich überzeitlichen<br />
und unwandelbaren Charakter der <strong>für</strong> unsere Gesellschaft charakteristischen<br />
menschlichen "Interessen" und (grenzenlosen) "Bedürfnisse" — d.h. der vermeintlichen<br />
conditio humana —, die Vertauschung von Ursache und Wirkung, dient<br />
vor allem der Selbstrechtfertigung einer Gesellschaft, die offenbar meint, sich über<br />
ihre Nützlichkeit legitimieren zu müssen und infolgedessen diese Nützlichkeit mystifiziert.<br />
225 Auf das Kula bezogen heißt dies: man kann eine derartige <strong>Institut</strong>ion nicht<br />
223 Die Tatsache, daß es die Kultur ist, welche die sozialen Beziehungen definiert und ihnen Bedeutung<br />
verleiht, impliziert nicht, daß es jenseits der Kultur bzw. vor der Kultur kein Zusammenleben, keine<br />
Zusammenarbeit und (am wichtigsten von allen) keine Gegenseitigkeit gab. Wohlgemerkt: auch Wölfe<br />
leben in Gruppen, ebenso wie Affen und Graugänse, weshalb Biologen und Verhaltensforscher davon<br />
sprechen, sie lebten in "Gesellschaft". Aber im Unterschied zu derjenigen der madegassischen Lemuren,<br />
die offenbar auch in "Horden" leben und "Exogamie" praktizieren, beginnt die menschliche Gesellschaft,<br />
und damit Kultur, in dem Augenblick, in welchem sie gedacht wird. Und da dieses Denken ein<br />
notwendig diskursives ist, bedarf es der Sprache, die wiederum Kultur und menschliche Gesellschaft<br />
ermöglicht.<br />
224 In dieser institutionalisierten Form können Interessen und Bedürfnisse selbstverständlich zu mächtigen<br />
Triebkräften werden und damit zum Ausgangspunkt historischer und soziologischer Erklärungen.<br />
Diese bleiben aber unvollständig, solange sie den Prozeß der <strong>Institut</strong>ionalisierung der Interessen<br />
nicht mit reflektieren.<br />
225 Die weniger wissenschaftliche denn legitimatorische neoklassische Ökonomie steht ganz und gar im<br />
Dienst dieser Mystifikation. Ihre Analysen »verdienen kritische Aufmerksamkeit ... wegen ihrer ...<br />
politischen Bedeutung: Sie werden häufig genutzt, um die theoretische Rechtfertigung einer hochgradig<br />
fragwürdigen Entwicklungspolitik zu liefern.« (Gregory 1982: ix) Die orthodoxen Theorien sind
Tausch und Eigeninteresse 129<br />
aus einem dem Menschen als Gattungswesen eigenen Streben — sei es nach Prestige,<br />
sei es nach materiellen Gütern — heraus erklären. Viel eher ist es das Kula, welches<br />
dieses Streben institutionalisiert. Zumindest ist es Teil jenes institutionellen<br />
Rahmens, innerhalb dessen der zeremonielle Austausch von Armreifen und Halsketten<br />
möglich und gleichzeitig bedeutungsvoll ist. Von daher dürfte auch eine Diskussion<br />
der gesellschaftlichen Funktion des Kula und aller anderen Formen des "wettstreitenden<br />
Tauschs" nur bezogen auf die beteiligten Kulturen Sinn machen und sollte<br />
keinesfalls zu vorschnellen Generalisierungen führen. 226<br />
demnach weniger be– als vorschreibend. »Die Ökonomen ... haben zu oft versucht, die Welt zu<br />
verändern, ohne sie zu verstehen.« (M. Lipton, Why people stay poor, nach Ibid.)<br />
226 Die Frage, welches humanspezifische Potential dem Streben nach Prestige unter Umständen<br />
zugrunde liegt, ist diesen Zusammenhang zweitrangig, denn wenn überhaupt, muß dieses Potential nicht<br />
dergestalt institutionalisiert werden.
6. Kapitel<br />
DIE DINGE DES LEBENS<br />
»Die Geschichte des natürlichen Menschen weckte die Träume der<br />
Philosophen; sie beschenkten ihn, wie den theologischen Gott, mit<br />
widersprüchlichen Attributen, stritten um sein Wesen, vergossen<br />
ein Meer an Tinte und erklärten nichts.« (Deslisle de Sales)<br />
Mißt man sie allein an der Menge und Vielfalt der produzierten und zirkulierenden<br />
Güter, d.h. an ihrem materiellen Reichtum, erscheinen die Gabenökonomien im<br />
Vergleich zur "entwickelten" Marktwirtschaft als einigermaßen armselig und defizitär.<br />
Auch wenn der Gabentausch insofern "ökonomisch" sein mag, daß er ein gesichertes<br />
Wirtschaften ermöglicht, der soziale also immer auch auf einen ökonomischen<br />
Zweck verweist, ist er bezogen auf letzteren doch vermeintlich "gehemmt". 227<br />
Diese Rückständigkeit der "Primitiven" scheint aus mächtigen Zwängen zu resultieren,<br />
welche die Verfolgung des Eigeninteresses einschränken, um die soziale Ordnung<br />
aufrecht zu erhalten. Der Triumph der Marktökonomie gründet aus diesem<br />
Blickwinkel heraus in einer Versöhnung von Eigeninteresse und sozialer Ordnung,<br />
welche die "Primitivität" historisch überwand.<br />
Eine derartige Lesart, welche die Unterschiede zwischen "ihnen" und "uns"<br />
allein auf Grundlage von erzwungenem Verzicht und ermöglichter Erfüllung zu bestimmen<br />
sucht, gründet nicht nur in einer höchst fragwürdigen Ontologisierung<br />
menschlicher Interessen, sie hat auch eine ideologische Funktion: Sie soll verschleiern,<br />
daß die bürgerlich-kapitalistische Ökonomie mindestens ebenso mächtige<br />
Zwänge auf diejenigen ausübt, die an ihr partizipieren (müssen) wie die "primitive<br />
Gesellschaft". Diese Zwänge sind allerdings abstrakter Natur und scheinen der<br />
Marktökonomie quasi naturgesetzlich (als "Sachzwänge" eben) innezuwohnen. Daher<br />
sind sowohl ihr gesellschaftlicher Ursprung als auch ihre Wirkungsweise kaum<br />
noch kenntlich. Um beides aufzuzeigen, werde ich mich im folgenden zunächst mit<br />
einigen Determinanten und Konsequenzen der Warenwirtschaft befassen.<br />
Vorab scheint mir allerdings noch eine wichtige Anmerkung geboten: Die Verwendung<br />
der Begriffe "Marktökonomie" oder "Warenwirtschaft" zur Charakterisierung<br />
einer Wirtschafts– oder Gesellschaftsform macht erst dann Sinn, wenn der Markt die<br />
Tauschbeziehungen dominiert. Es besteht dabei eine wichtige Differenz zwischen<br />
Marktplatz und Markt. Ebensowenig, wie jede Form der arbeitsteiligen Spezialisierung<br />
notwendig Warenproduktion ist, werden auf jedem Markt Waren getauscht.<br />
Während der Begriff bei uns zweierlei meint, einen abstrakten Raum ("Arbeitsmarkt",<br />
"Weltmarkt") und einen konkreten Ort ("Wochenmarkt", "Markthalle"),<br />
ist der Markt in anderen Gesellschaften nur in letzterer Ausprägung vorhanden:<br />
227 Gleiches gilt <strong>für</strong> die vermeintliche kognitive Rückständigkeit dieser Gesellschaften. Man ist versucht<br />
die "Grundformen" des Tauschs, d.h. Gabentausch, redistributiven Tausch, Warenaustausch in einer<br />
aufsteigenden Linie analog der postulierten Abfolge von Magie, Religion und Wissenschaft anzuordnen,<br />
die Gegenstand des zweiten Teils dieser Arbeit ist.
Die Dinge des Lebens 131<br />
»Märkte gibt es in allen Gesellschaften, und die Gestalt des Kaufmanns ist in vielen<br />
Zivilisationstypen bekannt. Indessen verbinden sich isolierte Märkte nicht zu einer<br />
Volkswirtschaft. [...] Vor dem zweiten Viertel des 19. Jahrhunderts waren Märkte<br />
zu keiner Zeit mehr als bloß untergeordnete Aspekte der Gesellschaft.« (Polanyi<br />
1947: 137) Man kann erst dann von Marktwirtschaft sprechen, wenn erstens (fast)<br />
ausschließlich <strong>für</strong> den Markt produziert wird, alle Menschen zweitens auch ihre elementarsten<br />
Grundbedürfnisse (Nahrung, Behausung) auf dem Markt decken müssen,<br />
drittens Arbeitskraft und Grund und Boden käufliche Waren sind, 228 und viertens<br />
der Austausch durch Geld als universelles Äquivalent vermittelt wird.<br />
GÜTER UND WERTE<br />
Die "entwickelte" Marktökonomie ist die fraglos ausgeprägteste Variante einer gesellschaftlichen<br />
Relationierung via Spezialisierung, wobei sich der Zusammenhalt der<br />
differenzierten "Organe" im Tausch der von diesen jeweils erzeugten Güter realisiert<br />
und perpetuiert. Zwischen den arbeitsteilig spezialisierten Produzenten besteht<br />
eine wechselseitige ökonomische Abhängigkeit. Dies gilt zwar in gewissem Maße<br />
auch <strong>für</strong> einige der vorstehend aufgeführten "primitiven" Handelssysteme, es wäre<br />
aber absolut verfehlt, "primitiven Handel" und Marktaustausch in einem gemeinsamen<br />
Kontinuum plazieren zu wollen. Angesichts der tiefgreifenden Differenzen zwischen<br />
"ihnen" und "uns", d.h. zwischen Gabentausch und Warenaustausch, erscheinen<br />
die Ähnlichkeiten als höchstens sekundäre Merkmale.<br />
Um diese Unterschiede darzustellen, will ich zunächst kurz an die von Karl<br />
Marx' im ersten Band des "Kapital" vorgenommene Analyse der Warenform anknüpfen.<br />
Als "Gebrauchswert" ist demnach die Ware »zunächst ein äußerer Gegenstand,<br />
ein Ding, das durch seine Eigenschaften menschliche Bedürfnisse irgendeiner<br />
Art befriedigt.« (Marx 1890: 86) In dieser Eigenschaft unterscheidet sich die Ware<br />
nicht von anderen Gütern: »Die Nützlichkeit eines Dinges macht es zum Gebrauchswert.<br />
[...] Der Gebrauchswert verwirklicht sich nur im Gebrauch oder der Konsumtion.<br />
Gebrauchswerte bilden den stofflichen Inhalt des Reichtums, welches immer<br />
seine gesellschaftliche Form sei. In der von uns betrachteten Gesellschaftsform bilden<br />
sie zugleich den stofflichen Träger des Tauschwerts.« (Ibid.: 50) 229 Damit Güter<br />
228 Auf vielen Märkten kann dies nicht erworben werden, deshalb sollte, wie George Dalton nahelegt,<br />
indigener Marktaustausch besser »Marktplatzaustausch genannt werden, um die Abwesenheit des Markts<br />
<strong>für</strong> Arbeitskraft und Land hervorzuheben.« (1962: 75) Nach Polanyi kann »der Aufstieg des Marktes zu<br />
einer vorherrschenden Kraft in der Ökonomie ... zurückverfolgt werden, indem man das Ausmaß<br />
feststellt, in welchem Boden und Nahrung durch Marktaustausch mobilisiert und die Arbeitskraft in eine<br />
Ware verwandelt wurde, die frei auf dem Markt gekauft werden konnte.« (1957b: 255)<br />
229 Aus der derart über den Rekurs auf menschliche Bedürfnisse vorgenommenen Bestimmung des<br />
Gebrauchswerts folgt keinesfalls notwendig deren "Naturalisierung". Im Rahmen von Marx' Analyse der<br />
Warenform ist die »Natur dieser Bedürfnisse, ob sie z.B. dem Magen oder der Phantasie entspringen«<br />
bedeutungslos. »Es handelt sich hier auch nicht darum, wie die Sache das menschliche Bedürfnis befriedigt,<br />
ob unmittelbar als Lebensmittel, d.h. als Gegenstand des Genusses, oder auf einem Umweg, als<br />
Produktionsmittel.« (Ibid.: 86) Bedürfnisse können damit sowohl "naturwüchsig" als auch gesell-
132 Die Dinge des Lebens<br />
zum Zweck der Erzielung eines wechselseitigen Nutzens getauscht werden können,<br />
müssen sie sich erstens qualitativ unterscheiden 230 und zweitens quantitativ zueinander<br />
in Beziehung gesetzt sein. Um letzteres zu ermöglichen, bedarf es einer objektiven<br />
Bestimmung des Tauschwerts, einer Abstraktion von den im Zweifelsfall jeweils<br />
subjektiv bestimmten Gebrauchswerten. Der Begriff "Tauschwert" meint diesbezüglich<br />
»das quantitative Verhältnis, die Proportion, worin sich Gebrauchswerte einer<br />
Art gegen Gebrauchswerte einer anderen Art austauschen« (Ibid.). 231<br />
Für Marx, der an die von Smith und Ricardo formulierte "Arbeitswerttheorie"<br />
anknüpft, ist der (Tausch-)Wert einer Ware durch die in ihre Herstellung<br />
eingeflossene Arbeitszeit bestimmt, ist Arbeit die alleinige wertbildende Substanz.<br />
»Ein Gebrauchswert oder Gut hat also nur einen Wert, weil abstrakt menschliche<br />
Arbeit in ihm vergegenständlicht oder materialisiert ist. [...] Der Wert einer Ware<br />
verhält sich zum Wert jeder andren Ware wie die zur Produktion der einen notwendige<br />
Arbeitszeit zu der <strong>für</strong> die Produktion der anderen notwendige Arbeitszeit.«<br />
(Ibid.: 53f.) 232 Der Begriff "Arbeitszeit" bezieht sich auf "abstrakt gesellschaftliche<br />
Arbeit" und ist eine rein quantitative, objektive Größe, die jeweiligen qualitativen<br />
bzw. "subjektiven" Unterschiede der Produzenten und Produkte spielen keine Rolle.<br />
233 Der Tauschwert ist also Resultat einer Abstraktion von den gegenständlichen<br />
Qualitäten erstens der Arbeit und zweitens der Güter, einer Rückführung auf ein allen<br />
Waren gemeinsames Bestimmungsmerkmal. 234 Erst auf dieser Grundlage sind<br />
nach Marx Tauschrelationen, d.h. Wertbeziehungen möglich.<br />
Dieser kursorische Rückgriff auf Marx' Analyse der Warenwerte sollte hier ausrei-<br />
schaftlichen Ursprungs sein, was mit "der Phantasie entspringen" gemeint sein dürfte. Daß der Gebrauchswert<br />
der Ware sich in einer spezifische Konsumptionsform realisiert, ebenso wie ihr Tauschwert an einen spezifischen<br />
Austauschprozeß gebunden ist, wird von Marx, dessen Erkenntnisinteresse der quantitativen Seite<br />
des Prozesses, der Schaffung und Aneignung von "Mehrwert" gilt, praktisch völlig ausgeblendet.<br />
230 »Wie Rock und Leinwand qualitativ verschiedene Gebrauchswerte, so sind die ihr Dasein<br />
vermittelnden Arbeiten qualitativ verschieden — Schneiderei und Weberei. Wären jene Dinge nicht<br />
qualitativ verschiedne Gebrauchswerte und daher Produkte qualitativ verschiedner nützlicher Arbeiten,<br />
so könnten sie sich überhaupt nicht als Waren gegenübertreten. Rock tauscht sich nicht aus gegen Rock,<br />
derselbe Gebrauchswert nicht gegen denselben Gebrauchswert.« (Ibid.: 56) Wie gesehen, gilt dieser<br />
Satz allein <strong>für</strong> die Warenwirtschaft und nicht <strong>für</strong> die Gabenökonomie.<br />
231 Der Tauschwert wird von Marx in der Regel, d.h. wo er nicht gegen den Gebrauchswert abgegrenzt<br />
wird, schlicht als Wert bezeichnet.<br />
232 Der Wert determiniert den Preis nicht, da dieser von den tatsächlichen Produktionskosten,<br />
strategischen Überlegungen und ganz allgemein den Gegebenheiten des Marktes abhängt. Waren von<br />
gleichem Gebrauchswert müssen z.B. zum gleichen Preis verkauft werden, auch wenn ihr Wert sich<br />
unterscheidet, weil einige effizienter als andere erzeugt wurden.<br />
233 Oder, wie R. W. Müller schreibt: »Soweit die Ware nützlich ist, Gebrauchswert hat, ist sie das<br />
Produkt einer bestimmten, konkreten Arbeit ...; soweit von dieser bestimmten, konkreten Nützlichkeit<br />
der Ware abstrahiert wird, wie es im Tauschwertvergleich geschieht, ist die Ware bloß Produkt von<br />
Arbeit an sich, unter Abstraktion von ihrer bestimmten, konkreten Gestalt. Die zusätzliche, rein gesellschaftliche<br />
Qualität der Waren, ihr "Wert", der sich im Tauschwert nur ausdrückt; ist abstrakte menschliche<br />
Arbeit. Und zwar abstrakte Arbeit immer in einer bestimmten Quantität, wie sie der Tauschwert<br />
bezeichnet, in bestimmter "Wertgröße".« (1977: 31f.)<br />
234 Diese Abstraktion ist Resultat eines "unbewußten" Prozesses, der sich sozusagen hinter dem Rücken<br />
der handelnden Subjekte abspielt und in die kapitalistische Ökonomie eingeschrieben ist.
Die Dinge des Lebens 133<br />
chen. Wie Maurice Godelier schreibt, wird das »kapitalistische Produktionssystem<br />
als Ganzes ... durchsichtig, sobald das innere Wesen der Ware sich enthüllt.« (1966:<br />
177) Ich möchte es allerdings vorsichtiger formulieren: Die Analyse der Warenform<br />
kann dieses System nur enthüllen, weil die Ware in ihrer konkreten Ausprägung einer<br />
seiner integralen Bestandteile ist. 235 Eine quantitative Relationierung von Gütern<br />
auf Grundlage der Abstraktion von gewissen Eigenarten findet auch beim "primitiven<br />
Handel" statt, hat in den ihn praktizierenden Gesellschaften aber nicht die gleichen<br />
Konsequenzen — vor allem deshalb nicht, weil die "primitive" Bestimmung<br />
der Tauschraten in keinen universellen Prozeß eingebunden ist.<br />
Marshall Sahlins referiert in diesem Zusammenhang L. Sharps Beschreibung eines<br />
235 Was den Marxismus betrifft, so ist m.E. zwischen einer Methode und einer Metaphysik zu<br />
unterscheiden. Im Unterschied zur marxistischen Geschichtsmetaphysik halte ich den spezifischen<br />
Blickwinkel den Marx im Kapital einnimmt, <strong>für</strong> ausgesprochen produktiv. Es macht durchaus Sinn, alle<br />
sozialen Beziehungen aus Perspektive des Warentauschs zu betrachten und die gesellschaftlichen<br />
Widersprüche auf den Antagonismus von Kapital und Arbeit zu reduzieren. Problematisch wird es erst,<br />
wenn dieser Blickwinkel verabsolutiert und auf erstens alle Aspekte des gesellschaftlichen Prozesses und<br />
zweitens die gesamte Menschheitsgeschichte ausgedehnt wird. Eine Abstraktion bzw. Reduktion von<br />
erheblichem heuristischen Wert wird so zu einer falschen Metaphysik. Das gesellschaftliche Leben ist<br />
nicht auf Austauschbeziehungen und Geschichte nicht auf die Geschichte von Klassenkämpfen oder die<br />
evolutionäre Abfolge von Produktionsweisen zu reduzieren (ihr Antrieb ist nicht allein der Wettstreit<br />
um knappe Ressourcen), und Erkenntnis nicht auf "Arbeit". Der "Materialismus" negiert insgesamt<br />
zentrale Aspekte des gesellschaftlichen Lebens, die ebenso real und material sind (vgl. Sahlins 1976); die<br />
gesellschaftlichen Verhältnisse sind bei Marx letztlich rein ökonomisch bestimmt,<br />
"Produktionsverhältnisse" eben. Insofern er die Ökonomie "naturalisiert", kann Marx' Ansatz folglich<br />
nicht den Zusammenhang von expansiver Güter- und Bedürfnisproduktion erklären; und obwohl Marx<br />
das Phänomen offenbar sieht, scheint es ihn nicht zu interessieren, es erscheint als abgeleitetes<br />
"Überbauphänomen" und nicht als integraler Bestandteil eines gesellschaftlichen Ganzen. M.a.W.:<br />
Dadurch daß Marx' Analyse von einer rein formalen Bestimmung ausgeht (Arbeitswerttheorie), bleibt<br />
die ökonomische Analyse (so wertvoll sie auch ist) notwendig auf die formalen Aspekte der Sphären von<br />
Produktion und Distribution beschränkt, die inhaltlichen (d.h. im weitesten Sinne sozialpsychologischen)<br />
Aspekte bleiben ihr verschlossen. Ich will damit keineswegs die Marx'sche Ideologiekritik pauschal<br />
diskreditieren, die Unterscheidung zwischen realen Verhältnissen und deren ideologischer<br />
Verschleierung ist im Rahmen einer Kritik konkreter gesellschaftlicher Verhältnisse zentral<br />
erkenntnisleitend. Das Basis/Überbau Schema wird von Marx bzw. im Marxismus aber ebenso<br />
verabsolutiert wie (damit zusammenhängend) die Beziehung von Sein und Bewußtsein (wenn man so<br />
will "verdinglicht"), anstatt diese Gegenüberstellungen primär als heuristische Konstruktion zu<br />
begreifen. Die Tatsache, daß Begriffe wie "Entfremdung" und "Verdinglichung" bei Marx auch noch<br />
andere Konnotationen haben, als die rein technischen im "Kapital" sollte schließlich nicht dazu<br />
verführen, den Versuch zu machen, hier mit großem Aufwand zu versuchen, doch die inhaltlichen aus<br />
den formalen Bestimmungen abzuleiten. Die Verfaßtheit der Menschen in modernen<br />
Industriegesellschaft ist keine Funktion des Warentauschs, d.h. der Äquivalentenlogik, oder des<br />
Antagonismus von Kapital und Arbeit. Die mit der Industrialisierung einhergehenden tiefgreifenden<br />
Veränderungen hatten sicherlich gravierende Auswirkungen auf die von ihnen betroffenen Menschen,<br />
und die gerade genannten Schlagworte sind sicherlich geeignet, diesen Prozeß zu etikettieren, aber m.E.<br />
nur auf sehr allgemeine und unbestimmte Weise, weshalb ich auch hieran nicht anknüpfe. Man sollte<br />
also Marx produktiv nutzen, seinen universalgeschichtlichen Konstrukten aber mißtrauen, weil sie auf<br />
einem allzu simplen Schematismus beruhen. Sicherlich haben derartige Modelle etwas sehr<br />
verführerisches, weil man glauben kann, hier diejenigen Wirkungsgesetze identifiziert zu haben, die den<br />
historischen Prozeß vorantreiben bzw. determinieren. Die Konstruktion (und die ihr zugrundeliegende<br />
Teleologie bzw. Ontologie) wurzelt aber allzusehr im frühen 19. Jahrhundert, und ihr Rückbezug auf<br />
Geschichte und Gesellschaft führt schließlich nur dazu, daß Epizykel auf Epizykel geschichtet wird.
134 Die Dinge des Lebens<br />
Systems intertribaler Handelsbeziehungen im Bereich der Cape-York Halbinsel in<br />
Queensland (Australien). Dort werden u.a. Stachelrochen-Speere gegen Steinäxte<br />
über eine lange Kette von der Küste bis weit ins Landesinnere getauscht. Die Bildung<br />
der Tauschraten (von 12 Speere gegen 1 Axt in der Nähe der Küste zu 1 Speer<br />
gegen "vermutlich" mehrere Äxte weit im Landesinneren) folgt dem einfachen Prinzip,<br />
daß der (relative) Wert eines Gutes im Vergleich zu einem anderen mit der Distanz<br />
zu seinem Ursprungsort wächst, so daß es Sahlins vernünftig scheint, anzunehmen,<br />
daß dieser Wert analog zu seiner relativen Seltenheit, d.h. mit abnehmendem<br />
Angebot, wächst (1972: 290). 236<br />
Dies gilt nach Sahlins beim primitiven Handel in den allermeisten Fällen und<br />
ermöglicht "Zwischenhändlern" wie den Siassi, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.<br />
Manchmal rekurrieren die Eingeborenen bei der Erörterung der "Gleichwertigkeit"<br />
von Gütern auch auf die in deren Herstellung eingeflossene Arbeitsleistung. So wird<br />
z.B. am Huon-Golf Taro aus Busama gegen Töpferware aus dem Süden zu Raten von<br />
50 Pfund Taro gegen 1 kleinen Topf oder 150 Pfund gegen einen großen Topf getauscht.<br />
Bezogen auf die jeweils zur Produktion nötige Arbeitszeit ist das nach<br />
Sahlins eine <strong>für</strong> die Töpfer sehr günstige Relation. »Bei den gültigen Tauschraten<br />
eignen sich die ärmeren Gemeinwesen ... die erhöhte Arbeitsleistung der reicheren<br />
an.« (Ibid.: 289) Die Busama, die offenbar über eine Art "primitive Arbeitswerttheorie"<br />
verfügen, sehen dies sehr wohl, und sagen, die Tauschraten erklärend, über<br />
die Töpfer im Süden: Sie »tun uns leid... Sie leben in einem so hungrigen Land. Zudem<br />
brauchen wir Töpfe, um sie selbst zu benutzen und um sie gegen Matten und<br />
andere Sachen auszutauschen.« (Hogbin 1951: 92) 237<br />
Diese Erklärung beinhaltet <strong>für</strong> Sahlins eine interessante Implikation bezüglich<br />
des von den Busama selbst produzierten Taro. Die Busama sind wegen der beschränkten<br />
Nachfrage nach Taro — speziell in den nördlichen Dörfern, in denen unterschiedliche<br />
Gebrauchsgüter hergestellt werden — in ihrem Südhandel deutlich<br />
benachteiligt. Der "Markt" <strong>für</strong> Taro beschränkt sich auf die Töpfer im Süden. Im<br />
Gegensatz dazu besteht überall Nachfrage nach den im Süden gefertigten Töpfen.<br />
Für die Busama sind die Töpfe viel mehr als nur Gebrauchsgüter, sie sind die wichtigsten<br />
Handelsgegenstände, ohne die sie vom Handel mit dem Norden abgeschnitten<br />
wären, weshalb sie das <strong>für</strong> sie ungünstige Tauschverhältnis in Kauf nehmen. Der<br />
relative Wert des Taro in Beziehung zu den Töpfen spiegelt also die Gesamt-<br />
236 Seiner Struktur nach ist dieses System »eine einfache Handelskette in welcher Horde mit Horde<br />
verknüpft ist entlang einer ca. 400 Meilen langen Linie von der Küste der Cape-York Halbinsel ins<br />
Landesinnere. Jede Gruppe ist auf Kontakte mit ihren unmittelbaren Nachbarn beschränkt, und<br />
infolgedessen nur indirekt mit entfernteren Horden entlang der Linie verbunden. Der Handel selbst<br />
findet als eine Art Gabentausch zwischen Älteren statt, die als klassifikatorische Brüder gelten.« (Sahlins<br />
1972: 281)<br />
237 Nichtsdestotrotz wird diese "Ausbeutung" durch eine formelle Gleichsetzung der Arbeitswerte verschleiert.<br />
Obwohl sie niemanden zum Narren zu halten scheint, vermittelt die Täuschung den Anschein<br />
einer "Gleichwertigkeit" der getauschten Dinge. Die Töpfer übertreiben den (Arbeits-)wert ihres<br />
Produkts, während die Busama sich über den geringen Gebrauchswert beklagen (vgl. Ibid.).
Die Dinge des Lebens 135<br />
nachfrage nach diesen Gütern im Bereich des Huon-Golf.<br />
Wenn man will, kann man hier einige der "Gesetze" des Marktes wirken sehen.<br />
Aber, wie Sahlins schreibt: »In seiner bourgeoisen Form kann man von dem<br />
Prozeß nicht verallgemeinern, während er in seiner allgemeinen Form nicht bourgeois<br />
ist.« (1972: 314) 238 Um es zu wiederholen: das Ganze ist mehr als sie Summe<br />
seiner Teile. Wenn unter "primitiven" Verhältnissen quantitative Tauschrelationen<br />
zwischen qualitativ differenten Gütern auf Grundlage einer Abstraktion von den gegenständlichen<br />
Eigenschaften dieser Güter oder ihres Herstellungsprozesses gebildet<br />
werden, handelt es sich um wenig mehr als einen klassifikatorischen Akt, der eine<br />
gemeinsame Eigenschaft (gesellschaftlichen oder "natürlichen" Ursprungs) dieser<br />
Güter als bestimmendes relationales Merkmal herausgreift. Irgendeine Beziehung<br />
muß schließlich zwischen ihnen hergestellt werden (können), und diese bedarf einer<br />
Grundlage. Wie wäre ansonsten eine Gegengabe, die sich qualitativ von der Gabe<br />
unterscheidet als "angemessen" zu definieren?<br />
Konsequenzen hat die "primitive Tauschwertbestimmung" offenbar erst dann,<br />
wenn sie nicht vorgenommen wird, wie Lévi-Strauss' Beschreibung der Tauschakte<br />
belegt, welche die latenten Feindseligkeiten zwischen einzelnen Horden der brasilianischen<br />
Nambikwara überwinden. An Stelle der Auseinandersetzung tritt der Austausch;<br />
vielleicht entspringt aber auch dem Tausch die nächste Auseinandersetzung:<br />
»So karg die materielle Kultur der Nambikwara ist, so werden doch die besonderen Erzeugnisse<br />
jeder Gruppe hoch geschätzt. Die Bewohner des Ostens benötigen Töpferwaren und Saatgut;<br />
die im Norden sind der Ansicht, daß ihre südlichen Nachbarn besonders kostbare Halsketten<br />
herstellen. So hat die Begegnung zweier Gruppen, wenn sie sich in friedlicher Weise abspielen<br />
kann, den Austausch von Geschenken zur Folge ... Aber im Grunde ist es sehr schwierig<br />
festzustellen, ob überhaupt ein Austausch im Gange ist. An dem Morgen, der dem Streit<br />
folgte, ging jeder seinen gewohnten Beschäftigungen nach, und die Gegenstände oder Produkte<br />
wanderten von einem zum anderen, ohne daß der Geber die Geste herausstrich, mit der er<br />
seine Gabe niederlegte, und ohne daß der Empfänger seiner Neuerwerbung besondere Aufmerksamkeit<br />
schenkte. [...] So verlassen sich die Nambikwara auf die Großzügigkeit ihres<br />
Partners. Die Vorstellung, daß man abwägen, diskutieren oder handeln, fordern oder eintreiben<br />
kann, ist ihnen völlig fremd. [...] Unter diesen Umständen überrascht es wohl nicht, daß<br />
sich eine der Gruppen nach einen solchen Austausch unzufrieden über ihren Anteil zurückzieht<br />
und wochen– oder monatelang (beim Vergleich der Neuerwerbungen mit den eigenen Gaben)<br />
eine Bitterkeit empfindet, die immer aggressiver wird. Oft haben Kriege keine anderen Ursachen.«<br />
(1955: 298f.)<br />
238 Ebenso wie "Angebot" und "Nachfrage" bleiben laut Sahlins auch die Tauschraten im "primitiven<br />
Handel" in der Regel konstant. Zum einen ermöglicht eine größere Zahl von Handelspartnerschaften<br />
(d.h. der Handel mit mehreren Partnern zu traditionellen "Preisen") auf der einen Seite eine Ausweitung<br />
des Handels, wie sie auf der anderen Seite möglichen Schwankungen in den Tauschraten entgegenwirkt.<br />
Eine zweite Praktik erscheint mir als fast noch bedeutsamer, da sie die Nähe des primitiven<br />
Handels zum Gabentausch herausstellt: man kann seinen Partner "überbezahlen" um ihn zu verpflichten,<br />
die Gabe zu normalen Tauschraten innerhalb eines gegebenen Zeitrahmens zu erwidern. Der Wettstreit<br />
innerhalb eines Gemeinwesens um das Volumen des Handels (bigman-Logik) hat ebenfalls keine Auswirkungen<br />
auf die Tauschraten. Auch Bigmen überbieten sich nicht, um in den Besitz einer größeren<br />
Anzahl von Gütern zu gelangen. Der Tausch ist eine Frage der Ehre. Die übliche Strategie ist hier, die<br />
Anzahl der Partner zu erhöhen.
136 Die Dinge des Lebens<br />
Obwohl sie scheinbar formal identisch operiert, unterscheidet sich die Relationierung<br />
der Güter auf dem Markt radikal von derjenigen in "primitiven" Handelspartnerschaften,<br />
da sie in einen vollkommen differenten Funktionszusammenhang<br />
eingebettet ist. Die Differenz zwischen Gabe und Ware ist weniger in das Verhältnis<br />
der getauschten Dinge eingeschrieben als in die soziale Beziehung der Tauschenden;<br />
der Austauschprozeß ist stets ein gesellschaftlicher Prozeß. Diese Einsicht geht auch<br />
auf Marx zurück. Wie Claude Meillassoux schreibt, hat Marx gezeigt, »daß das, was<br />
den liberalen Ökonomen als rein ökonomisch und materiell erschien, z.B. die Ware<br />
oder das Kapital, in Wirklichkeit die Kristallisierung sozialer Beziehungen ... war.«<br />
(1975: 16) Da soziale Beziehungen in der kapitalistischen Gesellschaft weitgehend als<br />
Verhältnisse zwischen Dingen erscheinen, bietet sich die Analyse der Warenform als<br />
via regia zum Verständnis der inneren Logik der kapitalistischen Ökonomie durchaus<br />
an. 239<br />
Die Ware kann aber nur unter bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen<br />
existieren. Die der Tauschwertbestimmung zugrundeliegende Abstraktion ist in diesem<br />
Zusammenhang notwendiges, aber nicht hinreichendes Merkmal, denn der Warenaustausch<br />
realisiert sich in seiner spezifischen Form nur auf Grundlage einer ebenso<br />
spezifischen Art und Weise universeller gesellschaftlicher Arbeitsteilung:<br />
»Ein Ding kann nützlich und Produkt menschlicher Arbeit sein, ohne Ware zu sein. Wer durch<br />
sein Produkt sein eigenes Bedürfnis befriedigt, schafft zwar Gebrauchswert, aber nicht Ware.<br />
Um Ware zu produzieren, muß er nicht nur Gebrauchswert produzieren, sondern Gebrauchswert<br />
<strong>für</strong> andere. {Und nicht nur <strong>für</strong> andre schlechthin. Der mittelalterliche Bauer produzierte<br />
das Zinskorn <strong>für</strong> den Feudalherren, das Zehntkorn <strong>für</strong> den Pfaffen. Aber weder Zinskorn<br />
noch Zehntkorn wurden dadurch zur Ware, daß sie <strong>für</strong> andere produziert wurden. Um<br />
Ware zu werden, muß das Produkt dem andern ... durch den Austausch übertragen werden.}«<br />
(Marx 1890: 55) 240<br />
"Gebrauchswert <strong>für</strong> andere produzieren und dem anderen durch Austausch übertragen"<br />
heißt in der kapitalistischen Ökonomie dreierlei: Da unsere Wirtschaftsweise<br />
erstens im Privateigentum an Produktionsmitteln und in der Lohnarbeit gründet,<br />
wird auf Rechnung des Arbeitgebers produziert. D.h. der abhängig Beschäftigte<br />
kann keine Tauschbeziehung mit den vom ihm produzierten Gütern oder bereitgestellten<br />
Dienstleistungen aufbauen, er tauscht lediglich Geld gegen Arbeitskraft bzw.<br />
–zeit. Zweitens ist die gesamte Produktion zur Veräußerung bestimmt, es herrscht<br />
bei der Befriedigung auch der Grundbedürfnisse aller Menschen eine totale Ab-<br />
239 Ein zentrales Argument Marx' gegen die "klassischen" Ökonomen wie Smith und Ricardo lief auf<br />
den Vorwurf hinaus, daß diese nicht begriffen, daß und auf welche Weise die Ökonomie Teil der<br />
Gesellschaft (und damit der Geschichte) ist.<br />
240 Der geklammerte Einschub in der zitierten Passage stammt von Friedrich Engels, der dazu bemerkt:<br />
»Ich schiebe das Eingeklammerte ein, weil durch dessen Weglassung sehr häufig das Mißverständnis<br />
entstanden, jedes Produkt, das von einem anderen als dem Produzenten konsumiert wird, gelte bei<br />
Marx als Ware.« (Ibid., Fußnote) — Nach Marx ist die gesellschaftliche Teilung der Arbeit »Existenzbedingung<br />
der Warenproduktion, obgleich Warenproduktion nicht umgekehrt die Existenzbedingung<br />
gesellschaftlicher Arbeitsteilung. In der altindischen Gemeinde ist die Arbeit gesellschaftlich geteilt, ohne<br />
daß die Produkte zu Waren werden.« (Ibid.: 56)
Die Dinge des Lebens 137<br />
hängigkeit vom Markt. Dabei sind drittens die Beziehungen zwischen Produzent und<br />
Konsument, Arbeitgeber und Arbeitnehmer typischerweise temporär und anonym,<br />
dort wo sie "persönliche" Anteile beinhalten, sind diese den ökonomischen Zweken<br />
notwendig untergeordnet. Das ist das genaue Gegenteil der Verhältnisse beim "primitiven<br />
Handel", der zwar auch in einer Form der Arbeitsteilung gründet, aber nur<br />
eine geringe Anzahl dringend benötigter Güter umfaßt (also die Subsistenz in aller<br />
Regel lediglich ergänzt), die von den Tauschenden selbst (und nicht von Lohnarbeitern)<br />
"handwerklich" erzeugt und im Rahmen dauerhafter Beziehungen getauscht<br />
werden: »Der Handelsverkehr ist in parallele und isolierte Transaktionen<br />
zwischen bestimmten Paaren kanalisiert. Wo der Handel über Partnerschaften abgewickelt<br />
wird, ist im vornherein festgelegt, wer mit wem tauscht.« (Sahlins 1972:<br />
298)<br />
"SURVIVAL OF THE FITTEST"<br />
Die Warenökonomie ist das Ergebnis einer spezifischen historischen Entwicklung,<br />
die Industrialisierung der Güterproduktion (sowie des Transport– und Kommunikationswesens)<br />
untrennbar mit dem Aufstieg der Marktwirtschaft verbunden.<br />
Das vielleicht wichtigste konstitutive Einzelmerkmal dieser Wirtschaftsform ist die<br />
wechselseitige Konkurrenzbeziehung, in der Anbieter und Nachfrager auf dem<br />
"selbstregulierenden" Warenmarkt zueinander stehen, und die sich im "Spiel" von<br />
Angebot und Nachfrage manifestiert, welches die Preise bestimmt. Die Preisbildung<br />
verläuft denkbar einfach: Im Falle eines Überangebots im Verhältnis zur Nachfrage<br />
reduzieren die Anbieter die Preise, um die Nachfrage zu steigern. Anbieter die zu<br />
teuer produzieren, können hierbei nicht mithalten und verschwinden vom Markt.<br />
Bei einem zu geringen Angebot werden hingegen die Preise erhöht und diejenigen<br />
der Nachfrager, die nicht mehr mitbieten können, müssen sich zurückziehen. —<br />
Soweit die rein formale Beschreibung des Marktmechanismus, die <strong>für</strong> sich genommen<br />
noch relativ wenig aussagt. Denn Angebot und Nachfrage sind keine zufälligen<br />
Größen. Erst das konkrete Verhalten der Anbieter und Nachfrager setzt jenen dynamischen<br />
Prozeß in Gang, der <strong>für</strong> die im 19. Jahrhundert sich dramatisch beschleunigende<br />
Intensivierung und Ausweitung der Produktion aller denkbaren Güter verantwortlich<br />
ist. Die Verhaltensimperative, die das Marktgeschehen konstituieren<br />
(und die es gleichzeitig bedingt), sind denkbar einfach: Die Konsumenten (Nachfrager)<br />
wollen ihr Konsumniveau (ihren "Nutzen") maximieren, möglichst viel (in<br />
Qualität oder Menge) <strong>für</strong> ihr Geld erhalten, 241 also möglichst preiswert kaufen.<br />
Den nach Profitmaximierung strebenden Anbietern (Produzenten) stehen —<br />
sofern sie kein Kartell zur Preisregulierung bilden — nur drei Optionen offen, um<br />
241 Die der modernen ökonomischen Theorie zugrundeliegende Grenznutzentheorie wurzelt in der<br />
schlichten Feststellung, daß »beim Konsum von Gütern der marginale Grenznutzen, also der zusätzliche<br />
Nutzen der jeweils nächsten Konsumeinheit, mit zunehmender Konsumquantität sinkt.« (Görlich 1992:<br />
42)
138 Die Dinge des Lebens<br />
auf dieses Verhalten zu reagieren: Sie können erstens eine kostenorientierte Strategie<br />
verfolgen, d.h. die Produktivität (den Wert der produzierten Güter in Relation zu<br />
den Herstellkosten) steigern. Wer zu teuer produziert, kann nicht preiswert genug<br />
verkaufen. Da Löhne (zumindest was inländische Produktionsstandorte betrifft) und<br />
Materialkosten nur in begrenztem Rahmen gesenkt werden können, heißt Konkurrenzfähigkeit<br />
in dieser Hinsicht primär: Erhöhung der Effizienz des Produktionsprozesses,<br />
also Rationalisierung. 242 Die Unternehmen können zweitens mittels einer innovativen<br />
Strategie versuchen, neue oder besser an die Bedürfnisse der Kunden angepaßte<br />
Produkte herzustellen (oder ihren Produkten zumindest diesen Anschein<br />
verleihen), um somit dem Konkurrenzdruck zumindest zeitweise zu entgehen. Sie<br />
können drittens neue Märkte erschließen, auf denen ihre Produkte entweder billiger<br />
oder besser sind als die der vorhandenen Anbieter.<br />
Abbildung 7: Marktimperative und –Strategien<br />
Die ersten beiden dieser Strategien verweisen direkt auf die Dynamik unseres ökonomischen<br />
Prozesses. Jede Produktivitätssteigerung führt zu einer Erhöhung der Produktion<br />
bei unverändertem Arbeitseinsatz. Ergo muß das Volumen der Produktion<br />
und damit auch das Konsumniveau mindestens ebenso schnell steigen wie die Produktivität,<br />
um Vollbeschäftigung (bei unveränderten Arbeitszeiten und Stundenlöhnen)<br />
zu garantieren. Da das bei den bereits auf dem Markt vorhandenen Produkten<br />
nicht möglich ist (der Markt <strong>für</strong> jedes Produkt ist irgendwann gesättigt, gleichgültig,<br />
wie niedrig der Preis sein mag), müssen immer wieder neuartige oder verbesserte<br />
242 Hieraus resultiert fast zwangsläufig die Konzentration auf nur wenige Anbieter. Nach dem "Gesetz<br />
der großen Stückzahl" verringern sich die Herstellungskosten mit steigenden Produktionszahlen.
Die Dinge des Lebens 139<br />
Produkte oder Dienstleistungen auf den Markt geworfen werden. 243 Unsere Wirtschaft<br />
"funktioniert" dergestalt nach dem Prinzip endlos wachsender Produktion und<br />
Konsumption und befindet sich gleichzeitig in einer permanenten Beschäftigungskrise<br />
(die sich im Zuge der voranschreitenden Globalisierung zunehmend verschärft).<br />
244 — Diese knappen Bemerkungen zu den "Gesetzmäßigkeiten" der<br />
Marktwirtschaft sollen hier genügen.<br />
Die zumindest bis an den Beginn der Neuzeit zurückzuverfolgende Bewegung, die<br />
zur Entstehung und Ausdehnung von Märkten <strong>für</strong> alle denkbaren Waren, einschließlich<br />
Grund und Boden und Arbeitskraft, führte, hält bis heute an. Mit ihr korrespondiert<br />
eine beständige Steigerung der Arbeitsproduktivität. Rationalisierung<br />
hieß ursprünglich: Intensivierung der Produktion via Arbeitsteilung. Daß Karl Marx<br />
bei seinem Versuch, die der Marktökonomie zugrundeliegende Logik zu enthüllen,<br />
vor allem die Arbeitsteilung in den Mittelpunkt rückte, ist kein Zufall. Spezialisierung<br />
war das Zauberwort des 19. Jahrhunderts. »In einer dampfgetriebenen Gesellschaft«<br />
war das Prinzip der Arbeitsteilung »ein Synonym <strong>für</strong> Spezialisierung und<br />
Geschwindigkeit. Es versprach Reichtum und florierende Märkte [...] "Arbeitsteilung"<br />
war das Schlagwort der Epoche; Prinz Albert nannte sie die Lokomotive der<br />
Zivilisation, die durch jeden Aspekt "von Wissenschaft, Industrie und Kunst" donnere.«<br />
(Desmond/Moore 1991: 475) 245<br />
Als Rationalisierungsinstrument ist die sich ausweitende Arbeitsteilung, wie<br />
gerade gezeigt, ein Reflex auf den Konkurrenzdruck des Marktes, der eine ständige<br />
Erhöhung der produktiven Effizienz erzwingt. Folgerichtig erschienen spätestens seit<br />
Mitte des 19. Jahrhunderts Konkurrenz und Selektion als diejenigen Triebkräfte des<br />
"Fortschritts", welche die arbeitsteilige Differenzierung immer aufs neue vorantreiben<br />
— vermittelt über den "Transmissionsriemen" Markt, auf dem nur die<br />
Tüchtigsten überleben. Diese Formulierungen erinnern stark an Darwins Theorie<br />
der natürlichen Auslese, die dieser nach dem Muster von Herbert Spencers Modell<br />
der sozialen Evolution konzipierte. Natur und Gesellschaft verschmolzen in Darwins<br />
Bild des evolutionären Prozesses tatsächlich vollkommen. Alan Desmond und James<br />
Moore beschreiben seine Denkfiguren und Analogiemuster folgendermaßen:<br />
»Darwin erkannte, daß genauso, wie die Industrie expandierte, wenn sich die Arbeiter spezialisierten,<br />
dies auch <strong>für</strong> das Leben insgesamt zutraf. Aber die Natur besaß "die leistungsfähigeren<br />
Werkstätten". Er behauptete, die natürliche Auslese werde zwangsläufig "die<br />
physiologische Arbeitsteilung" unter den Tieren steigern, die sich in Konkurrenzsituationen<br />
befänden. Scharfe Konkurrenz in übervölkerten Gebieten — von Darwin als "Artenfabrik der<br />
243 Eine Ausweitung der Märkte hat weiterhin den Vorteil, leistungsfähigere Unternehmensstrukturen<br />
schaffen zu können ("Global Players").<br />
244 Bei der derzeit vielbeschworenen "Globalisierung" der Ökonomie geht es um wenig mehr, als<br />
wechselseitigen Zugang zu Märkten zu schaffen, die schließlich verschmelzen sollen.<br />
245 Schon Adam Smith hatte deren Bedeutung <strong>für</strong> den materiellen Wohlstand hervorgehoben, wobei er<br />
die Arbeitsteilung aus einer angeblich dem Menschen eigentümlichen Tauschneigung und dem Streben<br />
des einzelnen, sich materiell besser zu stellen, ableitete.
140 Die Dinge des Lebens<br />
Natur" bezeichnet — begünstige Varianten, die freie Nischen nutzen konnten. Diese Individuen<br />
ergriffen neue Gelegenheiten beim Schopfe und verwerteten die verfügbaren Möglichkeiten<br />
an Ort und Stelle. [...] Die Konkurrenz spalte dichte örtliche Populationen, fächere sie<br />
auf und zwinge eine größere Anzahl von Individuen, der Hetzjagd zu entfliehen und sich ihren<br />
eigenen geschützten Winkel zu suchen. [...] So, wie eine überfüllte Großstadt wie London<br />
Gewerbebetriebe aller Art verkraften könne, die nebeneinander und doch ohne unmittelbaren<br />
Wettbewerb arbeiteten, so entgingen die Arten dem Konkurrenzdruck, indem sie sich unbesetzte<br />
Nischen auf dem Marktplatz der Natur suchten. Je größer der funktionale Pluralismus<br />
der Tiere, desto mehr davon könne ein Areal ernähren. Die metaphorische Übertragung war<br />
vollständig. Die Natur war eine sich selbst vervollkommnende "Werkstätte", Evolution war<br />
die dynamische Ökonomie des Lebens.« (Ibid.: 475f.) 246<br />
Darwins Natur war eine Natur des industriellen Zeitalters mit Arbeitsteilung und<br />
Fabriken, Profiteuren, Verlierern und Armenhäusern, in der allein eine Malthus'sche<br />
"Schwache-an-die-Wand-Ethik" (wie Desmond und Moore sie bezeichnen) die Maßstäbe<br />
angab, und aus diesem Grund eignet sich seine Theorie hervorragend <strong>für</strong> einen<br />
Rückbezug auf die Gesellschaft — unsere Gesellschaft, wohlgemerkt. 247 Nicht nur<br />
daß "untüchtige" Kolosse wie der Brontosaurus von leistungsfähigeren Spezies aus<br />
ihren Lebensräumen verdrängt werden, anpassungsfähige Arten erschließen zudem<br />
beständig neue ökologische Nischen. Wie sich schließlich im Laufe der Erdgeschichte<br />
das Leben immer neue Räume eroberte und immer mehr Arten und Individuen den<br />
Erdball bevölkerten, so expandiert auch die durch die Konkurrenz des Marktes stimulierte<br />
industrielle Produktion ins scheinbar unendliche. — Dieser Rekurs auf<br />
Darwin ist zwar wenig mehr als eine illustrative Anekdote, er gibt allerdings einigen<br />
Aufschluß über den Status, den wir den "Marktgesetzen" einräumen bzw. zuzugestehen<br />
bereit sind.<br />
Zwischen Konkurrenzprinzip und Arbeitsteilung besteht in unserer Marktökonomie<br />
also eine untrennbare Verbindung. 248 Auf dem Markt, dessen Wesen<br />
Konkurrenz ist, herrscht keine Solidarität, unter den Anbietern ebensowenig wie<br />
unter den Nachfragern. Es sollte unmittelbar einsichtig sein, daß die Art von sozialer<br />
Beziehung, lebenslanger Bindung, wie sie dem Gabentausch eignet, bzw. die dieser<br />
fördern und perpetuieren soll, mit der Profitorientierung des Marktes unverträglich<br />
246 »Die ganze darwinistische Lehre vom Kampf ums Dasein ist einfach die Übertragung der<br />
Hobbes'schen Lehre vom bellum omnium contra omnes und der bürgerlich-ökonomischen von der<br />
Konkurrenz, nebst der Malthus'schen Bevölkerungstheorie, aus der Gesellschaft in die belebte Natur.<br />
Nachdem man dies Kunststück fertiggebracht, ... so rücküberträgt man dieselben Theorien aus der<br />
organischen Natur wieder in die Geschichte und behauptet nun, man habe ihre Gültigkeit als ewige<br />
Gesetze der menschlichen Gesellschaft nachgewiesen.« (Friedrich Engels nach Sahlins 1976: 83)<br />
247 »Evolution und utilitaristische Volkswirtschaftslehre stimmten bestens überein, und vielen ...<br />
Industriellen erschien dies völlig natürlich. [...] Darwin orientierte seine Theorie an seinen finanziellen<br />
Interessen. Er investierte zehntausende von Pfund in Eisenbahngesellschaften und zwanzig Jahre seines<br />
Lebens in die Enthüllung des konkurrenzbetonten, spezialisierten und arbeitsintensiven Aspekts der<br />
"Werkstätten" der Natur. Er plazierte die Natur auf Seiten der Industrie.« (Ibid.: 477) — Ein heilsames<br />
Korrektiv aus dem Bereich der Biologie liefern z.B. die hervorragenden Darstellungen der<br />
Evolutionsbiologie von François Jacob (1970, 1982).<br />
248 So war z.B. eine Vorbedingung <strong>für</strong> die Entwicklung der industriellen Produktion der Wegfall jener<br />
Zunftzwänge, die Konkurrenz ausschalten sollten, in dem sie Angebot und Preise regulierten.
Die Dinge des Lebens 141<br />
ist, auf dem die Menschen als "Warenbesitzer" in einem antagonistischen Verhältnis<br />
zueinander stehen: jeder will idealiter so wenig wie möglich geben, aber soviel wie<br />
möglich erhalten, sich also, wenn irgend möglich, auf Kosten des anderen bereichern.<br />
Diese Verhaltensmaximen laufen denjenigen diametral zuwider, die auch bei<br />
uns <strong>für</strong> freundschaftliche Beziehungen gelten. Da Handelspartner "Freunde" sind<br />
(möglicherweise sogar verwandt) und dies bleiben wollen, kann zwischen ihnen keine<br />
Relation bestehen, wie sie der Markt vorschreibt. Die innerhalb eines Gemeinwesens<br />
geltenden Normen hindern dessen Mitglieder daran, in jene Konkurrenzbeziehung<br />
zueinander zu treten, welche das Marktmodell erfordert — speziell im<br />
Rahmen von Handelsbeziehungen mit "Fremden". »No man can have honor and<br />
profit in his own camp.« (Sahlins 1972: 298) Die Angehörigen eines Gemeinwesens<br />
über– bzw. unterbieten sich nicht gegenseitig, weder beim Kula noch beim Handel.<br />
Sie könnten es auch gar nicht, weil — und hier schließt sich der Kreis — der Handel<br />
zwischen zwei Ethnien entweder über Handelspartnerschaften oder über Repräsentanten<br />
der jeweiligen Gruppen abgewickelt wird und werden muß. »Soziale Beziehungen,<br />
nicht Preise, verbinden "Käufer" und "Verkäufer".« (Ibid.)<br />
Die "primitive Ökonomie" ist also auch deshalb eine (an unseren Maßstäben<br />
gemessen) "statische" Angelegenheit, weil dort im Minimum das unseren Marktbeziehungen<br />
eigene Moment der Konkurrenz abwesend ist. Ohne Handelspartnerschaften<br />
kann sich ein Mann außerstande sehen, das zu bekommen, was er will — zu<br />
welchem "Preis" auch immer. In den "primitiven" Kulturen scheint nicht einmal virtuell<br />
ein Markt zu existieren, auf dem zwischen mehreren Angeboten das vorteilhafteste<br />
gewählt werden kann. Wohlgemerkt: trotz der vordergründigen Gemeinsamkeiten,<br />
d.h. regional (an der Ressourcenverteilung orientierter) spezialisierter Produktion,<br />
scheinbarer Veräußerbarkeit der Güter (die von den Handelspartnern "bezahlt"<br />
werden können), der Existenz von "Muschelgeld" (ein Thema <strong>für</strong> sich) und<br />
der quantitativen Tauschrelation zwischen den Gütern.<br />
MANGEL UND BEDÜRFTIGKEIT<br />
Meine eben vorgenommene Skizzierung der Determinanten und Konsequenzen der<br />
Marktökonomie war zugegebenermaßen einigermaßen knapp und schematisch, ich<br />
hoffe dennoch, daß der Zusammenhang zwischen dem Zwang zur Rationalisierung<br />
einerseits und dem notwendigen Anstieg der Produktion bei gleichbleibenden Löhnen,<br />
Arbeitszeiten und Beschäftigungsniveau hinreichend deutlich wurde. Damit<br />
aber all die hergestellten Produkte abgesetzt werden können, muß aber (abgesehen<br />
von der notwendigen Kaufkraft) auch Nachfrage nach ihnen bestehen, ansonsten bräche<br />
der gesamte Prozeß umstandslos zusammen. Eine expansive Ökonomie bedarf<br />
eines ebenso expansiven Konsums, einer ständig wachsenden Nachfrage — und tatsächlich<br />
erscheinen die Konsumenten in den modernen Industriegesellschaften als<br />
merkwürdig bedürftige Gestalten, denen es stets an irgend etwas mangelt und die
142 Die Dinge des Lebens<br />
niemals wirklich zufriedenzustellen sind. Die zentrale Frage ist, wie man diese Bedürftigkeit<br />
begründet, die offensichtlich mit den sozialen "Spielregeln" der Marktwirtschaft<br />
korrespondiert und den Gabenökonomien weitestgehend fremd ist. 249<br />
Um den Zusammenhang von expansiver Güter– und Bedürfnisproduktion, d.h. die<br />
Verfaßtheit des Menschen (des Konsumenten) in der bürgerlichen Ökonomie/Gesellschaft<br />
zu beschreiben, rekurriert man zunächst am besten auf deren Ursprungsmythen,<br />
da die Menschen sich offensichtlich ganz genau so verhalten, wie ihre<br />
Mythologie (in unserem Fall: die ökonomische Theorie) es ihnen vorschreibt. Es<br />
erscheint vielleicht auf den ersten Blick als provokant, wenn man behauptet, unsere<br />
Kultur sei eine Kultur des Mangels — aber genau das ist sie, wie das vorstehende<br />
Kapitel verdeutlichte, gerade auch ihrem eigenen Selbstverständnis nach. Und wenn<br />
es auch einerseits keine Berechtigung da<strong>für</strong> gibt, unsere Mystifikationen auf andere<br />
Kulturen und Zeitalter zu projizieren, so besteht doch andererseits, was unsere eigene<br />
Gesellschaft betrifft, kein Grund, die Diagnose anzuzweifeln. 250<br />
In einem berühmten Aufsatz mit dem Titel The Original Affluent Society, einer<br />
beißenden Kritik der utilitaristischen Teleologien, karikiert Marshall Sahlins das geläufige<br />
Bild vom Leben im Paläolithikum: Von der Vorstellung durchdrungen, daß<br />
das Leben damals hart war, wettstreiten die gängigen Darstellungen darin, ein Bild<br />
ständig drohenden Untergangs zu zeichnen, »so daß man sich schließlich nicht nur<br />
fragt, wie sie bewerkstelligten zu leben, sondern auch, ob das überhaupt ein Leben<br />
war.« (Sahlins 1972: 1) 251 Die These von der "ursprünglichen Überflußgesellschaft"<br />
leugnet die Behauptung, der Mensch sei angesichts der unauflöslichen Diskrepanz<br />
zwischen unendlichen Bedürfnissen und unzureichenden Mitteln von Anbeginn der<br />
Vorgeschichte an zu harter Arbeit und technischem Fortschritt verdammt gewesen.<br />
Nach Sahlins gibt es einen zweiten Weg, menschliche Bedürfnisse zu befriedigen,<br />
den Weg des Zen (die Formulierung entspricht dem ironischen Ton des zitierten<br />
Aufsatzes), der von ganz anderen Prämissen ausgeht als der unsere: daß nämlich das<br />
Verlangen der Menschen begrenzt und die ebenso beschränkten technischen Mittel<br />
ihm angemessen sind. Das ist der Weg, den die Jäger und Sammler beschritten, und<br />
der ihnen ein Leben unvergleichlicher Fülle auf einem geringen materiellen Niveau<br />
bescherte. Ein Leben, welches zu führen wir uns fraglos nur schwer vorstellen kön-<br />
249 Unser Verlangen führt umstandslos zurück zum Konkurrenzprinzip: dieses ist nicht "gegeben",<br />
sondern hat seine eigene Bedingtheit, es entspringt dem Bestreben der Konsumenten, immer mehr<br />
haben und immer weniger da<strong>für</strong> geben zu wollen; das Prinzip der Nutzenmaximierung determiniert<br />
dergestalt die sozialen Beziehungen auf dem Markt.<br />
250 Auch die sog. "Informationsökonomie", von der heute viel die Rede ist, ist eine dieser Logik<br />
folgende Marktökonomie, und jede Rede vom "Postindustrialismus" schlicht irreführend. Es wird weder<br />
anders produziert (Lohnarbeit bleibt die Regel bei zunehmender Konzentration auf "global players"),<br />
noch anderes konsumiert, noch sind die Regeln, denen der ökonomische Prozeß folgt, andere. Es<br />
besteht auch in der "Informationsgesellschaft" ein ursächlicher Zusammenhang zwischen Produktivität,<br />
Konsumniveau und Beschäftigung.<br />
251 Angesichts vermeintlich völlig unzureichender technischer Hilfsmittel nahm die tägliche Sorge um<br />
die Nahrungsbeschaffung die altsteinzeitlichen Menschen angeblich derart in Anspruch, daß sie weder<br />
irgendeinen Überschuß erwirtschaften konnten, noch die "Muße" hatten "Kultur zu schaffen".
Die Dinge des Lebens 143<br />
nen. Daß wir dessen Fülle nicht erkennen, liegt daran, das es <strong>für</strong> uns lediglich Geschichte<br />
ist, Teil einer Epoche der Menschheitsgeschichte, die wir "überwinden"<br />
mußten, um zu dem zu werden, was wir sind. Wenn wir in diesen Menschen nur<br />
uns selbst sehen, sie an unseren materiellen Maßstäben messen — ihr Daseinszweck<br />
<strong>für</strong> uns schließlich nur darin bestand, dieses Dasein zu überwinden, damit wir werden<br />
konnten — erscheinen sie uns tatsächlich als armselig und zurückgeblieben. Unsere<br />
armen und bedauernswerten, nackten und frierenden, in Unwissenheit und<br />
Angst gefangenen Brüder...<br />
Aber andere Völker leben in anderen Welten, folgen anderen Zielen und träumen<br />
andere Träume. Sahlins greift Lloyd Warners Beobachtung auf, wonach die von ihm<br />
untersuchten australischen Murngin über keine "entwickelte" Vorstellung von Besitz<br />
verfügen und es ihnen an Interesse mangelt, ihre technische Ausrüstung zu vervollkommnen.<br />
Diese "ökonomische Eigenart" kann nach Sahlins als Mangels oder Defizienz<br />
beschrieben werden, aber ebensogut als schlichtes Desinteresse an der Anhäufung<br />
materieller Güter (Ibid.: 12). Unsere Maßstäbe sind <strong>für</strong> sie bedeutungslos.<br />
Wenn wir also sagen, daß Bedürfnisse der Jäger und Sammler "eingeschränkt", ihr<br />
Verlangen "gezügelt", ihre Vorstellung von Besitz "begrenzt" ist, so sind auch diese<br />
Zuschreibungen im Grunde unangemessen, da sie nichts wiedergeben als unsere<br />
Sicht der Dinge und in diese Gesellschaften eine (mögliche/notwendige) Zukunft<br />
projizieren, die ihnen nicht inhärent ist. »Es ist nicht so, daß Jäger und Sammler ihre<br />
materialistischen "Antriebe" gezügelt hätten, sie haben sie ganz einfach niemals institutionalisiert.«<br />
(Ibid.: 13f.) Sahlins zitiert Père Paul le Jeune, der 1634 bei den Montaignais<br />
in Neu-Frankreich (Kanada) weilte: »Überdies, wenn es ein großer Segen<br />
ist, frei von einem großen Übel zu sein, sind unsere Wilden glücklich; denn die beiden<br />
Tyrannen die <strong>für</strong> viele ... Europäer Hölle und Folter bereithalten herrschen<br />
nicht in ihren Wäldern, — ich meine Habsucht und Begierde ... da sie mit einem<br />
reinen Leben zufrieden sind, verschreibt sich keiner von ihnen dem Teufel, um<br />
Wohlstand zu erlangen.« (nach Ibid.: 14) 252 Was <strong>für</strong> diese Indianer (die von Père la<br />
Jeune in seiner an die Europäer gerichteten Beschreibung doch allzusehr dem Idealbild<br />
des "Edlen Wilden" angeglichen wurden) galt, trifft gleichermaßen auf die<br />
Hadza zu:<br />
»Interessant, daß die Hadza, vom Leben und nicht von der Anthropologie geschult, die neolithische<br />
Revolution ablehnen, um an ihrem Müßiggang festzuhalten. Obwohl sie von Landwirtschaft<br />
treibenden Gesellschaften umgeben sind, haben sie sich bis heute geweigert, selbst den<br />
Boden zu bestellen, "hauptsächlich, weil das auf Böden wie diesen zuviel harte Arbeit bedeuten<br />
würde." Darin gleichen sie den Buschmännern, die die "neolithische Frage" mit einer anderen<br />
beantworten: "Warum sollten wir pflanzen, wenn es auf der Welt so viele mongomongo-Nüsse<br />
gibt?"« (Ibid.: 27)<br />
252 Selbst der von Marx als "fischblütiger Bourgeoisdoktrinär" bezeichnete Destutt de Tracy bemerkte:<br />
»Die armen Nationen sind die, wo das Volk gut dran ist, und die reichen Nationen sind die, wo es<br />
gewöhnlich arm ist.« (nach Marx 1890: 677)
144 Die Dinge des Lebens<br />
Der Satz stammt tatsächlich von einem Buschmann. Der ist aber alles andere als naiv:<br />
Die Nüsse können das ganze Jahr über gesammelt werden und stellen deshalb eine<br />
verläßlichere Nahrungsquelle dar als Garten– oder Ackerbauprodukte. Es ist also<br />
schon fast soweit, daß die Eingeborenen den Anthropologen erklären müssen, warum<br />
sie ihre Wirtschaftsweise unmöglich auf Landwirtschaft umstellen können,<br />
wenn sie ihren Lebensstandard bei gleichbleibendem Arbeitsaufwand halten wollen.<br />
Man kann zudem mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, daß eine mongomongo-<br />
Nuß mehr ist als ein neutrales Lebensmittel, sie ist Teil einer Lebensweise, einer<br />
Kultur der Fülle. Um es zu wiederholen: unsere Art, das Leben zu betrachten, ist <strong>für</strong><br />
"primitive" Gesellschaften nicht angemessen: »Die entscheidende Eigenschaft der<br />
Kultur — daß sie jeder Lebensweise die ihr besonderen Merkmale verleiht — « ist<br />
nicht darin begründet, daß sie materiellen Zwängen gehorchen muß, »sondern daß<br />
sie dies gemäß einem bestimmten symbolischen Schema leistet, das niemals das einzig<br />
mögliche ist. Es ist folglich die Kultur, die jeweils die Nützlichkeit konstituiert.«<br />
(Sahlins 1976: 9) 253 Und auch den Mangel erzeugt.<br />
Selbstverständlich ist auch die vorstehende Charakterisierung der Jäger und Sammler<br />
eine Stilisierung, vielleicht nicht näher an der Wahrheit als jene Lesart, die Sahlins<br />
kritisiert (jedenfalls nicht, solange die konkreten Beobachtungen in pauschale Annahmen<br />
bezüglich "der primitiven Kultur" gipfeln). Aber allein die Tatsache, daß<br />
wir die "fremden und vergangenen" Gesellschaften auch in ganz anderem Licht sehen<br />
können, auf Grundlage unseres Wissens über sie diese oder jene Projektion erschaffen<br />
können, verweist nochmals darauf, daß der evolutionäre Blickwinkel, der<br />
als seinen Fluchtpunkt jenen irreduziblen und unhintergehbaren Mangel wählt, den<br />
es zu beheben galt (und gilt), sich nicht zwingend aufdrängt, sondern lediglich eine<br />
mögliche Lesart ist. Die einfachste vielleicht, aber nicht die beste. Und wenngleich<br />
die relativistische Position, <strong>für</strong> die ich hier votiere, die Universalität der kapitalistischen<br />
Wirtschaftsform, d.h. ihren weltweiten Siegeszug nicht ebenso umstandslos<br />
erklären kann wie die evolutionistische (hierzu bedürfte es umfassender historischer<br />
Studien), kann dies nicht umgekehrt zu dem Schluß führen, daß dieser Siegeszug Ergebnis<br />
einer zwangsläufigen, in bestimmten Invarianten der menschlichen Verfaßtheit<br />
begründeten Entwicklung ist.<br />
GÜTER– UND BEDÜRFNISPRODUKTION<br />
Nichts spricht da<strong>für</strong>, daß der "primitive" Austausch eine rudimentäre, durch soziale<br />
Zwänge "gehemmte" Form des Warentauschs ist und aufgrund seiner "Mängel" aus<br />
sich heraus in gerader, aufsteigender Linie zur "entwickelten" Marktwirtschaft führt.<br />
253 Somit ist <strong>für</strong> Sahlins die "ökonomische Basis" ein »symbolisches Schema der praktischen Tätigkeit,<br />
und nicht einfach nur das praktische Schema der symbolischen Tätigkeit. Sie ist die Realisierung einer<br />
gegebenen bedeutungsvollen Ordnung in den Verhältnissen und Zweckbestimmungen der Produktion,<br />
in den Wertschätzungen und in den Bestimmungen der Hilfsmittel.« (Ibid.: 61f.)
Die Dinge des Lebens 145<br />
Beide Formen ähneln sich tatsächlich nur in einem einzigen Punkt: daß Ungleiches,<br />
Gleichwertiges zur Erzielung eines wechselseitigen materiellen Nutzens getauscht<br />
wird. Wenn es denn dieser Hervorhebung noch bedarf: Der "Primitive" kann durchaus<br />
"ökonomisch", rational, interessegeleitet (oder welche Attribute man sonst noch<br />
bemühen will) handeln — die Bedingungen, unter denen er handelt, sind aber andere.<br />
Es sollte mittlerweile hinreichend deutlich sein, daß Tauschprozesse nicht willkürlich<br />
aus dem funktionalen Zusammenhang von Produktion, Distribution und<br />
Konsumption herausgelöst, d.h. ihrer gesellschaftlichen Bedingtheit und Bestimmung<br />
entkleidet werden können. Eine spezifische Produktionsweise bedarf nicht nur<br />
einer korrespondierenden Distributions– sondern auch einer entsprechenden Konsumptionsweise.<br />
254 Sidney W. Mintz karikiert in diesem Zusammenhang sehr treffend<br />
das in den "entwickelten" Industriegesellschaften verbreitete Bemühen, das<br />
Konsumvergnügen zu maximieren:<br />
»Zeit kennt der Mensch in der modernen Gesellschaft häufig vor allem als ein unendlich knappes<br />
Gut, eine Sichtweise, die <strong>für</strong> das reibungslose Funktionieren eines Wirtschaftssystems, das<br />
auf dem Prinzip des ewig wachsenden Konsums beruht, sehr wesentlich und wichtig sein dürfte.<br />
Anthropologen wie Ökonomen haben sich mit dem der modernen Gesellschaft immanenten<br />
Paradoxon immer wieder herumgeschlagen — dem Paradoxon, daß die modernen, so<br />
immens viel produktiveren Technologien im Endeffekt dazu führen, daß die Menschen eher<br />
weniger als mehr Zeit haben (oder daß sie zumindest das Gefühl haben, sie hätten weniger<br />
Zeit). Aus Zeitmangel versuchen die einzelnen, ihr Konsumvergnügen dadurch zu komprimieren,<br />
daß sie verschiedene Dinge ... gleichzeitig konsumieren. [...] Wer den Cowboys zuguckt,<br />
wie sie die stahlharten Männer spielen, und dabei Pommes frites ist und Coca-Cola trinkt, einen<br />
Joint raucht und sein Mädchen auf dem Schoß hält, kann eine große Menge von Erfahrungen<br />
in einem kurzen Zeitraum unterbringen und damit sein Vergnügen maximieren. Er kann<br />
die Situation aber auch ganz anders erleben, je nachdem, welche Werte <strong>für</strong> ihn gelten. Indes,<br />
das wichtigste an alledem ist, daß Menschen, die in dieser Weise mehreren Vergnügen gleichzeitig<br />
nachgehen bzw. sie erleben, lernen, vor allem an den Konsum zu denken und nicht etwa<br />
an die Umstände, die sie dazu gebracht haben, just auf diese Art zu konsumieren, und dies in<br />
dem Gefühl, um anders zu verfahren hätten sie einfach "nicht genug Zeit".« (1985: 238)<br />
In der Geschichte der Zuckerproduktion und –Konsumption wird nach Mintz historisch<br />
zum ersten Mal der <strong>für</strong> den Kapitalismus so entscheidende Zusammenhang zwischen<br />
»dem Willen zu arbeiten und dem Willen zu konsumieren« deutlich (Ibid:<br />
94). Solange der Konsum stagnierte, und die Menschen gerade soviel arbeiteten, wie<br />
sie zur Aufrechterhaltung ihres Lebensstandards mußten, war eine expansive Ökonomie<br />
unmöglich. Um die Nachfrage entscheidend auszuweiten bedurfte es demnach<br />
der radikalen Veränderung von zwei Grundzügen des wirtschaftlichen Lebens: Es<br />
mußten erstens mehr Menschen in den Markt involviert werden — und zwar als<br />
Produzenten und gleichzeitig als Konsumenten von Waren —, zweitens mußte der<br />
Disposition entgegengewirkt werden, nur soviel zu konsumieren, "wie man seit jeher<br />
gewohnt war" und keinesfalls mehr zu arbeiten, als hier<strong>für</strong> nötig. Offener Zwang<br />
254 Jede Kultur ist ein komplexer Funktionszusammenhang, ein Set aufeinander bezogener Elemente, die<br />
sich wechselseitig bedingen bzw. perpetuieren. Auch der Kapitalismus »ist keine reine Rationalität. Er ist<br />
... eine kulturelle Ordnung, die in einer bestimmten Form agiert.« (Sahlins 1976: 263)
146 Die Dinge des Lebens<br />
ist zwar ein probates Mittel, Menschen zu Arbeit anzuhalten (und der Kapitalismus<br />
wurde tatsächlich einem Großteil der Menschen mit mehr oder weniger offener<br />
Gewalt aufgezwungen), 255 er kann laut Mintz aber nicht die Verfaßtheit des Menschen<br />
in der "Konsumgesellschaft" erklären, den Willen, mehr zu arbeiten, um<br />
mehr konsumieren zu können, der den meisten anderen Gesellschaften fremd ist,<br />
wo niemand auf den Gedanken käme, mehr und härter zu arbeiten, um sein Konsumvergnügen<br />
zu steigern. 256 — Soweit Sidney Mintz.<br />
Die expansive kapitalistische Ökonomie bedarf unserer Bedürfnisse — diese scheinbar<br />
banale Tatsache wird allzuoft verkannt. 257 Und wenn ein großer Teil dieser Bedürfnisse<br />
nicht gegeben ist, worauf das ethnographische Material deutlich verweist,<br />
müssen sie erzeugt sein, gesellschaftlich hervorgebracht. Diese unstrittigen Feststellungen<br />
bedeuten allerdings nicht notwendig, daß auch ein logischer bzw. kausaler<br />
Zusammenhang zwischen Produktion, Distribution und Konsumption besteht, daß<br />
ein einfacher Transmissionsmechanismus das objektiv Beschreibbare (den ökonomischen<br />
Prozeß) mit dem subjektiv Empfundenen (unseren psychischen Dispositionen)<br />
verbindet. Wenn es einen ursächlichen Zusammenhang zwischen Güter– und Bedürfnisproduktion<br />
gibt, dann ist diese "psychische Ökonomie" (A. Green) der kapitalistischen<br />
Gesellschaft Teil einer komplexen und vielgestaltigen Totalität — und<br />
gewiß nicht einfach zu beschreiben. Im Rahmen einer ersten Annäherung an das<br />
Phänomen kann man m.E. dennoch behaupten, daß die kapitalistische Ökonomie einen<br />
gewichtigen Teil jener Bedürfnisse erzeugt, welche sie dann (scheinbar) befriedigt,<br />
daß ihre Dynamik in einer dauerhaften und zwangsläufigen Nichtübereinstimmung<br />
von Bedürfnis und Befriedigung gründet — schließlich halten die Waren allzu<br />
oft nie, was sie versprechen, soviel wir uns auch von ihnen einverleiben. Ich will im<br />
folgenden einige Anhaltspunkte <strong>für</strong> diese These anführen, die sich aus der Differenz<br />
von Gabe und Ware und dem Zusammenhang von Tausch und Vergesellschaftung<br />
ergeben.<br />
Wie ich bereits darlegte, ist die soziale Logik der Gabe mit derjenigen der<br />
Ware unvereinbar, stellen Warentausch und Gabentausch einander ausschließende<br />
Formen dar. Die idealtypische Differenz zwischen beiden ist diejenige zwischen einerseits<br />
einer temporären und antagonistischen und andererseits einer dauerhaften<br />
255 Mintz gibt eine von Jan DeVries zitierte Quelle aus dem 18. Jahrhundert wider: »Bis zu einem<br />
gewissen Grade ... befördert der Mangel den Fleiß... Der Produzent (d.h. der Arbeiter), der von drei<br />
Tagen Arbeit leben kann, wird den Rest der Woche faul und betrunken sein... In den Grafschaften mit<br />
Fabrikationsbetrieben werden die Armen keine Minute länger arbeiten, als sie unbedingt müssen, um<br />
ihren Lebensunterhalt und ihre wöchentlichen Ausschweifungen finanzieren zu können.« (nach Ibid.:<br />
196)<br />
256 Und selbstverständlich liegen auch heute die Bedingungen, unter denen wir arbeiten, nur sehr<br />
begrenzt in unserem Ermessen.<br />
257 Mintz' Buch ist einer der bis heute äußerst seltenen Versuche, die Ökonomie als (historische und<br />
systematische) Totalität aus Produktion, Distribution und Konsumtion zu beschreiben ohne vorschnell<br />
einem der Bereiche den Primat zuzugestehen.
Die Dinge des Lebens 147<br />
und kooperativen sozialen Beziehung, in welche die gegebenen und empfangenen<br />
Dinge jeweils eingewoben sind. Im ersten Fall begegnen sich die Tauschenden als<br />
"Interessen", im zweiten als Personen. 258 Während der Warenaustausch abstrakt<br />
vergesellschaftet, ist die Relationierung durch den Gabentausch (und das gilt <strong>für</strong> alle<br />
seine Ausprägungen) eine konkrete. Diese Gegenüberstellung von "abstrakt" bzw.<br />
"unpersönlich" und "konkret" bzw. "persönlich" führt einerseits zurück zu Marx'<br />
Analyse der der Wertbestimmung zugrundeliegenden Abstraktion und zum anderen<br />
zu seinen Konzepten der "Verdinglichung" und "Entfremdung", auf die ich im folgenden<br />
kurz bezug nehmen will.<br />
"Entfremdung" heißt nach Marx einerseits: die Produkte menschlicher Tätigkeit<br />
erscheinen als etwas den Menschen Äußerliches, über das sie keine Macht besitzen<br />
und dem sie ausgeliefert sind. In diesem Sinne ist dem Arbeiter seine eigene Arbeit<br />
im kapitalistischen Produktionsprozeß entfremdet. Er verkauft dem Unternehmer<br />
lediglich seine Arbeitskraft und verfügt weder über Produktionsmittel noch<br />
die Produkte seiner Tätigkeit, die "vom Kapitalisten angeeignet und dem Kapital<br />
einverleibt" werden. 259 Allein schon dies unterscheidet den kapitalistischen Tauschprozeß<br />
drastisch vom Gabentausch: Wie schon erwähnt, kann ein abhängig Beschäftigter<br />
mit seinen Arbeitsprodukten keine Tauschbeziehungen zu anderen eingehen,<br />
da er keine Verfügungsmacht über sie hat, er tauscht lediglich Arbeitskraft gegen<br />
Geld und Geld gegen Waren. Der Begriff "Entfremdung" verweist weiterhin auf<br />
Veräußerbarkeit bzw. den Zwang zur Veräußerung in einer arbeitsteilig organisierten<br />
Ökonomie, wie schon der Begriff alienatio (der zugleich Entfremdung und Veräußerung<br />
meint) anzeigt. Indem ich Güter auf dem (anonymen) Warenmarkt veräußere,<br />
"entfremde" ich mich ihnen, eine quantitative Beziehung zwischen qualitativ<br />
unterschiedlichen Dingen tritt an Stelle einer Beziehung zwischen Personen mittels<br />
Dingen. »Es ist ... das bestimmte gesellschaftliche Verhältnis der Menschen selbst,<br />
welches hier <strong>für</strong> sie die ... Form eines Verhältnisses von Dingen annimmt.« (Marx<br />
1890: 86). "Personifizierung" von Gütern in der "Gabenökonomie" vs. "Verdinglichung"<br />
bzw. "Objektivierung" der Güter in der Warenökonomie also. Während in<br />
ersterer die Gabe ein Teil der Person des Gebers ist (und bleibt), sind in der Warenökonomie<br />
die Personen Anhängsel der Waren, denen ein Eigenwert innezuwohnen<br />
scheint.<br />
258 Wie Adam Smith schreibt: »Nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Brauers und Bäckers erwarten<br />
wir das, was wir zum Essen brauchen, sondern davon, daß sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen.«<br />
(1776: 17)<br />
259 Die Arbeit »vergegenständlicht ... sich während des Prozesses beständig in fremdem Produkt. [...]<br />
Der Arbeiter selbst produziert ... den objektiven Reichtum als Kapital, ihm fremde, ihn beherrschende<br />
und ausbeutende Macht, und der Kapitalist produziert ebenso beständig die Arbeitskraft als subjektive,<br />
von ihren eigenen Vergegenständlichungs– und Verwirklichungsmitteln getrennte, abstrakte, in der<br />
bloßen Leiblichkeit des Arbeiters existierende Reichtumsquelle, kurz den Arbeiter als Lohnarbeiter.<br />
Diese beständige Reproduktion oder Verewigung des Arbeiters ist das sine qua non der kapitalistischen<br />
Produktion.« (Marx 1890: 596)
148 Die Dinge des Lebens<br />
KONKURRENZ UND DISTINKTION<br />
Der gesellschaftliche "Wert" der Individuen ist im Kapitalismus weitgehend auf den<br />
quantifizierbaren Nutzen reduziert, den die Menschen im Austauschprozeß haben<br />
und der über die konsumierten Güter zum Ausdruck gebracht wird. Diese Güter<br />
sind so gut wie niemals neutrale, auf einen instrumentellen Zweck reduzierbare Gegenstände,<br />
sondern stets mit Bedeutung versehen (in unterschiedlichem Maße; der<br />
Laib Brot ist nicht derart "überdeterminiert" wie das Automobil); wir konsumieren<br />
(besitzen und gebrauchen) nicht die Dinge an sich, sondern die ihnen gesellschaftlich<br />
zugeeigneten Attribute. Die Waren sind, wie Marx schrieb, der von uns angebetete<br />
"Fetisch", mit "übersinnlichen" Eigenschaften ausgestattete Dinge. 260<br />
Diese Eigenschaften, welche ihnen qua Konvention innewohnen und die sie<br />
transportieren, geben einigen Aufschluß über ihre Wirkungsmacht. Als Prestigegüter<br />
oder Markenartikel verheißen sie "Identität", soziale Distinktion, Unterscheidbarkeit<br />
in einer Welt, in welcher die Menschen offenbar zunehmend ununterscheidbar<br />
werden (oder glauben, es zu werden). "Identität" — was immer auch das<br />
sei — wird in der bürgerlichen Gesellschaft in ihrer vermeintlichen, jedenfalls aber<br />
schmerzlich empfundenen Abwesenheit hypostasiert. In dem Maße, wie die Identifikation<br />
mit der Familie, dem Wohnort, den Produkten der eigenen Arbeit, der Arbeit<br />
selbst, schwieriger wird (der Beruf z.B. als lebenslange "Berufung" scheint mehr<br />
und mehr durch temporäre Beschäftigungsverhältnisse ersetzt zu werden), wird unser<br />
Leben auch zur Summe der Waren, die wir besitzen, konsumieren, mit denen<br />
wir uns bezeichnen. Letztlich geht es beim Konsum tatsächlich häufig nur noch um<br />
Differenzen, darum sich von anderen zu unterscheiden und darüber einen sozialen<br />
Ort bestimmen zu können. 261<br />
Ich bin, was ich konsumiere, und ich konsumiere, was ich bin — das Leben in unserer<br />
Gesellschaft erscheint aus dieser Perspektive auch als universeller Prestigewettstreit,<br />
den wir mittels der in unserem Besitz befindlichen und mehr oder weniger<br />
offen zurschaugestellten Waren führen (hierzu gehört auch der Wert unserer Ware<br />
Arbeitskraft). Das unterschiedet uns auf den ersten Blick nicht grundsätzlich von<br />
denjenigen Gesellschaften, mit denen ich mich im vorigen Kapitel befaßte. Die sog.<br />
Hopewell-Kultur Nordamerikas ist ein Beispiel <strong>für</strong> einen "archaischen" Austausch,<br />
260 Das Geheimnisvolle der Warenform besteht <strong>für</strong> Marx »darin, daß sie den Menschen die gesellschaftlichen<br />
Charaktere ihrer eignen Arbeit als gegenständliche Charaktere der Arbeitsprodukte selbst,<br />
als gesellschaftliche Natureigenschaften dieser Dinge zurückspiegelt. Daher auch das gesellschaftliche<br />
Verhältnis der Produzenten zur Gesamtarbeit als ein außer ihnen existierendes gesellschaftliches<br />
Verhältnis von Gegenständen. Durch dieses Quidproquo werden die Arbeitsprodukte Waren, sinnlich<br />
übersinnliche oder gesellschaftliche Dinge.« (Ibid.: 86) Der von Marx im Kapital beschriebene (und<br />
angeprangerte) "Fetischmus" läßt nicht nur soziale Beziehungen als Beziehungen zwischen Dingen, d.h.<br />
Waren, und damit auch Werten erscheinen; der gesellschaftliche Ursprung des Warenwerts ist darüber<br />
hinaus verschleiert.<br />
261 Darum geht es den "Wilden" zwar auch, Lévi-Stauss' berühmtes Buch über das "Wilde Denken"<br />
(1958b) dreht sich primär um diesen Punkt, die Distinktionslogik ist aber eine grundlegend andere.
Die Dinge des Lebens 149<br />
bei dem es nicht um den Erwerb notwendiger Dinge von "Verwandten", sondern<br />
begehrter Dinge, nämlich Luxusgüter, von "Fremden" ging.<br />
Der Aufschwung des Handels im östlichen Waldland Nordamerikas steht im<br />
engen Zusammenhang mit dem Aufstieg der Hopewell-Zentren im Süden der heutigen<br />
U.S. Bundesstaaten Ohio und Illinois, die um die Zeitenwende herum blühten.<br />
»Der "gemeinsame Markt" des Hopewell-Systems erstreckte sich, einschließlich<br />
randständiger Zonen, vom äußersten Südosten bis nach Kanada. [...] Gediegenes<br />
Kupfer stammte aus der Gegend um den Lake Superior, ebenso Silber, nach dem<br />
auch in Cobalt in Ohio geschürft wurde. Muskovit, Prismenquarze und Chlorit kamen<br />
aus den südlichen Appalachen. Kronen– und Flechtschnecken erwarb man an<br />
der Ostküste Floridas, die kleineren Rand– und Olivenschnecken an der Golfküste.«<br />
(Fagan 1991: 374) Bleiglanzkristalle kamen aus dem nordwestlichen Illinois oder aus<br />
Missouri, Feuersteinknollen aus Illinois oder Indiana; Obsidian stammte aus den<br />
Rocky Mountains, Chalcedon aus North Dakota und Manitoba. Diese Rohstoffe<br />
wurden nach Fagan von in Handels– und Handwerkszentren ansässigen Menschen zu<br />
Schmuckstücken oder Sakralobjekten verarbeitet, die dann bis an den Golf von Mexiko,<br />
nach Iowa und Missouri gelangten (Ibid.: 375). Ein in der Tat beeindruckender<br />
Fall von "Steinzeit-Ökonomie", in der Luxusgegenstände gehandelt wurden, die den<br />
Bedarf einer aus der Masse der Bevölkerung herausgehobenen Schicht nach sozialer<br />
Distinktion befriedigt haben dürften. 262 Konsumption ist in dieser Hinsicht keine<br />
Privatsache "autonomer" Individuen sondern eine eminent soziale Angelegenheit. 263<br />
Der prestigeträchtige Konsum von "Luxusgütern" bzw. deren Zurschaustellung<br />
zielt in erster Linie darauf ab, sich von anderen zu unterscheiden oder sich<br />
vor ihnen auszuzeichnen. A. Appadurai liefert eine diesbezüglich recht instruktive<br />
Definition. Für ihn sind Luxusgüter »Güter, deren vorrangige Nutzung rhetorisch<br />
und sozial ist, Güter die einfach inkarnierte Zeichen sind. Die Notwendigkeit auf<br />
welche sie antworten ist grundlegend politisch.« (1986a: 38) Folgende Attribute<br />
zeichnen demnach das Luxusgut aus:<br />
»(1) Beschränkung, entweder durch Preis oder Gesetz, auf Eliten; (2) komplizierte Beschaffung,<br />
welche eine Funktion wirklicher "Knappheit" sein kann oder auch nicht; (3) semiotische<br />
Ausdruckskraft; das heißt die Fähigkeit, einigermaßen komplexe soziale Nachrichten auszusenden<br />
...; (4) spezielles Wissen als Vorbedingung <strong>für</strong> ihre "angemessene" Konsumption ...; (5)<br />
eine hoher Grad der Bindung ihrer Konsumption an Körper, Person und Persönlichkeit.«<br />
(Ibid.)<br />
262 Die Existenz einer solchen Schicht bedarf eines erwirtschafteten Surplus, den sie sich (auf welche<br />
Weise auch immer) aneignen aber nicht investieren konnte. Die Hopewell-Interaktionssphäre war<br />
schließlich nur ein historisches Zwischenspiel und kein Meilenstein auf dem Weg zu weiterer<br />
"Entwicklung" von Austausch und Arbeitsteilung, um 400 n.u.Z. vollzog sich ein flächendeckender<br />
Niedergang, über dessen Ursachen die Experten streiten (vgl. Ibid. 384f.)<br />
263 »Nach Veblen wurde demonstrativer Konsum als Basis sozialer Distinktion mit dem Aufstieg der<br />
Städte wichtiger als demonstrativer Müßiggang. Dem ist so, weil Konsumgüter <strong>für</strong> die große Zahl von<br />
Menschen leichter sichtbar sind, zu denen ein Individuum im städtischen Leben nur flüchtige und oberflächliche<br />
Kontakte hat.« (Cheal 1988: 112)
150 Die Dinge des Lebens<br />
Die Waren, die wir erwerben, weisen offenbar in immer stärkerem Maße Eigenschaften<br />
des "Luxusgutes" auf. 264 Sie sind zum Teil tatsächlich überflüssig, zum Teil<br />
hochgradig symbolisch überfrachtet — letzteres gilt nicht nur <strong>für</strong> beinahe jeden<br />
Markenartikel, sondern auch (oder gerade) <strong>für</strong> den Bereich von Kunst, Musik, Literatur;<br />
ganz allgemein "guten Geschmack".<br />
Auch "kulturelle" Güter sind Konsumartikel, und als solche prinzipiell der<br />
gleichen Distinktionslogik unterworfen wie die profaneren Dinge, von denen bislang<br />
die Rede war.<br />
»Die höhere Befriedigung, die Gebrauch und Betrachtung teurer und angeblich schöner Dinge<br />
verschaffen, ist im allgemeinen nichts anderes als die Befriedigung unserer Vorliebe <strong>für</strong> das<br />
Kostspielige, dem wir die Maske der Schönheit umhängen. Unsere Liebe zu derartigen Artikeln<br />
ist im Grunde eine Liebe zur Überlegenheit und Ehre, die ihnen anhaften, und keineswegs<br />
ein Ausdruck der unvoreingenommenen Bewunderung des Schönen. Die sich hier ausdrückende<br />
Forderung nach demonstrativer Verschwendung ist uns im allgemeinen nicht bewußt,<br />
doch beherrscht sie nichtsdestoweniger unseren Geschmack, und zwar in Gestalt einer einschränkenden<br />
Norm, die unseren Schönheitssinn in selektiver Weise prägt und stützt und unser<br />
Unterscheidungsvermögen im Hinblick darauf beeinflußt, was legitimerweise schön und<br />
was häßlich genannt werden muß.« (Veblen 1899: 130)<br />
Die folgende Feststellung Bourdieus macht nochmals deutlich, worum es geht: »Geschmack<br />
klassifiziert — nicht zuletzt den, der die Klassifikation vornimmt. Die sozialen<br />
Subjekte, Klassifizierende, die sich durch ihre Klassifizierungen selbst klassifizieren,<br />
unterscheiden sich voneinander durch die Unterschiede, die sie zwischen<br />
schön und häßlich, fein und vulgär machen und in denen sich ihre Position in den objektiven<br />
Klassifizierungen ausdrückt oder verrät.« (Bourdieu 1979: 25) 265 Kunst und<br />
Kunstkonsum eignen sich — »ganz unabhängig vom Willen und Wissen der Beteiligten<br />
— glänzend ... zur Erfüllung einer gesellschaftlichen Funktion der Legitimierung<br />
sozialer Unterschiede.« (Ibid.: 27) Was <strong>für</strong> den "guten Geschmack gilt, trifft schließlich<br />
auch auf die "guten Manieren" zu:<br />
»Dem "freimütigen", ungezwungenen Essen der "einfachen Leute" setzt der Bourgeois sein<br />
Bemühen um formvollendetes Essen entgegen. "Formen" sind zunächst einmal geregelte Abläufe,<br />
die Warten, Zögern, Zurückhaltung beinhalten: vermieden werden muß der Eindruck, als<br />
stürze man sich auf die Speisen; man wartet ab, bis auch der letzte sich aufgetan hat und zu essen<br />
beginnt; man bedient sich diskret. Gegessen wird streng nach Speiseordnung, sie schreibt<br />
vor, was zusammen auf den Tisch gestellt werden darf, was auf keinen Fall: Braten und Fisch,<br />
Käse und Dessert. Keine Nachspeise, bevor nicht alles übrige — einschließlich des Salzstreuers<br />
— vom Tisch geräumt und die Krümel weggewischt sind. Dieses Verhalten, das Reglement in<br />
all seiner normativen Strenge bis in den Alltag hinein zu verlängern [ist] Ausdruck eines besonderen,<br />
nicht ablegbaren Habitus, dem Ordnungsverhalten, Haltung und Zurückhaltung konstitutiv<br />
ist, und ablegbar um so weniger, als das Verhältnis zu Essen und Trinken — primäres<br />
264 Vgl. die von Karl-Heinz Kohls aufgestellte "Hierarchie der Gegenstände" (2003: 144f.)<br />
265 Andere Gesellschaften haben mit dieser Logik ihre Probleme: Die »Sprache der symbolischen<br />
Konsumtion« ist bei den indischen Muria Gond trotz entstehender ökonomischer Ungleichheit noch<br />
nicht entwickelt — was zu dem paradoxen Ergebnis führt, daß die Reichen immer reicher werden, weil<br />
sie keine Möglichkeit haben, in einem sozial anerkannten Rahmen zu konsumieren: »Die Reichen sind<br />
verpflichtet zu konsumieren, als ob sie arm wären.« (Gell 1986: 111)
Die Dinge des Lebens 151<br />
Bedürfnis und primäres Vergnügen schlechthin — nur eine Dimension des bürgerlichen Verhältnisses<br />
zur Sozialwelt generell ausmacht: Die Opposition zwischen unmittelbar und aufgeschoben,<br />
leicht und schwer.« (Ibid.: 316)<br />
Ungleichwertige Güter signalisieren die Ungleichwertigkeit ihrer Besitzer. Liegt<br />
schon der unterschiedlichen Entlohnung verschiedener Arbeitstätigkeiten (wie im 4.<br />
Kapitel angedeutet) die Vorstellung der Ungleichwertigkeit der Arbeiten zugrunde,<br />
kommt dies wiederum in den mehr oder weniger prestigeträchtigen Gütern zum<br />
Ausdruck, welche man sich <strong>für</strong> die unterschiedliche Entlohnung anschaffen kann —<br />
ich konsumiere, was ich (wert) bin.<br />
Aber auch wenn die Häuptlinge oder Bigmen der Hopewell-Kultur scheinbar aus<br />
dem gleichen Grund konsumierten wie wir: um sich hervorzuheben, sich zu unterscheiden,<br />
jemand zu sein (und kein Niemand); so täuschen doch die Ähnlichkeiten<br />
über die gravierenden Differenzen hinweg. Was die bürgerliche Gesellschaft von den<br />
Bigman-Ökonomien Melanesiens unterscheidet, ist vor allem auch die Tatsache, daß<br />
bei uns hoher sozialer Status mitnichten mit der Verpflichtung zur Großzügigkeit<br />
verbunden ist. Mit Ausnahme demonstrativer Wohltätigkeit, die heute von eher untergeordneter<br />
Bedeutung sein dürfte, wird Reichtum zurschaugestellt oder investiert,<br />
aber nicht weggegeben. 266 Zudem ist der Prestigewettstreit in den westlichen<br />
Industriegesellschaften ein universeller, der in der expansiven Ökonomie einer spezifischen<br />
Dynamik folgt. Das, was gestern noch den Vornehmen vom gemeinen Volk<br />
unterschied, taugt schon heute nicht mehr zur Distinktion, weil es bei C&A oder<br />
ALDI im Angebot ist. 267<br />
Derjenige, mit dem ich mich im Prestigewettstreit befinde, ist darüber hinaus<br />
nicht, wie in anderen Kulturen, ein konkreter, sondern ein im Zweifelsfall höchst<br />
abstrakter anderer. Und der Satz: "ich konsumiere, was ich bin", verweist auf eine<br />
Bedürftigkeit, die weit über das Streben nach Prestige, welche nur eine ihrer Spielarten<br />
ist, hinausgeht. Es wäre völlig verfehlt, den Kapitalismus in einem humanspezifischen<br />
Streben nach Prestige fundieren zu wollen. Ähnliche kulturelle Formen<br />
können nicht aus ihrem Gesamtkontext herausgelöst werden.<br />
266 Mit Entstehung des Marktes formierte sich auch der moderne Staat, der <strong>für</strong> die öffentliche<br />
"Wohlfahrt" zuständig ist; wirtschaftliche und administrative Tätigkeiten wurden entkoppelt.<br />
267 »Prestige ist ... präsent als Handlungsmotivation bei Reziprozität außerhalb der Marktsphäre genauso<br />
wie in der Dopplung von marktökonomisch formalisiertem Handeln ... Darüber hinaus sehe ich jedoch<br />
einen epochalen Umbruch durch die innerökonomische Erzeugung von Prestige durch die Welt der Waren<br />
selbst. Gewiß, Waren als Prestigegüter gab und gibt es in allen [Ökonomien]; oft waren sie (neben<br />
Suchtmitteln) die ersten Waren überhaupt. Aber in der Industriegesellschaft wurde aus dem durch die<br />
Ware vermittelten Prestige ein Motor ökonomischer Veränderung. Durch den Erwerb von Waren<br />
erwirbt man Prestige und Identitätsmerkmale. Der massenhafte Erwerb der gleichen Ware entwertet<br />
inflationär das mit ihm verbundene Prestige. Man kann es nur durch Sich-Absetzen wieder erringen,<br />
durch Kauf neuer, noch seltener Waren. Diese werden dann ebenfalls verstärkt nachgefragt, verstärkt<br />
erzeugt, dadurch als Transporteure von Prestige wieder entwertet; das nennen wir Mode. [...] Ein sich<br />
selbst entwertendes und zugleich selbstverstärkendes Wachstum ergreift die gesamte Warenökonomie.«<br />
(Elwert 1991: 174)
152 Die Dinge des Lebens<br />
Ebensowenig, wie die Geschichte umkehrbar ist, folgt sie Gesetzen. Kein notwendiger<br />
Weg führt von den Merit-Ökonomien Melanesiens zu uns; unsere Geschichte ist<br />
unsere Geschichte, einzigartig und unwiderruflich. Der expandierende Kapitalismus<br />
schafft seine eigenen Existenzbedingungen und die Anthropologie, derer er bedarf.<br />
Er produziert nicht nur Waren und Bedeutungen, er produziert auch Bedürfnisse;<br />
Konsumenten. Die Menschen, ihres sozialen Ortes beraubt, eignen sich die realen<br />
oder kulturell phantasierten Attribute der Waren (einschl. ihrer Arbeitskraft) an,<br />
denen sie doch notwendig immer fremd bleiben; unfähig, sich zu bezeichnen und ihren<br />
Ort zu bestimmen. 268 Welch dramatischer Kontrast zum Universum der angeblichen<br />
"Wilden". In der Gabenökonomie entäußern sich die Menschen, aber sie entfremden<br />
sich nicht, hierin dürfte die alles entscheidende Differenz liegen. 269 Wie<br />
Claude Lévi-Strauss schreibt, erscheinen aus Perspektive der westlichen Industriegesellschaft<br />
»die sogenannten "primitiven" Gesellschaften ... als solche vor allem deshalb, weil sie von ihren<br />
Mitgliedern konzipiert wurden, um zu dauern. Ihre Öffnung nach außen ist sehr begrenzt<br />
... Den Fremden, sogar wenn er ein naher Nachbar ist, hält man <strong>für</strong> schmutzig und roh; oft<br />
wird ihm sogar die Eigenschaft Mensch abgesprochen. Doch umgekehrt ist die innere soziale<br />
Struktur enger gesponnen und reicher verziert als in komplexen Zivilisationen. Nichts wird<br />
hier dem Zufall überlassen, und das doppelte Prinzip, daß jedes Ding einen Platz haben und<br />
jedes Ding an seinem Platz sein muß, durchdringt das gesamte moralische und soziale Leben.<br />
Es erklärt auch, warum Gesellschaften mit einem sehr niedrigen ökonomischen Niveau oft ein<br />
Gefühl des Wohlbefindens und der Fülle empfinden und daß jede von ihnen meint, ihren Mitgliedern<br />
das Leben bieten zu können, das einzig sich lohnt, gelebt zu werden.« (Lévi-Strauss<br />
1961: 361f.)<br />
Auch wenn das vorstehende Zitat gewiß zu sehr pauschaliert und idealisiert, dürfte<br />
die Kontrastierung dennoch den Kern des Problems treffen. Denn den "Platz in der<br />
Welt" und jenes daran geknüpfte "Leben, das einzig lohnt gelebt zu werden", genau<br />
dies vermag die "fortgeschrittene" Gesellschaft ihren Mitgliedern scheinbar immer<br />
weniger zu bieten.<br />
"GEMEINSCHAFT" UND GESELLSCHAFT<br />
Man muß nicht besonders scharfsinnig sein, um zu erkennen, daß diese Entwicklung<br />
zwangsläufig zu Rekonstruktionsversuchen führen muß, die sich nicht allein im Konsum,<br />
d.h. der Aneignung der von den Waren transportierten Attribute manifestieren,<br />
sondern auch in der Sehnsucht nach verbindlichen und dauerhaften Beziehungen,<br />
nach "Gemeinschaft", Sicherheit und Intimität.<br />
268 Auch auf die Gefahr hin, daß man mir unzulässige Vereinfachung vorwirft, will ich es bei diesen<br />
Ausführungen belassen. (Zum Verlust des sozialen Ortes der Identität siehe auch <strong>Söder</strong>-<strong>Mahlmann</strong> 1992,<br />
insbesondere Kapitel 6.)<br />
269 Dieser Satz gilt <strong>für</strong> jede Form des Tauschs, bei dem der Primat der sozialen Beziehung zwischen<br />
Personen und nicht der Äquivalenzbeziehung zwischen Dingen zukommt, also auch <strong>für</strong> "primitive<br />
Handelsbeziehungen".
Die Dinge des Lebens 153<br />
Aber noch ist das Vergangene nicht gänzlich vergangen und das Fremde nicht völlig<br />
fremd:<br />
»Ein großer Teil unserer Moral und unseres Lebens schlechthin steht noch immer in der Atmosphäre<br />
der Verpflichtung und Freiheit zur Gabe. Zum Glück ist noch nicht alles in Begriffen<br />
des Kaufs und Verkaufs kodifiziert. Die Dinge haben neben ihrem materiellen auch einen Gefühlswert.<br />
Unsere Moral ist nicht ausschließlich eine kommerzielle. Noch immer gibt es bei<br />
uns Leute und Klassen, die an vergangenen Sitten festhalten, und wir alle beugen uns diesen<br />
Sitten bei besonderen Anlässen und zu bestimmten Zeiten des Jahres. Die nicht erwiderte Gabe<br />
erniedrigt auch heute noch denjenigen, der sie angenommen hat, vor allem, wenn er sie<br />
ohne den Gedanken an eine Erwiderung annimmt.« (Mauss 1925: 157) 270<br />
Zwischen Ware und Gabe besteht ein Verhältnis wechselseitiger Ausschließung;<br />
Freundschaft und Geschäft vertragen sich in modernen kapitalistischen Gesellschaften<br />
nicht. Die an die jeweiligen Formen des Tauschs gebundenen Typen sozialer Beziehung<br />
sind inkompatibel, und eine deutliche Trennlinie zwischen "persönlichen"<br />
und "ökonomischen" Beziehungen scheint aus diesem Grund in all jenen Gesellschaften<br />
zu existieren, in welchen Marktbeziehungen die Ökonomie entweder dominieren<br />
oder diese Dominanz sich anbahnt. 271 »Daß das Geld die Ordnung des Gemeinwesens<br />
und des Charakters verderbe, ist eine Auffassung, die sich regelmäßig in jenen<br />
Gesellschaften findet, in denen sich die "Geldwirtschaft" erst noch durchsetzt.«<br />
(Müller 1977: 25) 272 So insistierte bereits Aristoteles darauf,<br />
»daß der Austausch zwischen freien Menschen auf Gegenseitigkeit (antipeponthôs) beruhen<br />
muß, die den Gefühlen wechselseitiger Freundschaft (philia) entspricht, die in einer politischen<br />
Gemeinschaft (koinônia) oder in anderen freiwilligen Vereinigungen herrschen müssen. Die<br />
"ehrliche Gegenseitigkeit" schafft daher Äquivalenzen zwischen der Arbeit des Architekten und<br />
der des Schusters, die nichts mit den "Preisen" zu tun haben, die sich auf einem "freien Markt"<br />
bilden würden. [...] Was Aristoteles verurteilt, ist nicht die Existenz des Handels oder des<br />
Geldes, sondern die Existenz eines Handels um des Handels willen und das Streben nach finanziellem<br />
Gewinn "zu Lasten anderer".« (Godelier 1984: 202) 273<br />
270<br />
Zu diesen Aspekten von Mauss' Behandlung des Gabentauschs vgl. Maurice Godelier, "Das Rätsel<br />
der Gabe" (1996).<br />
271<br />
Für Polanyi (1957b) sind Marktbeziehungen notwendig sozial desintegrativ, weil die Menschen sich<br />
auf dem Markt lediglich als kontrahierende Interessen gegenübertreten. Obwohl der Markaustausch in<br />
der formalen Gleichheit der Partizipienten (und ihrer Freiheit, Produkte zu veräußern) gründet, ist er<br />
demzufolge aufgrund des antagonistischen Verhältnisses, in dem die Tauschenden zueinander stehen,<br />
Quelle ökonomischer Ungleichheit und damit sozialen Unfriedens per se.<br />
272<br />
Müller zitiert als Beleg u.a. Sophokles' "Antigone": »Denn unter allem, was Brauch ist unter den<br />
Menschen, erwuchs so schlimm nichts wie das Geld! Dieses zerstört selbst Städte, dieses treibt Männer<br />
von den Häusern, dies lehrt und es verkehrt den rechten Sinn der Menschen, üblem Tun sich<br />
zuzuwenden. Wie man zu allem fähig wird, zeigt es den Menschen und jede Art Gottlosigkeit zu<br />
wissen.« (nach Ibid.)<br />
273<br />
»Polanyi hat praktisch als erster gesehen, daß der Begriff der krêmatistikê in der Politik gleichzeitig<br />
zwei Dinge bezeichnete: zum eine die Kunst, eine häusliche (oikos) oder "ökonomische" Einheit zu<br />
verwalten, und zum anderen die Kunst, chrêmata, <strong>für</strong> die Existenz nützliche Dinge einschließlich des<br />
Geldes zu erwerben. Was Aristoteles verurteilt, ist nicht die krêmatistikê in ihrer ersten, generischen<br />
Bedeutung, sondern in ihrer zweiten, besonderen Bedeutung: die Kunst, Geld zu akkumulieren, und<br />
zwar über die Bedürfnisse <strong>für</strong> die Aufrechterhaltung des oikos und der polis hinaus in die autarkeia, d.h. in
154 Die Dinge des Lebens<br />
Eine derartige Unterscheidung zwischen "persönlichen" Beziehungen innerhalb des<br />
Gemeinwesens auf der einen, und "unpersönlichen" Handelsbeziehungen mit Fremden<br />
von außerhalb auf der anderen Seite ist auch <strong>für</strong> das europäische Mittelalter charakteristisch.<br />
Dort galten Händler »von vornherein als verdächtig. [...] Sie säten Unfrieden.«<br />
(Duby 1969: 131) Dem Ideal der christlichen communitas, der Gemeinschaft<br />
der Gläubigen, die nach Erlösung und jenseitigem Heil, und nicht nach diesseitigem<br />
Wohlleben strebte, war das Profitdenken derjenigen, die Handel trieben und<br />
Geldgeschäfte tätigten, demnach fremd. 274<br />
»Gott ist es, der die Erde den Menschen gegeben hat, ihnen jenes irdische Leben zu ermöglichen,<br />
das auf das ewige Heil gerichtet ist. [...] Mönchische Enthaltsamkeit ist das Ideal, auf das<br />
die ganze Gesellschaft ihr Augenmerk richtet. Streben nach Reichtum heißt der Sünde des Geizes<br />
verfallen. Armut ist göttlichen Ursprungs und von der Vorsehung geboten. Aber es ziemt<br />
den Reichen, diese durch Wohltätigkeit zu lindern, nach dem Beispiel der Klöster. Daher soll<br />
der Überschuß ihrer Ernten geborgen werden zur unentgeltlichen Verteilung, wie auch die<br />
Abteien ihre Darlehen Bedürftigen ohne Zins gewährten.« (Pirenne 1933: 17)<br />
In einer Epoche, in welcher der unveräußerliche Boden das "Fundament der Sozialordnung"<br />
darstellte, war der Zweck der Arbeit »nicht Bereicherung, sondern nur<br />
Beibehaltung jenes Zustandes, in dem man geboren worden ist, um also den Übergang<br />
vom irdischen ins ewige Leben zu erwarten.« (Ibid.) Die weltliche (gesellschaftliche<br />
resp. ökonomische) Ordnung begriff sich demnach als Widerspiegelung<br />
einer göttlichen Ordnung:<br />
»Die politische Restauration der Karolinger verlieh der westlichen Wirtschaft noch einen weiteren<br />
entscheidenden Charakterzug. Die karolingischen Herrscher waren gesalbt. Ihr wichtigster<br />
Auftrag war, Gottes Volk in die ewige Seligkeit zu geleiten. In ihrer Vorstellung gab es keinerlei<br />
Unvereinbarkeit zwischen ihrer geistlichen Funktion und ihrem weltlichen Handeln. Das<br />
Geistliche führte das Weltliche auf die Wege der christlichen Moral. Unter Einfluß der Kirchenvertreter,<br />
die in ihrer Umgebung lebten, insbesondere der Mönche, die zur Zeit Ludwigs<br />
des Frommen an Bedeutung gewannen, legten die Herrscher Wert darauf, daß die wirtschaftlichen<br />
Aktivitäten sich nicht zum Störfaktor der gottgewollten Ordnung entwickelten. Unter<br />
Berufung auf die Anweisungen der Heiligen Schrift wollten sie die christliche Moral insbesondere<br />
<strong>für</strong> die Praktiken des Handels, den Umgang mit Geld, und alle Tauschaktionen, in denen<br />
der Geist der Barmherzigkeit verlorenzugehen drohte, geltend machen.« (1969: 140)<br />
Da aber Spekulation und Wucher offenbar (zumindest als Handlungsoption) durchaus<br />
präsent waren, mußte dieser Moral mit expliziten Verboten Geltung verschafft<br />
werden. »So erließen die Herrscher in den Jahren, in denen schlechte Ernten oder<br />
der Unterwerfung freier Menschen oder der Stadt unter einen Willen, der dem oikos oder der polis<br />
fremd ist.« (Ibid.) Die griechische Ökonomie zur Zeit des Aristoteles war demnach noch nicht voll<br />
"entwickelt", eines ihrer charakteristischen "archaischen" Merkmale ist z.B. die Unveräußerlichkeit des<br />
Bodens, der als Basis der landwirtschaftlichen Produktion dem Markt noch kaum unterworfen war.<br />
"Händler und Fremde" konnten ihn gegen Geld nicht erwerben.<br />
274 Es handelt sich dabei aber um keine europäische Eigenart: »Das javanesische Wort <strong>für</strong> "Händler"<br />
bedeutet auch "Fremder", "Wanderer", "Vagabund". Beziehungen zwischen Händlern sind hochgradig<br />
spezifisch: geschäftliche Bande sind sorgfältig von sozialen Banden im allgemeinen geschieden. Freundschaft,<br />
Nachbarschaft und sogar Verwandtschaft sind eine Sache; Handel ist eine andere.« (Geertz 1962:<br />
376)
Die Dinge des Lebens 155<br />
Hungersnöte ihre Aufmerksamkeit auf Unregelmäßigkeiten im Warenhandel legten,<br />
Vorschriften und Verbote mit genauen Unterscheidungen zwischen dem Reinen und<br />
dem Unreinen, dem Gesetzlichen und dem Ungesetzlichen.« (Ibid.) 275 Duby zitiert<br />
in diesem Zusammenhang die folgende Vorschrift aus einem Kapitular von 806:<br />
»All die, die zur Zeit der Kornernte Korn und zur Zeit der Weinlese Wein kaufen, und dies<br />
nicht aus Notwendigkeit, sondern mit dem Hintergedanken der Bereicherung — indem sie<br />
beispielsweise einen Malter <strong>für</strong> zwei Denare kaufen und ihn aufbewahren, bis sie ihn <strong>für</strong> vier,<br />
sechs oder gar noch mehr Denare wieder verkaufen können —, machen sich eines Vergehens<br />
schuldig, das wir als unredlichen Gewinn bezeichnen. Wenn sie dagegen aus Notwendigkeit<br />
entweder <strong>für</strong> ihren eigenen Verbrauch oder zur Weitergabe an andere kaufen, bezeichnen wir<br />
dies als negocium.« (Ibid.: 140f.)<br />
Umverteilung und Mildtätigkeit entsprachen dem Selbstverständnis der Feudalordnung,<br />
nicht Handel um der Bereicherung willen. Die einzige Rechtfertigung <strong>für</strong> Kauf<br />
und Verkauf war demnach die "Notwendigkeit":<br />
»Die Moral, die den karolingischen Vorschriften zugrunde liegt, stützt sich insofern auf die<br />
biblische Lehre, als diese ihr erlaubt, die Gedanken der Eigenversorgung und der Schenkung<br />
im Wirtschaftssystem zu vertreten. Sie duldet den Handel nur zum Zweck des Ausgleichs von<br />
gelegentlichen Defiziten in der hauswirtschaftlichen Produktion. Moralisch gesehen ist der<br />
Handel ein außerordentlicher, fast sogar ungewöhnlicher Vorgang, und die, die ihn betreiben,<br />
dürfen im Prinzip keinen Gewinn daraus ziehen, der eine gerechte Entschädigung <strong>für</strong> ihre Mühen<br />
übersteigt. [...] Nach der Ordnung, die der Herrscher zu verteidigen hatte, gab es nur<br />
zwei Formen, zu rechtmäßigem Reichtum zu gelangen: entweder durch das Erbe der Vorfahren<br />
oder durch die Freigiebigkeit eines Schutzherren. Reichtum war ein Geschenk, nicht<br />
etwa das Ergebnis irgendeiner Spekulation. Der Ausdruck "beneficium" bedeutete übrigens im<br />
Vokabular nichts anderes als eine mildtätige Handlung. [...] Jedermann, gleichgültig, welchen<br />
Status er innerhalb der Besitzhierarchie innehatte, war von Zeit zu Zeit gezwungen, Anleihen<br />
zu machen, um seine Pflichten erfüllen zu können. Die christliche Moral indes verlangte, daß<br />
jeder seinem Nächsten uneigennützig half. Unter Berufung auf einen Abschnitt im zweiten<br />
Buch Moses' erklärt das Kapitular von 806: "Leihen heißt, daß man etwas zur Verfügung stellt;<br />
das Leihen ist rechtmäßig, wenn man nur das zurückverlangt, was man zur Verfügung gestellt<br />
hat." Wucher wird folgendermaßen definiert: "Wenn man mehr zurückverlangt, als man gegeben<br />
hat; wenn man beispielsweise zehn solidi gegeben hat und mehr zurückverlangt; oder<br />
wenn man einen Malter Weizen gegeben hat und zwei da<strong>für</strong> haben will." Der Wucher wird<br />
verurteilt — zweifellos mit ebenso wenig Erfolg wie der Export von getauften Sklaven. Zumindest<br />
das Prinzip war klargestellt, und zwar in ehrwürdigen Texten, die nicht so leicht in<br />
Vergessenheit geraten konnten.« (Ibid.: 141ff.)<br />
Es scheint so, als habe die Christenheit versucht, sich der Geschichte zu widersetzen.<br />
Dieser Versuch war aber von vornherein zum Scheitern verurteilt — weil die mittelalterliche<br />
Gesellschaft keine Ansammlung mehr oder weniger isolierter archaischer<br />
Gemeinwesen war, sondern Erbe des weströmischen Reiches. Ein Teil der gesellschaftlichen<br />
Wirklichkeit, der im Laufe der Jahrhunderte zunehmend an Bedeutung<br />
gewann, wurde lediglich (im reinsten Wortsinn) marginalisiert.<br />
275 Die karolingische Geldreform erscheint bei Duby als ein weniger ökonomischer denn<br />
politisch/religiöser Akt: »Die göttliche Ordnung, als deren Vertreter der Herrscher sich verstand,<br />
verlangte ... ein einheitliches Maß [der Münzen].« (Ibid.: 128)
156 Die Dinge des Lebens<br />
Wer Geld– und Bankgeschäfte tätigen wollte, mußte der christlichen Gemeinschaft<br />
fremd sein. Also befaßten sich Juden mit jenen unmoralischen, ungerechten, unheiligen,<br />
unreinen aber offenbar dringend notwendigen Transaktionen: 276 »Im frühen<br />
Mittelalter waren die Juden im großen und ganzen die einzigen gewesen, die Edelmetalle<br />
und Münzgeld akkumuliert hatten, um beides an die Christen zu verleihen.<br />
Die kirchliche Verurteilung des Wuchers betraf sie nicht. So begünstigte der Erfolg<br />
der christlichen Wirtschaftsmoral ihre Spezialisierung auf das Kreditwesen.« (Ibid.:<br />
302) Die Scheidung zwischen "moralischen" Beziehungen innerhalb des Gemeinwesens<br />
und utilitaristischen Beziehungen zu Personen von außerhalb zieht sich<br />
wie ein roter Faden durch die Geschichte. Bei dem deutschen Soziologen Ferdinand<br />
Tönnies manifestiert sie sich in dem antithetischen Begriffspaar "Gemeinschaft" und<br />
"Gesellschaft".<br />
Für Tönnies ist die Entwicklung der europäischen Gesellschaft durch einen<br />
Übergang von vormodernen Gemeinschafts– zu modernen Gesellschaftsbeziehungen<br />
gekennzeichnet, er verwendet die begriffliche Opposition als typologische, um die<br />
Auflösung traditionaler Beziehungen zugunsten neuer Bindungen zu fassen. In seiner<br />
Lesart sind die sozialen Beziehungen innerhalb der "Gemeinschaft" durch persönliche<br />
Intimität, emotionale Tiefe, moralische Verpflichtung und zeitliche Dauer charakterisiert;<br />
innerhalb der "Gesellschaft" hingegen durch Individualismus und unpersönliche<br />
Formalität, sie entspringen hier individuellem Kalkül und Eigeninteresse,<br />
nicht Tradition und moralischen Werten, wie dies in der Gemeinschaft der Fall ist.<br />
»Die Theorie der Gesellschaft konstruiert einen Kreis von Menschen, welche, wie in Gemeinschaft,<br />
auf friedliche Art nebeneinander leben und wohnen, aber nicht wesentlich verbunden,<br />
sondern wesentlich getrennt sind, und während dort verbunden bleiben trotz aller<br />
Trennungen, hier getrennt bleiben trotz aller Verbundenheiten. Folglich finden hier keine<br />
Tätigkeiten statt, welche aus einer a priori und notwendigerweise vorhandenen Einheit abgeleitet<br />
werden können, welche daher auch insofern, als sie durch das Individuum geschehen,<br />
den Wollen und Geist dieser Einheit in ihm ausdrücken, mithin so sehr <strong>für</strong> die mit ihm<br />
Verbundenen als <strong>für</strong> es selbst erfolgen. Sondern hier ist ein jeder <strong>für</strong> sich allein, und im Zustande<br />
der Spannung gegen alle übrigen. Die Gebiete ihrer Tätigkeit und ihrer Macht sind<br />
mit Schärfe gegeneinander abgegrenzt [...] Solche negative Haltung ist das normale und immer<br />
zugrundeliegende Verhältnis dieser Macht-Subjekte gegeneinander, und bezeichnet die<br />
Gesellschaft im Zustand der Ruhe. Keiner wird <strong>für</strong> den anderen etwas tun und leisten, keiner<br />
dem anderen etwas gönnen und geben wollen, es sei den um einer Gegenleistung ...<br />
willen, welche er seinem Gegebenen wenigstens gleich erachtet.« (Tönnies 1889: 34)<br />
Die so skizzierte Differenz zwischen "Gemeinschaft" und "Gesellschaft" korrespondiert<br />
ganz offensichtlich mit derjenigen von Gaben– und Warentausch. Diejenigen<br />
unserer Tauschakte, die der Logik des Gabentauschs folgen, können demzufolge als<br />
Teil einer "gemeinschaftlichen" Praxis begriffen werden, ihr primäres Ziel ist der<br />
Aufbau oder die Bekräftigung dauerhafter "persönlicher" Beziehungen zu anderen<br />
und nicht der Profit (auf Kosten anderer).<br />
276 Zur sukzessiven Aufhebung des "Wucherverbots" <strong>für</strong> Christen im Spätmittelalter vgl. z.B. Spuf-<br />
ford 2002: 33f.
Die Dinge des Lebens 157<br />
Die Gegenwart des Gabentauschs in der Warenökonomie manifestiert sich in einer<br />
Vielzahl von Praktiken, die vom Austausch von Geschenken und Einladungen über<br />
wechselseitige Hilfeleistungen unter Freunden und Nachbarn bis hin zu komplexen<br />
Netzwerken wechselseitiger Unterstützung reichen. 277 Ich will diese Beispiele nicht<br />
näher ausführen, die Leserinnen und Leser sollten diesbezüglich umstandslos ihre<br />
Alltagserfahrung befragen können. 278 Viel bedeutsamer erscheint mir die Frage, inwieweit<br />
sich derartige Transaktionen in unserer Gesellschaft von ganz ähnlichen in<br />
anderen Kulturen unterscheiden. Für Lévi-Strauss ist der Daseinszweck der Gabe so<br />
fundamental, »daß eine Veränderung ihrer Wirkungsweisen weder möglich noch<br />
notwendig ist.« (1967: 121) Man sollte diese Feststellung aber durchaus mit einem<br />
Fragezeichen versehen. Das Bedürfnis nach Gemeinschaftsbeziehungen war <strong>für</strong> Tönnies<br />
ein charakteristisches Merkmal der Moderne, deren seelenlosen Kalkül die Menschen<br />
zu entrinnen suchen.<br />
Die "persönlichen" Beziehungen innerhalb der Gemeinschaft gewinnen demnach<br />
in dem Maße an (affektiver) Bedeutung, wie die Menschen genötigt sind, sich<br />
den Anforderungen eines anonymen Marktes anzupassen. Signifikant <strong>für</strong> Geschenkaustausch<br />
und nachbarschaftliche oder freundschaftliche Hilfeleistungen (als "gemeinschaftliche"<br />
Praktiken) ist folglich ihr Kontrast zu Markttransaktionen. Wie in<br />
den "vorkapitalistischen" Gesellschaften besteht auch in der unseren ein spezifisches<br />
Spannungsverhältnis zwischen "persönlichen" und "ökonomischen" Beziehungen<br />
("Gemeinschaft" und "Gesellschaft" eben), welches in "primitiven" Kulturen, denen<br />
Märkte und Geld fremd sind, wahrscheinlich so nicht aufzufinden ist.<br />
Dieser Sachverhalt kommt auch in einer neueren Studie zum Geschenkaustausch<br />
in modernen Industriegesellschaften beispielhaft zum Ausdruck. David<br />
Cheal unterscheidet hier zwischen "moralischer" und "politischer Ökonomie"; zwei<br />
Bereichen, die in einem Verhältnis der wechselseitigen Ausschließung stehen —<br />
wiewohl die letztere die spezifische Ausprägung der ersteren zumindest zum Teil<br />
bedingt. Cheal schreibt:<br />
»Innerhalb einer moralischen Ökonomie ist die soziale Bedeutung von Individuen durch ihre<br />
Verpflichtungen gegenüber anderen, zu denen sie andauernde Beziehungen unterhalten, bestimmt.<br />
Die expansive Reproduktion dieser Beziehungen bildet das Herzstück der Gabenökonomie,<br />
ebenso wie die expansive Reproduktion des Finanzkapitals das Herzstück der Marktökonomie<br />
bildet. Zwischen diesen beiden Prinzipien besteht ein fundamentaler Widerspruch,<br />
weshalb jeder Versuch, sie in der gleichen sozialen <strong>Institut</strong>ion zu kombinieren unweigerlich in<br />
Mißklang und Konflikt endet. Denn wenn Menschen ihre Eigeninteressen durch ökonomischen<br />
277 Etliche Beispiele <strong>für</strong> von Kauf und Verkauf abweichende Tauschpraktiken in unserer Gesellschaft<br />
finden sich in Finkeldey 1999.<br />
278 Der Versuch, dem Gabentausch auch in unserer heutigen Gesellschaft nachzuspüren, ist im übrigen<br />
nicht neu und vielleicht nicht einmal sonderlich originell. So schreibt Claude Lévi-Strauss: In unserer<br />
modernen Gesellschaft ist die Gabe als »eine primitive Form des Austauschs [...] zugunsten des Tauschs<br />
verschwunden, abgesehen von einigen Überlebseln wie Einladungen, Feste und Geschenke ...« (1967:<br />
119) Gewisse Güter von geringem Gebrauchswert, wie Blumen oder Geschenkartikel, scheinen in<br />
unserer Kultur behandelt zu werden, »als müßten sie eher in der Form gegenseitiger Geschenke als in<br />
der des individuellen Kaufs und Konsums erworben werden.« (Ibid.: 112)
158 Die Dinge des Lebens<br />
Tausch zu erreichen suchen, werden die am wenigsten profitablen sozialen Beziehungen abgebrochen<br />
und durch profitablere ersetzt.« (Cheal 1988: 40) 279<br />
Bestimmte Formen sozialer Beziehungen konfligieren mit den Verhaltensimperativen<br />
des Marktes; wir können und wollen auf diese Beziehungen aber nicht verzichten,<br />
und bahnen sie deshalb über einen bestimmten Transaktionstypus, den Geschenkaustausch<br />
(bzw. den Austausch von Hilfeleistungen), an. Die so konstituierten<br />
"moralischen" Ökonomien ähneln nach Cheal in gewisser Hinsicht den "primitiven";<br />
sie sind<br />
"kleine Welten" »persönlicher Beziehungen, die den emotionalen Kern der sozialen Erfahrung<br />
jedes Individuums ausmachen. In jeder Gesellschaft leben Individuen ihr Leben innerhalb kleiner<br />
Welten der einen oder anderen Art. In primitiven Gesellschaften hauptsächlich, weil diese<br />
Gesellschaften klein waren. In modernen Gesellschaften ist dies so, weil die meisten Menschen<br />
es bevorzugen, intime Lebenswelten zu bewohnen.« (Ibid.: 15)<br />
Die modernen Gabenökonomien bestehen »zuallererst aus einem Set normativer<br />
Verpflichtungen, anderen Hilfeleistungen zu gewähren, damit diese ihre Vorhaben<br />
ausführen können« (Ibid.: 16). Ihre praktischen, "ökonomischen" Aspekte sind <strong>für</strong><br />
Cheal aber zweitrangig, primäres Ziel des Geschenkaustauschs ist <strong>für</strong> ihn »das Bemühen,<br />
Gefühle der Solidarität als Basis sozialer Interaktion zu institutionalisieren.«<br />
(Ibid.: 39) 280 — "Gefühle", die innerhalb der Marktökonomie keinen Ort haben. Es<br />
ist in unserer Gesellschaft nicht selbstverständlich und auch nicht grundsätzlich geboten,<br />
sich freundschaftlich zu verhalten, großzügig und hilfsbereit zu sein. Eine Verletzung<br />
der Normen der "moralischen Ökonomie" löst folglich heftige Reaktionen<br />
aus. Cheal spricht von einem »Gefühl des Verrats, welches der Zusammenbruch einer<br />
moralischen Ökonomie hervorruft (in Familien ebenso wie in Gemeinschaften).«<br />
(Ibid.: 16) 281<br />
Gabentausch und Geschenkaustausch ähneln sich also durchaus, sie folgen den<br />
gleichen Regeln (Geben—Nehmen—Erwidern), beide können einem ökonomischen<br />
Zweck dienen (müssen es aber nicht notwendig), Geschenk wie Gabe werden<br />
zu gewissen rituellen Anlässen überreicht, bestimmte "Klassen" von Geschenken<br />
sind zudem quasi-obligatorisch (wie z.B. Geburtstags-, Weihnachts– und Hochzeitsgeschenke<br />
an die nächsten Verwandten). Der "Geist der Gabe" ist uns keines-<br />
279 Cheals Ansatz geht auf Durkheim zurück: »Es ist Durkheims Konzeptualisierung der sozialen<br />
Ordnung, welche die Sachverhalte liefert, die zu untersuchen sind. Vor allen Dingen ist die hier<br />
vorgenommene Unterscheidung zwischen moralischer Ökonomie und politischer Ökonomie geformt<br />
auf Grundlage aktueller Diskussionen von Durkheims Idealtypen der mechanischen und organischen<br />
Solidarität als koexistierende Formen sozialen Handelns.« (Ibid.: 185, Anm.)<br />
280 Cheal lenkt, Goffman folgend, seinen Blick insbesondere auf jene ritualisierten Ereignisse (insbesondere<br />
Hochzeitsfeiern), an denen Gaben (Geschenke) getauscht werden; »Riten die den sozialen<br />
Wert zum Ausdruck bringen, der einem sozialen Objekt beigemessen wird.« (Ibid.: 23)<br />
281 »In Massengesellschaften wird die Schwierigkeit, anderen zu vertrauen oder die Abwesenheit von<br />
Vertrauen häufig als akutes Problem erlebt. Die Reaktionen anderer sind häufig unvorhersehbar, weil<br />
ihre Motive unbekannt sind; deshalb sind die Ergebnisse langer Ketten von Transaktionen ungewiß. [...]<br />
In einer moralischen Ökonomie wird Vertrauen erzeugt von Menschen, die einen gemeinsamen way of<br />
life teilen.« (Ibid.: 15)
Die Dinge des Lebens 159<br />
wegs völlig fremd. Aber es besteht auch eine entscheidende Differenz zwischen Geschenk–<br />
und Gabenökonomie, die von Cheals beständigem Rekurs auf die "Gefühle"<br />
der Tauschenden (als zentrales Element des Schenkens) markiert wird. In dieser<br />
Hinsicht sind die Ähnlichkeiten vor allem formaler Natur, die "moralische Ökonomie"<br />
konstituiert sich weniger in Anlehnung an die Gabenökonomie als in Abgrenzung<br />
zur Marktökonomie. Dergestalt gesellschaftlich völlig anders situiert als die<br />
Gabe, ist das Geschenk emotional überdeterminiert und allzu oft Teil eines regelrechten<br />
Kults des Schenkens und der Intimität. Und gerade weil sie affektiv "überhitzt",<br />
mit Bedeutungen und Erwartungen aufgeladen sind, mangelt es unseren "persönlichen"<br />
Beziehungen häufig gerade an jener Konstanz und Dauerhaftigkeit, nach<br />
der die Menschen streben.<br />
Tönnies "Gemeinschaft" und Cheals "moralische Ökonomie" müssen vor dem<br />
Hintergrund von "Modernisierung", Auflösung überkommener Bindungen und drohendem<br />
sozialem Elend vor allem auch als Ausdruck einer Sehnsucht verstanden<br />
werden, Fremdheit und Entfremdung zu entrinnen, um erneut einen festen, unverrückbaren<br />
Ort im Schoße der Gefährten zu finden. 282 In diesem Sinne ist "Gemeinschaft"<br />
nicht gegeben, sondern von der "Gesellschaft" erzeugt, als Reflex auf die sozio-ökonomische<br />
Entwicklung der Industriegesellschaften, und von daher nur sehr<br />
begrenzt mit dem "primitiven" Gemeinwesen vergleichbar. Wenngleich das Konstrukt<br />
der "Gemeinschaft" in gewisser Hinsicht auf einen universellen und irreduziblen<br />
Typus sozialer Beziehung zurückgreift, ist es andererseits in seiner konkreten<br />
Ausprägung Teil eines größeren Ganzen, der "Gesellschaft" — nicht substantiell von<br />
dieser geschieden, sondern vielmehr weitgehend von ihr determiniert. Als Negation<br />
des Kaufens ist das Schenken häufig eine Pervertierung des Gebens. Insbesondere die<br />
Fiktion, ein Geschenk werde uneigennützig und ohne den Gedanken an eine Gegenleistung<br />
gegeben, ist der scharfen Trennung von persönlichen und ökonomischen Beziehungen<br />
in unserer Gesellschaft geschuldet. Diese Trennung existiert in anderen<br />
Gesellschaften so nicht. In Gestalt des "primitiven" Handelsguts kann die Gabe<br />
gleichzeitig Ausdruck der freundschaftlichen Verbundenheit wie des ökonomischen<br />
Interesses der Tauschenden sein — weil die Partner willens sind, sich nicht zu übervorteilen.<br />
Wenn man also den Warenaustausch mittels des Gabentauschs kritisiert, darf man<br />
letzteren weder idealisieren noch die Gabe zum "Geschenk" stilisieren. Die Alternative<br />
zur Marktwirtschaft ist nicht die sentimental überfrachtete, vermeintlich "interesselose"<br />
Geschenkökonomie. Eine solche ist weder möglich, noch scheint sie mir<br />
282 Weil sie so eng mit den Idealen von Gleichheit und Gerechtigkeit verbunden ist, eignet sich die<br />
Gemeinschaftsideologie beizeiten hervorragend zur politischen Ausschlachtung. Die Sehnsucht nach<br />
Gemeinschaft kann letztendlich auch zum Terror der "Volksgemeinschaft" führen. Wobei die Ideologie<br />
der Gleichheit (unter "freien Brüdern" oder "Volksgenossen") immer auch zur Verschleierung dient.<br />
Normative Begriffe wie "Gleichheit", "Gegenseitigkeit", "Freiwilligkeit" usw., die eine Abwesenheit<br />
von Macht– und Herrschaftsstrukturen suggerieren, sind stets hochgradig verdächtig: der Rekurs auf sie<br />
kann allein dem Zweck dienen, eben diese Strukturen abzusichern.
160 Die Dinge des Lebens<br />
erstrebenswert zu sein. Wie Marcel Mauss am Ende des Essai sur le don bemerkte,<br />
soll man sich »den Bürger nicht zu gut und zu subjektiv oder zu gefühllos und zu realistisch<br />
wünschen. Er sollte ein lebhaftes Bewußtsein seiner selbst besitzen, aber auch<br />
der anderen und der gesellschaftlichen Wirklichkeit.« (1925: 163)
Die Dinge des Lebens 161<br />
ZWISCHENRESÜMEE<br />
Die "primitiven" oder archaischen Ökonomien sind nicht "gehemmt" und defizient<br />
(zumindest nicht notwendig), sie unterscheiden sich vielmehr in zentralen Aspekten<br />
grundsätzlich von der "entwickelten" Marktwirtschaft. Die Menschen in fremden<br />
Kulturen verfolgen — abgesehen von der Sicherstellung der elementarsten Grundbedürfnisse<br />
— andere Ziele, ihrem Handeln liegt eine andere Ethik zugrunde. 283<br />
Aus diesem Grund können wir unsere Maßstäbe nicht umstandslos an fremde Kulturen<br />
anlegen, es besteht weitgehend ein Verhältnis der Inkommensurabilität, d.h. der<br />
Nicht-Vergleichbarkeit.<br />
Wie aus den vorstehenden Ausführungen deutlich geworden sein sollte, ist<br />
der Tausch von Gütern und Dienstleistungen zentrales Medium der Vergesellschaftung<br />
in allen Kulturen, wobei die unterschiedlichen Modi des Tauschs mit jeweils<br />
unterschiedlichen Formen der Sozialorganisation korrespondieren. Es dürfte aber<br />
gleichfalls deutlich geworden sein, daß die radikalen Differenzen zwischen den Gesellschaften<br />
sich sehr begrenzt mittels formaler Analysen und Vergleiche erklären<br />
lassen. Das zentrale Merkmal, das die kapitalistischen Gesellschaften von allen anderen<br />
(fremden wie vergangenen) unterscheidet, ist die nicht zum Stillstand kommende<br />
expansive Dynamik, die notwendig unaufhaltsame Ausweitung von Güter– und<br />
Bedürfnisproduktion. Wie ich in den beiden vorstehenden Kapiteln darlegte, handelt<br />
es sich dabei nicht um eine zwangsläufige Entwicklung, sondern um eine historische<br />
Kontingenz.<br />
Daß die Art und Weise, wie Güter getauscht werden mit der Organisation der<br />
Produktion korrespondiert ist evident. Marktwirtschaft und industrielle Produktionsweise<br />
bedingen sich in ihrer spezifischen Ausprägung in der "entwickelten" Industriegesellschaft<br />
wechselseitig, ebenso wie in den segmentären Gesellschaften die<br />
verwandtschaftlichen Beziehungen sowohl die Sphäre der Produktion als auch der<br />
Distribution organisieren. Erzeugung und Verteilung sind aber auch Teil einer umfassenderen<br />
Totalität. Ökonomische Beziehungen können letztlich nur im Kontext<br />
des jeweiligen "gesellschaftlichen Ganzen" begriffen werden, also unter Einbeziehung<br />
der Bedürfnisse, Intentionen, Mentalitäten, Dispositionen der handelnden Individuen.<br />
284 Auch die Konsumtion ist dergestalt integraler Bestandteil der Ökonomie,<br />
283 Beide, Ziele und Ethik können von Kultur zu Kultur höchst different sein, die Vielfalt und Vielschichtigkeit<br />
der "primitiven" Tauschbeziehungen sollten hinreichend deutlich geworden sein.<br />
284 Der Vergleich der in unterschiedlichen Gesellschaften praktizierten Tauschformen führt zwangsläufig<br />
auf diesen Punkt, der gerade auch <strong>für</strong> die Wirtschaftsgeschichte von zentraler Bedeutung ist,<br />
d.h. bei der Klärung der Frage, wie unsere Gesellschaften zu dem wurden, was sie sind, und wie die<br />
weltweite Dominanz der kapitalistischen Ökonomien zu erklären ist. Wann setzte die expansive Dynamik<br />
ein, bzw. an welchem Punkt wurde sie (scheinbar) irreversibel und beschleunigte sich? In der<br />
aktuellen diesbezüglichen, an Immanuel Wallerstein (1974) anknüpfenden Debatte werden meines<br />
Erachtens diese "qualitativen" Differenzen zu wenig berücksichtigt. (Eine gute Zusammenfassung der<br />
Positionen liefert Nolte 2002). aber auch neuere Arbeiten wie z.B. von Abu-Lughod (1989), Frank<br />
(1998) und Pomeranz (2002), die zwar jeweils hervorragende Darstellungen der nicht-europäischen<br />
Ökonomien liefern, aber die zentralen Differenzen m.E. unzureichend erfassen, auch wenn Pomeranz<br />
diesbezüglich große Fortschritte erzielt und sich ein ganzes Kapitel lang mit Konsumtion und den kul-
162 Die Dinge des Lebens<br />
die eben auch eine psychische Ökonomie ist. Die Differenzen zwischen den Kulturen<br />
sind somit nicht allein formaler, sondern auch und vor allem "inhaltlicher" Natur.<br />
Teil der gesellschaftlichen Totalität sind auch die Weltauffassungen, denen die Angehörigen<br />
unterschiedlicher Kulturen anhängen. Auch diese unterscheiden sich jeweils<br />
deutlich voneinander. Und obwohl es sich bei Tauschbeziehungen und Glaubensanschauungen<br />
um (zumindest auf den ersten Blick) weit entfernte Bereiche handelt, ist<br />
doch die wissenschaftliche Auseinandersetzung jeweils erstaunlich ähnlich, weshalb<br />
eine Aufarbeitung des Diskurses über "magisches Denken" geeignet ist, die vorstehend<br />
geführte Argumentation nochmals zu stützen und zu ergänzen. Dieser Aufgabe<br />
widme ich mich im anschließenden zweiten Teil.<br />
turellen Ursachen <strong>für</strong> ökonomische Differenzen widmet. (Diese Kritik trifft übrigens auch Fernand<br />
Braudel, der die Entwicklung der Märkte im Europa des ausgehenden Mittelalters und der frühen<br />
Neuzeit untersuchte. Seine Beschreibung der Genese der Marktwirtschaft sieht die Rudimente als<br />
Kristallisationskerne, welche die entwickelte Form bereits in sich tragen; vgl. z.B. 1985: 23).
ZWEITER TEIL<br />
WISSEN UND GEWISSHEIT<br />
Formatiert
7. Kapitel<br />
DIE EVIDENZEN DES FORTSCHRITTS<br />
»Die Hoffnung auf zukünftigen Fortschritt — moralisch und geistig<br />
ebenso wie materiell — ist untrennbar verknüpft mit dem Erfolg<br />
der Wissenschaft, und jedes Hindernis, das ihr in den Weg gelegt<br />
wird, ist ein Unrecht an der Menschheit.« (James G. Frazer)<br />
Die Unterscheidung zwischen Mythos und Logos — d.h. zwischen Glauben und<br />
Wissen, Magie und Rationalität — ist zentraler Bestandteil des Selbstverständnisses<br />
des "modernen Menschen". Wie unsere Gelehrten berichten, wurde jene Fackel, die<br />
der Menschheit den Weg aus den dämmrigen Niederungen des Aberglaubens wies,<br />
vor ungefähr 2.500 Jahren in Griechenland entzündet; ein grundlegend neuer Blick<br />
auf die Welt, die Menschen und die Gesellschaft soll sich damals herausgebildet haben.<br />
Der Zeit zwischen 600 und 400 v.u.Z. verdanken wir demnach nicht nur Demokratie,<br />
Literatur, Marktwirtschaft, Theater und Naturwissenschaft, der unterstellte<br />
Übergang vom Mythos zum Logos bezeichnet ganz allgemein das Aufkommen<br />
einer neuen, bis heute gültigen, rationalen "Denkweise". 285<br />
Aber einstmals lebten auch die Griechen so wie heutzutage die Barbaren —<br />
mit dieser Feststellung, die Thukydides in der Einleitung zu seiner um 400 v.u.Z.<br />
verfaßten "Geschichte des Peloponnesischen Krieges" trifft (I,6), beginnt ein neues<br />
Zeitalter. 286 Das Buch markiert nicht nur den Beginn der modernen Historiographie<br />
(indem es eine "objektive" Methode vorgibt), in ihm kommt auch ein neues Geschichtsverständnis<br />
zum Ausdruck: Geschichte ist nicht länger eine Ansammlung von<br />
Geschichten oder Anekdoten. Thukydides beschreibt einen historischen Prozeß, eine<br />
kumulative Entwicklung:<br />
»Es ergibt sich nämlich, daß, was heute Hellas heißt, nicht von alters her fest besiedelt gewesen<br />
ist, sondern daß es Völkerwanderungen gab früher und die einzelnen Stämme leicht ihre Sitze<br />
verließen unter dem Druck der jeweiligen Übermacht. Denn da noch kein Handel war und<br />
kein gefahrloser Verkehr weder übers Meer noch auf dem Land, da alle ihr Gebiet nur nutzten,<br />
um gerade davon zu leben, und keinen Überschuß hatten, auch keine Bäume pflanzten bei der<br />
Ungewißheit, wann vielleicht ein Feind, zumal auch nichts befestigt war, kommen und ihnen<br />
alles wegnehmen würde, und da sie die nötige Nahrung <strong>für</strong> den Tag überall zu gewinnen mein-<br />
285 »Unser europäisches Denken hebt an bei den Griechen... Zweifellos ist diese griechische Form<br />
des Denkens <strong>für</strong> uns Europäer verbindlich, und wenn wir damit Philosophie und Wissenschaft treiben,<br />
so löst es sich von allen geschichtlichen Bedingtheiten und zielt auf das Unbedingte und Beständige,<br />
auf die Wahrheit, ja, es zielt nicht nur darauf, sondern erreicht es auch, Beständiges, Unbedingtes<br />
und Wahres zu begreifen.« (Snell 1946: 7)<br />
286 Obwohl Herodots Beschreibungen fremder Völker und historischer Ereignisse in seinen "Historien"<br />
auch heute noch von wissenschaftlichem Interesse sind, erzählt er doch lediglich eine mit mythologischen<br />
Elementen durchsetzte Geschichte und betreibt keine Historiographie. »Herodot steht am Ende einer<br />
Epoche. Mit Thukydides, der nur etwa zwanzig Jahre jünger war als er, befinden wir uns in einer ganz<br />
neuen Welt. Durch Thukydides ist der neue Begriff wissenschaftliche Geschichtsschreibung, der bis heute<br />
maßgebende, aufgestellt und zugleich ein Meisterwerk geschaffen worden, dessen Größe und Vorbildlichkeit<br />
nie ernsthaft in Frage gestellt wurde.« (Otto 1963: XX) Thukydides gibt eine Methode vor,<br />
und damit »beginnt die westliche Geschichtsschreibung der ungeschminkten Wahrheit oder der<br />
Triumph des Logos über den Mythos.« (Sahlins 1985: 63)
166 Die Evidenzen des Fortschritts<br />
ten, fiel es ihnen nicht schwer, auszuwandern, und darum waren sie weder durch große Städte<br />
stark noch durch sonstige Kriegsmacht.« (I,2)<br />
Erst als sie seßhaft wurden und Überschuß erwirtschafteten, begann der Aufstieg,<br />
d.h. die Zivilisierung der Griechen. Man legte die Waffen ab und trieb friedlichen<br />
Handel. »Als Hellas mächtiger wurde und Erwerb und Gewinn mehr als früher gediehen,<br />
kamen in fast allen Städten Tyrannen auf, eine Folge der wachsenden Einkünfte<br />
..., und Flotten wurden ... ausgerüstet, das Meer zu erobern.« (I,13) 287 —<br />
Über zweitausend Jahre nach Thukydides schrieb Lewis Henri Morgan, einer der<br />
Begründer der modernen Ethnologie: »Die neuesten Forschungen über den ursprünglichen<br />
Zustand des Menschengeschlechts führen zu der Schlußfolgerung, daß<br />
die Menschheit ihre Laufbahn auf der niedrigsten Stufe der Entwicklung begonnen<br />
und von der Wildheit zu Zivilisation durch langsame Anhäufungen von Erfahrungen<br />
sich emporgearbeitet hat.« (Morgan 1877: 3) Einstmals lebten nach Morgan auch die<br />
Europäer so, wie heute die Indianer. Teil dieser "ursprünglichen" Lebensweise ist<br />
nicht nur eine bestimmte Wirtschaftsweise und Sozialorganisation, sondern auch<br />
magische Anschauungen und Rituale.<br />
Ich will im folgenden überprüfen, ob und inwieweit die Schlußfolgerungen, zu<br />
denen ich im ersten Teil hinsichtlich der Differenzen zwischen den unterschiedlichen<br />
Formen des Tauschs kam — daß diese nicht allein formaler sondern vor allem auch<br />
inhaltlicher Natur sind —, auch auf die Weltauffassungen bzw. Glaubensanschauungen<br />
fremder Kulturen zutreffen. Die Behandlung der Unterschiede zwischen den<br />
"primitiven" bzw. archaischen und den "modernen" Industriegesellschaften innerhalb<br />
des wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Diskurses ist beinahe identisch,<br />
was aber nicht weiter erstaunen sollte, da es weniger dem Gegenstand als den Paradigmen<br />
geschuldet ist, denen dieser Diskurs folgt.<br />
DAS SEGELSCHIFF ALS ZEITMASCHINE<br />
Die Auseinandersetzung mit fremden Kulturen spielte seit jeher eine zentrale Rolle<br />
bei der Formierung des okzidentalen Selbstverständnisses. Die Schiffe der europäischen<br />
Entdecker bewegten sich nicht nur im Raum, sondern auch in der Zeit. Sie<br />
reisten in unser aller Vergangenheit: »In the beginning, all the world was America«<br />
(John Locke). Der Blick auf den "Wilden" war stets auch ein Blick in unsere<br />
(Vor)Geschichte, die frühen "ethnographischen" Evidenzen, welche Reisende, Verwaltungsbeamte<br />
und Missionare vom 15. Jahrhundert an in Amerika zusammentrugen<br />
erlaubten den Europäern vermeintlich,<br />
»sich die ersten Formen des sozialen Lebens zu vergegenwärtigen, sich an den Anfang der <strong>Institut</strong>ionen<br />
zu begeben und damit das verborgene Prinzip ihrer weiteren Entwicklung zu entde-<br />
287 Der Aufstieg war rasant, auch in technologischer Hinsicht: als die Phokaier um 535 v.u.Z. die<br />
verbündeten Karthager und Etrusker in der berühmten Seeschlacht bei Alalia (vor der korsischen Küste)<br />
besiegten, kannten sie »offensichtlich noch kaum die Triëre, waren vielmehr mit Fünfzigruderern<br />
ausgestattet und Langschiffen« (I,14).
Die Evidenzen des Fortschritts 167<br />
cken. Das explizite theoretische Prinzip, das der Verwendung des anthropologischen Materials<br />
allgemeine Tragweite verleiht, ist folglich die Hypothese, daß die zeitgenössischen Formen sozialer<br />
Organisation, wie man sie bei den Wilden antrifft, den vergangenen und überholten<br />
Formen sozialer Organisation der zivilisierten Völker entsprechen. Diese Hypothese einer Entsprechung<br />
von Gegenwart und Vergangenheit, von Ethnographie und Geschichte, legitimiert<br />
eine bestimmte Art und Weise der Analyse und des Vergleichs der sozialen <strong>Institut</strong>ionen.«<br />
(Godelier 1984: 80)<br />
Die sich dem Blick der Europäer in Amerika darbietende Vergangenheit des Menschengeschlechts<br />
erschien den einen als wenig erfreulich. So rekurrierte Thomas<br />
Hobbes auf das Leben der amerikanischen Indianer, um den anfänglichen regellosen<br />
"Krieg aller gegen alle" zu illustrieren. Andere hingegen erblickten in Amerika das<br />
verlorene Paradies, wo die Menschen im Zustand ursprünglicher Unschuld lebten:<br />
edle Wilde. Michel de Montaigne problematisierte bereits 1582 in seinen Essais die<br />
eigene kulturelle Position.<br />
»Waren die Art und Weise, in der diese Menschen nach gottgewolltem, natürlichem Recht ihr<br />
Leben ordneten, die Unvoreingenommenheit, mit der sie urteilten, die Spontaneität, mit der<br />
sie empfanden, nicht ein deutlicher Hinweis darauf, daß man sich im Abendland sehr von den<br />
Ursprüngen reinen Menschentums entfernt hatte? Und bot nicht jener Urzustand, ... frei von<br />
Neid und Ehrgeiz ... eine bessere Voraussetzung <strong>für</strong> die Erreichung wahrer Glückseligkeit?«<br />
(Bitterli 1991: 233)<br />
Montaignes Fragen wurden im 17. Jahrhundert von vielen Europäern aufgegriffenen,<br />
die das Bild einer "ursprünglichen" und unverdorbenen Unschuld und Reinheit im<br />
Zustand der "Wildheit" zeichneten:<br />
»Manche Kirchenmänner sprachen offen von der allgemeinen Korruption der christlichen Völker,<br />
welcher sie die Reinheit und Simplizität der frühen Sitten entgegenstellten, und gerieten<br />
mit ihrem freimütigen Lob heidnischer Lebensart in eine gefährlich unorthodoxe Haltung. Der<br />
Dominikanerpater Du Tertre, der sich um 1640 in Westindien aufhielt, verwahrte sich dagegen,<br />
daß man die Bewohner der heißen Zonen als Barbaren bezeichne, es seien dies im Gegenteil<br />
die zufriedensten, glücklichsten, wohlgestaltetsten, am wenigsten lasterhaften und<br />
sorglosesten Menschen aller Nationen der Welt. Der in Kanada tätige Franziskanerpater Sagard<br />
... zögerte nicht, sich zu fragen, ob es richtig sei, die Indianer, welche soviel glücklicher und<br />
tugendhafter wären, mit den zweifelhaften Gaben der westlichen Zivilisation zu beschenken,<br />
und der Jesuit Chauchetière schrieb 1694 …: "Wir sehen in den Wilden die schönen Überbleibsel<br />
der menschlichen Natur, wie sie bei den polizierten Völkern nur noch in vollkommen<br />
korrumpierter Gestalt erscheint... Alle unsere Patres und die übrigen Franzosen, welche Umgang<br />
mit den Wilden haben, sind der Meinung, daß diese ihr Leben auf angenehmere Art verbringen<br />
als wir".« (Ibid.: 233f.)<br />
Diese spezifische Konfrontation des Wilden mit dem Zivilisierten hatte ihren Höhepunkt<br />
in Jean-Jacques Rousseaus "Discours sur l'inégalité parmi les hommes" ("Abhandlung<br />
über den Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen") aus dem Jahre<br />
1754. »Nie zuvor ... waren Naturmensch und Zivilisationsgeschöpf in so spannungsvoller<br />
Antithese einander gegenübergestellt worden. Rousseau ging ... von der Vorstellung<br />
eines selbst unter Indianern längst verlorenen Naturzustandes aus, in welchem<br />
die Menschen, in seliger Vereinzelung ..., ohne Kenntnis von Gut und Böse<br />
und im ungetrübten Einklang mit der Schöpfung eine selbstgenügsame und sorglose
168 Die Evidenzen des Fortschritts<br />
Existenz führen.« (Ibid.: 236) Rousseau zeigte den Preis auf, der <strong>für</strong> den Fortschritt<br />
zu entrichten war: vor allem wird der Mensch zum Sklaven seiner wachsenden Bedürfnisse,<br />
Ehrgeiz und Neid entspringen der Ungleichheit der materiellen Verhältnisse<br />
und bedürfen wiederum gesetzlicher Regelungen, welche die Freiheit der Individuen<br />
beschränken:<br />
»Unser Los ist es, nachdem wir dem Naturzustand entwachsen sind, fortan im Spannungsfeld<br />
zwischen technischem Fortschritt und sittlicher Korruption existieren zu müssen. Eine Rückkehr<br />
zu den Ursprüngen ist uns nicht mehr vergönnt, aber indem wir den Blick auf die archaischen<br />
Menschen anderer Kulturen richten, die noch im glücklichen Intermediärzustand zwischen<br />
Natur und Kultur verharren, gewinnen wir Einblick in das Wesen unserer geschichtlichen<br />
Situation und eine Möglichkeit zur Neubesinnung.« (Ibid.: 237)<br />
Für Voltaire hingegen »repräsentierten die einzelnen außereuropäischen Völker die<br />
verschiedenen Stufen der Vernunftentwicklung des menschlichen Geistes, die auf die<br />
Zivilisation wie auf ihr naturbestimmtes Ziel zustrebte.« (Kohl 1979: 32) Dergestalt<br />
war der Edle Wilde 288 ein Vexierspiegel, in welchem »die zeitgenössische europäische<br />
Gesellschaft versuchte, sich selbst zu begreifen« und mit dessen Hilfe »sie lernte,<br />
sich ihrer Besonderheiten in Abgrenzung von denen fremder Völker bewußt zu<br />
werden.« (Ibid.: 29f.)<br />
DIE BÜRDE DES WEISSEN MANNES<br />
Während im 18. Jahrhunderts der Indianer noch als "wilder Philosoph" erscheinen<br />
konnte, war der Eingeborene <strong>für</strong> das 19. Jahrhundert eher ein armes, verwirrtes<br />
Kind, das uns keine Lektion lehren konnte, dem die Europäer im Gegenteil den Weg<br />
aus seiner "Unmündigkeit" weisen mußten. 289 Vor allem sollten (und sollen) sie lernen,<br />
zu arbeiten. Wie Karl-Heinz Kohl hervorhebt, bewirkte die englische Politische<br />
Ökonomie des späten 18. Jahrhunderts<br />
»eine totale Umwälzung in der Betrachtung der nicht-abendländischen Gesellschaften. Zugleich<br />
mit einem grundlegenden Wandel des Bildes vom Wilden, der seine im Sinne der Aufklärung<br />
positiven Qualität des Ursprungsnahen verliert und als Primitiver zum Sinnbild des<br />
Rohen und Unvollendeten wird, bewirkt die Gleichsetzung von Industrialisierung und Zivilisierung<br />
die endgültige Transformation des kulturellen Einheits– in ein zivilisatorisches Sendungsbewußtsein<br />
Europas.« (1979: 36)<br />
Das Thema der sanften und sorglosen Glückseligkeit des Wilden verschwindet, und<br />
an seine Stelle tritt ein Stereotyp, das sich während der gesamten Ära des Kolonialismus<br />
behaupten wird: der primitive Mensch ist "faul", Frucht einer überquellenden<br />
288 Dessen Widerpart im 18. Jahrhundert die orientalische Despotie darstellte.<br />
289 Der berühmte Entdecker Samuel Baker äußerte 1866 in einer Rede vor der Ethnological Society über<br />
die nördlichen Nilvölker: »Sie haben ausnahmslos weder einen Glauben an ein höchstes Wesen noch<br />
irgendeine Form der Verehrung und Idolatrie; auch ist die Dumpfheit ihres Geistes nicht einmal durch<br />
einen Funken Aberglauben erhellt. Ihr Geist ist so träge wie der Schlamm, der ihre kleine Welt<br />
ausmacht.« (nach Evans-Pritchard 1965: 38)
Die Evidenzen des Fortschritts 169<br />
Natur. (Leclerc 1971: 11f.) In seiner 1770 erschienenen "Inquiry into the Principles<br />
of Political Economy" schreibt James Steuart, der direkte Vorläufer von Adam<br />
Smith: 290<br />
»Wenn der Boden fruchtbar und von warmem Klima und natürlichem Wasserlauf begünstigt<br />
ist, fallen die Früchte der Erde fast von selbst an: dies läßt die Bewohner faul werden. Die<br />
Faulheit bildet das größte Hindernis <strong>für</strong> die Arbeit und die Industrie. Die Manufakturen könnten<br />
in diesen Gegenden nie aufblühen ... In den klimatisch weniger begünstigten Zonen, wo<br />
der Boden nur <strong>für</strong> jene Früchte trägt, die auch arbeiten und entsprechend fleißig sind, können<br />
wir eine vielfältige Produktion erwarten.« (nach Leclerc 1971: 12)<br />
Die schwere Verantwortung, andere Völker Jahrhunderte, ja Jahrtausende der<br />
Menschheitsentwicklung innerhalb weniger Generationen nachholen zu lassen und<br />
ihnen die Segnungen der Zivilisation nahezubringen war jene berüchtigte "Last des<br />
weißen Mannes", white man's burden. Jene Forschungsreisenden, die in der zweiten<br />
Hälfte des 19. Jahrhunderts den afrikanischen Kontinent erschlossen begriffen »sich<br />
grundsätzlich als Repräsentanten und Wortführer der "Zivilisation" und glaubten, als<br />
solche über besondere Rechte und Pflichten zu verfügen.« (Leclerc 1971: 14) Rechte<br />
und Pflichten, die in eben jener Auffassung gründeten, welche Autoren wie Lewis<br />
H. Morgan und James G. Frazer verfochten: daß nämlich die Menschheitsgeschichte<br />
eine gerichtete, gleichförmige evolutionäre Bewegung war, eine Entwicklung von<br />
"niederen" zu "höheren" Formen der Kultur. 291 Die "Primitiven" des 19. Jahrhunderts<br />
waren in diesem Schema lediglich Nachzügler, denen man Gutes tat, wenn<br />
man ihnen den Weg wies. 292<br />
Im 18. Jahrhundert hatte sich die Idee vom "Fortschritt" noch längst nicht<br />
durchgängig als interpretativer Schlüssel zum Verständnis der Geschichte durchgesetzt.<br />
293 Jedenfalls glaubte "man" vor den großen Umwälzungen, welche die ameri-<br />
290<br />
Steuarts Zeitgenossen sorgten sich allerdings eher um die Faulheit der eigenen (englischen)<br />
Bevölkerung.<br />
291<br />
Der Evolutionismus, der gegenüber den Rassentheorien ausdrücklich die psychische und physische<br />
Gleichförmigkeit des Menschengeschlechts betonte, transportierte (im reinsten Wortsinn) allerdings<br />
auch »ein Stück historischer Wahrheit: die Tatsache der Irreversibilität des durch den europäischen<br />
Imperialismus in Gang gesetzten Prozesses, in dessen Gefolge die bis dahin voneinander isolierten<br />
lokalen Kulturbedingungen in ihrer Mannigfaltigkeit aufgelöst wurden und dem zeitgenössischen<br />
Bewußtsein insofern tatsächlich als vom Gang der Weltgeschichte überrollte archaische Restbestände der<br />
Gattungsentwicklung erscheinen mußten.« (Kohl 1979: 36)<br />
292<br />
Laut Henry Morton Stanley ("Dr. Livinstone, I presume") macht allein der Kontakt mit dem Europäer<br />
den Afrikaner schnell gefügig, dieser ist »eingeschüchtert vom Bewußtsein um seine eigene immense<br />
Minderwertigkeit und erfüllt von der vagen Hoffnung, daß er sich beizeiten auch auf die Ebene dieses<br />
überlegenen Wesens erheben werde, welches ihm derart seine Bewunderung abnötigte.« (1899: 63) Die<br />
Zivilisierung dieser Wilden wird aber solange erfolglos bleiben, wie man ihnen nicht klar macht, daß das<br />
Christentum auch materielle Vorteile mit sich bringt. »Der barbarische Mensch ist reiner Materialist. Ihn<br />
verlangt, Dinge zu besitzen, die er nicht beschreiben kann. Er ist wie ein Kind, das noch nicht die<br />
Fähigkeit zur Artikulation erworben hat.« (Ibid.) Eine gute Gesamtdarstellung der europäischen<br />
"Afrikaforschung" des 19. Jahrhunderts liefert Frank McLynn (1992).<br />
293<br />
Der Zweifel an der Idee vom Fortschritt ist so alt wie diese Idee selbst und wurde in den<br />
vergangenen Jahrhunderten immer wieder neu formuliert — blieb aber im großen und ganzen bemerkenswert<br />
einflußlos. Die Geschichte der Fortschrittskritik skizziert beispielhaft Anthony O'Hear (1999).
170 Die Evidenzen des Fortschritts<br />
kanische, die französische und die industrielle Revolution mit sich brachten, (noch)<br />
daran, die Welt aktiv, auf Grundlage vernünftiger Prinzipien, gestalten zu können.<br />
Geschichte wurde als Ausfluß menschlichen Wollens und nicht als Ergebnis irgendwelcher<br />
überzeitlich gültiger Wirkungsgesetze begriffen. Hingegen schien dem Menschen<br />
des 19. Jahrhunderts, der doch soviel an Macht angehäuft hatte, merkwürdigerweise<br />
zu gefallen, sich als Spielball der Natur zu begreifen.<br />
In der Biologie meint "Evolution" die stammesgeschichtliche Entwicklung der Lebewesen<br />
von niederen zu höheren Formen. In der <strong>Soziologie</strong> resp. Anthropologie<br />
bezeichnet er die allmählich fortschreitende Entwicklung der menschlichen Gesellschaft,<br />
oder auch die Entfaltung eines humanspezifischen Potentials. 294 Edward B.<br />
Tylor, Begründer der britischen Sozialanthropologie, formulierte in einem 1889 erschienenen<br />
Aufsatz folgende Prämisse: »Die sozialen Einrichtungen des Menschen<br />
lösen einander ab wie die Ablagerungsschichten im Gestein, und zwar grundlegend<br />
einheitlich auf dem ganzen Erdball, ohne Rücksicht auf die ziemlich oberflächlichen<br />
Unterschiede von Rasse und Sprache, geformt von der gleichartigen Menschennatur.«<br />
(nach Childe 1951: 17) Auf der ersten Seite von "Primitive Culture" hatte<br />
Tylor bereits 1871 programmatisch formuliert:<br />
»Die kulturellen Verhältnisse in den verschiedenen Gesellschaften der Menschheit, soweit sie<br />
sich nach allgemeinen Prinzipien untersuchen lassen, eignen sich gut zum Studium der Gesetze<br />
des menschlichen Denkens und Handelns. Einerseits kann die Gleichförmigkeit, von der die<br />
Zivilisation so stark durchdrungen ist, in großem Maße dem gleichförmigen Wirken gleichförmiger<br />
Ursachen zugeschrieben werden; andererseits können ihre verschiedenen Stufen als Stadien der<br />
Entwicklung oder Evolution betrachtet werden, deren jede auf die frühere Geschichte zurückgeht<br />
und sich anschickt, den ihr gemäßen Teil an der Formung der zukünftigen Geschichte zu<br />
leisten.« (nach Ibid.; Hervorh. von mir)<br />
Tylor ging es also darum, die vergleichende Ethnographie als eine Wissenschaft zu<br />
konstituieren, die von der Vielfalt der Erscheinungen abstrahiert und allgemeine<br />
(Entwicklungs-)Gesetze aufdeckt, welche die Menschheitsgeschichte determinieren.<br />
Er war, was diese Intention betraf, mitnichten ein Einzelfall und auch nicht ohne<br />
Vorgänger: »Die Moralphilosophen des 18. Jahrhunderts präsentierten ihre Konzeption<br />
sozialer Systeme und soziologischer Gesetze fast ausnahmslos in der Form<br />
der Geschichtsschreibung großen Stils, als Naturgeschichte der menschlichen Gesellschaften;<br />
die anhaltende Leidenschaft ihrer viktorianischen Nachfolger bestand in der<br />
Suche nach Ursprüngen, aus denen sich die <strong>Institut</strong>ionen dank der Wirkung der Gesetze<br />
des Fortschritts entwickelt haben sollen.« (Evans-Pritchard 1950: 15) 295<br />
294 Evolution (Entwicklung) bezeichnet das Fortschreiten von einem Zustand zu einem anderen, wobei<br />
der vorherige Zustand als Vorstufe gilt. Die Voraussetzungen einer solchen Entwicklung sind die kausale<br />
Bedingung und Bestimmung des späteren durch den früheren Zustand und die Kontinuität der<br />
Entwicklung (d.h. es findet keine völlige Neuschöpfung statt).<br />
295 Auch wenn man von "Evolution" spricht, kann man sich allerdings durchaus auch damit begnügen,<br />
den Gang der Geschichte bezogen auf unsere Gesellschaft, die den Maßstab vorgibt, lediglich zu beschreiben.<br />
Wie V. Gordon Childe hervorhebt, ist seine berühmte Skizze der "sozialen Evolution" eine
Die Evidenzen des Fortschritts 171<br />
Die Theorie der sozialen Evolution wurde zuerst von Lewis H. Morgan systematisiert<br />
und mit ethnologischen wie historischen Evidenzen korreliert. Morgan wollte<br />
Beweise beibringen »<strong>für</strong> die ursprünglich rohe Beschaffenheit der gesamten Menschheit,<br />
<strong>für</strong> die stufenweise Entwicklung ihrer geistigen und sittlichen Kräfte durch Erfahrungen,<br />
und <strong>für</strong> den langwierigen Kampf, den sie mit den ihrem mühsamen Vordringen<br />
zur Zivilisation sich entgegenstellenden Hindernissen zu bestehen hatte.«<br />
(1877: 3). Eine Rekonstruktion dieses Weges ist demnach möglich, weil die <strong>Institut</strong>ionen<br />
»der barbarischen und selbst der wilden Vorfahren der Menschheit noch<br />
gegenwärtig in einzelnen Teilen des Menschengeschlechts so vollständig zu finden<br />
sind, daß mit Ausnahme der allerursprünglichsten Periode die verschiedenen Stadien<br />
dieses Fortschritts ziemlich gut sich erhalten haben.« (Ibid.: 6f.) Morgan richtete sein<br />
Augenmerk neben den "Erfindungen und Entdeckungen" hauptsächlich auf die Veränderungen<br />
im Bereich der "Familienordnungen" (seine Auslassungen zu den "primitiven"<br />
Verwandtschaftsbeziehungen begründen seinen Ruhm mindestens ebenso<br />
sehr wie sein Entwicklungsmodell als solches), verortete den Fortschritt aber auch<br />
auf den Gebieten "Lebensunterhalt" (Produktion), "Gesellschaftsverfassung" (politische<br />
Organisation), Sprache, Religion, "Häusliches Leben und Baukunst" sowie "Eigentum".<br />
Morgans "Kulturstufen" sind Kombinationen aus je spezifischen Entwicklungsstadien<br />
dieser Bereiche; die Kultur der Menschheit hat <strong>für</strong> ihn »überall ziemlich<br />
den gleichen Weg durchlaufen« (Ibid.: 7), einen Weg, der von der Wildheit über die<br />
Barbarei zur Zivilisation führt, wobei Morgan die ersten beiden dieser Stufen jeweils<br />
in Unter-, Mittel– und Oberstufe gliederte. Während er <strong>für</strong> die "Unterstufe der<br />
Wildheit" keine lebenden Zeugnisse auffand, verortete er die "Mittelstufe" (die mit<br />
der Nutzung des Feuers und dem Fischfang begann) bei den Australiern und Polynesiern,<br />
und die "Oberstufe" (die mit der Erfindung von Pfeil und Bogen einsetzte) bei<br />
jenen amerikanischen Indianern, denen die Töpferkunst, welche ihm den Übergang<br />
zur "Unterstufe" der Barbarei markiert, unbekannt war. Die "Mittelstufe" der Barbarei<br />
beginnt in der alten Welt mit der Domestikation von Haustieren, in der neuen<br />
mit der Züchtung von Mais nebst der Nutzung von luftgetrockneten Ziegeln zum<br />
Hausbau, während die Eisenbearbeitung den Übergang zur "Oberstufe" kennzeichnet.<br />
Die Zivilisation setzt schließlich mit der Entwicklung des phonetischen Alphabets<br />
ein.<br />
Geschichte und Ethnologie wurden derart von Morgan unbekümmert verknüpft,<br />
die vermeintlich "einfachen" und undifferenzierten Gesellschaften an Stelle<br />
unserer eigenen Geschichte gesetzt: in ihnen glaubte er ein Bild des ursprünglichsten<br />
Zustandes des Menschen und seiner Kultur — der "Kindertage der Menschheit" —<br />
gefunden zu haben. Morgans Ansatz war allerdings mitnichten revolutionär — die<br />
Auffassung, daß die "primitiven" Kulturen Rückschlüsse auf unsere Vergangenheit<br />
deskriptive, die »nicht den Mechanismus des kulturellen Wandels« beschreibt. »Sie stellt nicht dar,<br />
warum Kulturen sich ändern — das ist Gegenstand der Geschichtswissenschaft —, sondern wie sie sich<br />
ändern.« (1951: 25f.)
172 Die Evidenzen des Fortschritts<br />
erlaubten, war, als Morgan 1877 "Die Urgesellschaft" veröffentlichte, keineswegs<br />
eine sensationelle These, ebensowenig wie das klassifikatorische Raster, mit welchem<br />
er arbeitete — Adam Ferguson unterschied bereits 1768 in seinem Essay on<br />
the History of Civil Society zwischen "Wildheit", "Barbarei" und "Zivilisation" als<br />
Stufen des Fortschritts (vgl. Childe 1951: 14). Morgan vollzog aber den Übergang<br />
von der spekulativen zur (vermeintlich) wissenschaftlichen Ethnologie, er war der<br />
erste, der die Gleichsetzung von fremden und vergangenen Kulturen im Rahmen eines<br />
großflächigen Vergleichs konsequent vornahm, um ein konsistentes Entwicklungsmodell<br />
zu konstruieren. 296 Zwar wurde bereits »zu Beginn des 20. Jahrhunderts<br />
und im Zuge der allgemeinen Krise des Evolutionismus in den Sozialwissenschaften<br />
... die rigide Vorstellung, die in dieser Denkweise enthalten ist, der Kritik<br />
unterworfen und zurückgewiesen, nämlich die Vorstellung, es gebe eine monolineare<br />
Entwicklung der sozialen <strong>Institut</strong>ionen.« (Childe 1951: 81) 297 Morgans materiale<br />
Ausarbeitung erschien schon bald als ebensowenig tragfähig wie sein theoretisches<br />
Modell, dennoch hielt sich die Idee des notwendigen und unhintergehbaren<br />
Fortschritts ebenso hartnäckig wie die Praxis der Gleichsetzung der rezenten "Primitiven"<br />
mit unserer eigenen Vergangenheit. 298<br />
Der wohl berühmteste Vertreter des ethnologischen Evolutionismus war Sir<br />
James G. Frazer. Frazer interessierte sich allerdings nur beschränkt <strong>für</strong> den Gesamtkontext<br />
der "primitiven" Kulturen, er richtete sein Augenmerk vornehmlich auf einen<br />
einzigen Wesenszug: das magische Denken. Der erste Band des berühmten "The<br />
Golden Bough" (dt.: "Der goldene Zweig"), jener Bibel des Evolutionismus, erschien<br />
1890, »auf dem Höhepunkt imperialer Zuversicht.« (Schama 1995: 230) Als<br />
Gefolgsmann von Spencer und Tylor nahm Frazer an, »daß sich der Fortschritt in der<br />
Evolution der Menschheit an dem Ausmaß manifestierte, mit dem sie die Mythen<br />
und die Magie der primitiven Religionen abgeschüttelt hatte.« (Ibid.) 299 Den Siegeszug<br />
der westlichen Zivilisation führte Frazer letztlich auf ihre Denkweise zurück, die<br />
wissenschaftliche Weltauffassung wurde als Ergebnis einer langen Geschichte begriffen,<br />
die ihren Endpunkt im viktorianischen Zeitalter erreicht hatte — einer Ge-<br />
296 Morgans Modell wurde u.a. von Friedrich Engels in seiner Schrift "Der Ursprung der Familie, des<br />
Privateigentums und des Staates" aufgegriffen.<br />
297 Die Vertreter der funktionalistischen Ethnologie verdammten die evolutionistische Anthropologie,<br />
»nicht nur, weil ihre historischen Rekonstruktionen nicht verifizierbar sind«, sondern allein schon<br />
deshalb, weil sie auf einem historischen Ansatz fußt: »nach Ansicht der Funktionalisten ist die Geschichte<br />
einer Gesellschaft irrelevant <strong>für</strong> ihre Erforschung als natürliches System.« (Ibid: 13) Daher<br />
rührt auch das große Gewicht, das spätestens nach Malinowski auf detaillierte Feldforschungen gelegt<br />
wurde.<br />
298 Noch auf der berühmten Man the Hunter-Konferenz im Jahre 1965 wurden von etlichen der Teilnehmer<br />
die noch existierenden Jäger und Sammler-Gesellschaften als lebende Zeugen unserer Vorgeschichte<br />
bemüht, einer einstmals universellen Lebensweise. Diese Auffassung wurde allerdings<br />
schon auf der erwähnten Konferenz von Leonard Freeman (1968) kritisiert.<br />
299 Wollte Frazer die Welt zur Wissenschaft bekehren (und der Religion den Todesstoß versetzen),<br />
bedingten <strong>für</strong> andere Zivilisierung und Missionierung sich wechselseitig. Man mußte kein Atheist sein,<br />
um Evolutionist sein zu können.
Die Evidenzen des Fortschritts 173<br />
schichte vom Aufstieg des Menschen aus den archaischen Tiefen des magischen Denkens<br />
in das klare Licht der Vernunft.<br />
DAS MAGISCHE UNIVERSUM<br />
Die An– bzw. Abwesenheit magischer Glaubensanschauungen und Praktiken verweist<br />
auf die tiefe Kluft, welche den leidlich zivilisierten Westeuropäer von jenem<br />
nackten Wilden trennt, der einen magischen Ritus zelebriert. In den sog. "primitiven"<br />
Kulturen existiert (scheinbar) kaum ein Bereich des Lebens, der nicht von magischen<br />
Vorstellungen durchdrungen ist, und keine wichtige Tätigkeit, die nicht von<br />
magischen Riten begleitet wird; dies ist in unserer Gesellschaft nicht (mehr) der Fall.<br />
Magie und die ihr zugrundeliegenden Vorstellungen sind unserer Kultur nicht nur<br />
fremd, sie sollen ihr fremd sein. Der normative Charakter des über ihn geführten<br />
Diskurses ist Grund genug, einen Gegenstand zu reexaminieren, an dem das Selbstverständnis<br />
unserer Kultur exemplarisch zum Ausdruck kommt.<br />
Der Begriff Magie stammt aus dem Altiranischen: maga bedeutet so etwas wie<br />
"außeralltägliche Kraft". Er umfaßt »alle Arten und Praktiken einer Weltauffassung,<br />
die sich durch Zaubermittel Geheimkräfte in Natur und Welt dienstbar machen<br />
will...« (Meyers Handlexikon); Magie und Zauber »bringen Wunsch und Wirklichkeit<br />
in Übereinstimmung und Vermitteln die Vorstellung, Macht über Dinge und<br />
Lebewesen jenseits der Verstandeskategorien zu besitzen.« (B. Streck im "Wörterbuch<br />
der Ethnologie") Hubert und Mauss unterscheiden in ihrem "Allgemeinen<br />
Entwurf einer Theorie der Magie" zwischen dem Magier, magischen Vorstellungen<br />
und magischen Riten: »Die Magie umfaßt Handelnde, Handlungen und Vorstellungen:<br />
Magier nennen wir das Individuum, das magische Handlungen vollzieht...; magische<br />
Vorstellungen nennen wir die Ideen und Überzeugungen, die den magischen<br />
Handlungen korrespondieren; die Handlungen, auf die bezogen wir die anderen<br />
Elemente der Magie definieren, nennen wir magische Riten.« (1902/03: 52) Magie,<br />
Hexerei, Zauberei, Orakel, Schamanismus — das Inventar magischer Praktiken ist<br />
allerdings derart vielfältig (und von Kultur zu Kultur höchst unterschiedlich), daß es<br />
schwerfällt, seinen gemeinsamen Nenner zu identifizieren. Deshalb will ich mich zunächst<br />
damit begnügen, einige Beispiele <strong>für</strong> magische Handlungen anzuführen.<br />
Bei den Trobriand-Insulanern z.B. ist die Bestellung der Yamsgärten von magischen<br />
Ritualen durchdrungen; als reiche es nicht aus, sorgfältig zu arbeiten. »Magie<br />
und praktische Arbeit sind in der Vorstellungswelt der Eingeborenen untrennbar<br />
miteinander verbunden, obschon sie niemals verwechselt werden. Gartenmagie und<br />
Gartenarbeit laufen zu einem Strang einander folgenden Leistungen zusammen, sie<br />
bilden eine fortlaufende Geschichte und müssen Gegenstand einer Erzählung sein.«<br />
(Malinowski 1935: 81) Für das Gedeihen der Pflanzungen ist Magie demnach aus der<br />
Perspektive der Eingeborenen ebenso unerläßlich »wie eine kompetente und wirksame<br />
Bewirtschaftung der Gärten. Unentbehrlich ist sie etwa <strong>für</strong> die Fruchtbarkeit<br />
des Bodens. [...] Man betrachtet sie geradezu als natürliches Element im Wachstum
174 Die Evidenzen des Fortschritts<br />
der Gärten.« (Ibid.: 81f.) 300 So wird jede Phase der Gartenarbeit von einem entsprechenden<br />
magischen Ritual begleitet, das von einem towosi genannten Gartenmagier<br />
zelebriert wird. Das erste dieser Rituale wird vor der Rodung und Säuberung der<br />
Gartenparzellen abgehalten und soll die Fruchtbarkeit des Bodens garantieren, das<br />
letzte bezieht sich auf die Yamshäuser, in denen die Ernte gelagert wird, und soll die<br />
Knollen haltbarer machen. Man geht gewiß nicht zu weit mit der Behauptung, daß in<br />
den "primitiven" Kulturen keine Pflanzung ohne die entsprechenden magischen Rituale<br />
bestellt wird.<br />
Eine andere Klasse magischer Riten dient dazu, Kranke zu heilen: "Schamanismus"<br />
(im weitesten Sinne). Allan Hanson liefert ein instruktives Beispiel <strong>für</strong> einen<br />
einfachen Akt sogenannter "kontagiöser" Magie. »Bei den Mardudjara der westaustralischen<br />
Wüste führt man Fieber auf "schlechtes" oder "heißes" Blut zurück.<br />
Die Heilmethode besteht darin, dem Patienten Blut abzuzapfen und es in den Schatten<br />
zu stellen, damit es abkühlen kann. 301 Man glaubt, daß dies dem Kranken Kühlung<br />
verschafft, obwohl es anscheinend nicht wieder in seinen Blutkreislauf eingeführt<br />
wird.« (Hanson 1981: 247) Die Beispiele <strong>für</strong> schamanistische Praktiken sind<br />
außerordentlich vielfältig. Wie bei der Gartenbestellung scheint aber auch hier die<br />
Magie lediglich eine ergänzende Funktion zu haben, in der Regel begleitet der Ritus<br />
ein "profaneres" Heilverfahren. 302<br />
Letztlich scheint es keinen Bereich des Lebens zu geben, der nicht Gegenstand eines<br />
magischen Ritus werden könnte. So bindet der zentralafrikanische Zande, der unterwegs<br />
ist und bei Tageslicht sein Haus erreichen möchte, einen Stein in eine Astgabel,<br />
um den Sonnenuntergang zu verzögern. Und die Trobriander halten vor ihren<br />
Cricket-Matches Wettermagie ab, um zu verhindern, daß ein tropischer Wolkenbruch<br />
das Spiel unterbricht. Diese Reihe ließe sich endlos fortsetzen.<br />
Wenn Magie schädliche Ereignisse oder Einflüsse abwehren soll, so sind diese<br />
häufig selbst wiederum auf Magie zurückzuführen. Ein wichtiger Bestandteil des magischen<br />
Universums ist dergestalt das Wechselspiel von Zauber und Gegenzauber. In<br />
diesen Kontext gehört das (neben Malinowskis Beschreibung der Gartenbau-Magie<br />
der Trobriander) vielleicht berühmteste und folgenreichste Beispiel <strong>für</strong> magische<br />
Vorstellungen und Praktiken: der von Evans-Pritchard beschriebene Hexereiglaube<br />
der Zande. Alles, was die Gesundheit und das materielle Wohlergehen der Men-<br />
300 »Oft wurde ich gefragt: "Welche Magie macht ihr in eurem Land über den Gärten, ist sie wie unsre<br />
oder ist sie anders?" Sie scheinen unsere Gewohnheiten, wie ich sie beschrieb, keineswegs gutzuheißen.<br />
Ich sagte nämlich, daß wir gar keine Magie machen, bzw. die Magie insgesamt durch unsere "misinaris"<br />
(Missionare) im bwala tapwaroro, dem Haus des Gottesdienstes, praktizieren lassen. Sie bezweifelten, daß<br />
Yams bei uns "richtig aufgehen", "sein Laub hoch aufschießen", und "die Knollen dick werden"<br />
können.« (Ibid.)<br />
301 Grundlage dieser Praktik ist die Vorstellung, daß Dinge, die einmal zusammengehörten, fortfahren,<br />
aufeinander einzuwirken. Ich komme weiter unten darauf zurück.<br />
302 So suchen offenbar viele Afrikaner (insbesondere in ländlichen Gebieten) heutzutage im Falle einer<br />
Krankheit sowohl den Arzt als auch den "Medizinmann" auf.
Die Evidenzen des Fortschritts 175<br />
schen gefährdet, führen die Zande zurück auf Hexerei oder Zauberei (die damit <strong>für</strong><br />
die Zande von der Magie unterschieden wird). Da die Mächte des Schicksals (oder<br />
des Zufalls, wie man will) nicht greifbar sind, werden sie personalisiert. Ihre Vorstellung<br />
von Hexerei ist <strong>für</strong> die Zande nach Evans-Pritchard eine »Naturphilosophie,<br />
mit der das Verhältnis zwischen Menschen und unglücklichen Ereignissen erklärt<br />
wird.« (1937: 60) Dieses Konzept liefert den Menschen ein »vorgefertigtes und stereotypes<br />
Mittel«, auf solche unglücklichen Ereignisse zu reagieren. »Der Glaube an<br />
Hexerei umfaßt außerdem ein Wertsystem, das menschliches Verhalten regelt.«<br />
(Ibid.)<br />
Hexerei hat stets eine negative Bestimmung, d.h. sie ist einzig und allein<br />
schädlich, der Hexer hat keinen weiteren "Nutzen" als die Befriedigung, seinem Rivalen<br />
geschadet zu haben. Hexerei wirkt entweder direkt auf Personen, indem sie<br />
diese krank oder unaufmerksam macht; oder sie wirkt auf Ereignisse und Sachverhalte,<br />
die <strong>für</strong> eine Person wichtig sind; sie wird als Erklärung erst dann herangezogen,<br />
wenn eine Sache sich (nach Auffassung der Zande) so nicht hätte ereignen<br />
dürfen. Hexerei erklärt Ereignisse zudem niemals hinreichend: »Wir würden die<br />
Philosophie der Zande falsch darstellen, wenn wir sagten, daß ihrer Meinung nach<br />
Hexerei die einzige Ursache der Erscheinungen sei.« (Ibid.: 65) Im Falle unglücklicher<br />
Ereignisse wird stets eine doppelte Verursachung postuliert: Eine "natürliche",<br />
auf Tabuverletzungen (Vergehen gegen "Gesetz und Moral"), Inkompetenz,<br />
Faulheit, Unwissenheit usw. zurückgehende, und eine "übernatürliche", aus der Hexerei<br />
rührende.<br />
Da Hexerei stets Ausfluß feindseliger Gefühlsregungen ist, wird bei jedem<br />
sich abzeichnenden Unglück (z.B. einer Krankheit, die zum Tode führen kann) oder<br />
vor jeder wichtigen, von möglichem Scheitern bedrohten Unternehmung mit Hilfe<br />
des berühmten "Hühnerorakels" (oder anderen Orakeln) nach möglichen "Feinden"<br />
gesucht, d.h. nach einer potentiellen Quelle der Hexerei. Wenn Hexerei im Spiel<br />
ist, geht sie stets von einer Person aus und hat wiederum ihre Wurzeln in bestimmten<br />
"asozialen" Gefühlen und Strebungen: Haß, Neid, Mißgunst usw. Aber<br />
auch wenn die Zande offensichtlich ständig davon reden, daß Hexerei im Spiel sei,<br />
gehen sie dieser doch nur in sehr bedeutsamen Fällen nach und befragen die Orakel.<br />
Die Befragung des Hühnerorakels funktioniert folgendermaßen: Eine Gruppe von<br />
Männern begibt sich mit einer Anzahl Hühner und dem erforderlichen Orakelgift<br />
(benge) in den Busch. Dann beginnt die Befragung, bei der den Hühnern das Gift<br />
verabreicht wird. Evans-Pritchard gibt folgende kurze Beschreibung von deren Ablauf:<br />
»Es gibt zwei Proben: bambala sima, die erste Probe, und gingo, die zweite<br />
Probe. Stirbt ein Huhn bei der ersten Probe, dann muß ein anderes Huhn die zweite<br />
Probe überleben, damit der Urteilsspruch anerkannt werden kann.« (Ibid.: 203) Die<br />
Frage wird also so formuliert, daß das Orakel das eine Huhn bei der ersten Probe töten<br />
und das andere bei der zweiten verschonen muß; also z.B. "wenn X der Hexerei<br />
schuldig ist, Giftorakel, töte das Huhn" <strong>für</strong> den ersten, und, falls das Huhn gestorben<br />
ist, "wenn die Erklärung wahr ist, dann verschone das Huhn".
176 Die Evidenzen des Fortschritts<br />
Ein Zande wird zum Hexer »wenn ihn Haß, Neid, Eifersucht und Habgier dazu veranlassen.<br />
Ist er einem Menschen nicht feind, dann greift er ihn gewöhnlich auch nicht<br />
an. Darum überlegt ein Zande, dem ein Unglück widerfahren ist, sofort, wer ihn<br />
wohl hassen könnte.« (Ibid.: 92) Das Ungewöhnliche an diesem Konzept ist, daß<br />
dem Hexer selbst sein schädliches Wirken nicht bewußt sein muß; er weiß offenbar<br />
zumeist nicht, daß er ein Hexer ist. Da negative Gefühlsregungen Ursache der Hexerei<br />
sind und letztlich jeder zum Hexer werden kann, mag es ratsam sein, sich über<br />
die eigenen Gefühle den Nachbarn gegenüber Rechenschaft abzulegen und sie gegebenenfalls<br />
zu "kühlen". Sollte man ohne bewußte Absicht zum Hexer geworden<br />
sein, so ist dies zwingend: »Fast immer antwortet der Hexer höflich, daß er sich<br />
nicht bewußt sei, irgend jemandem zu schaden; sei es aber wahr, daß er dem Betroffenen<br />
geschadet habe, täte es ihm sehr leid. [...] Er sagt, daß er die Hexerkraft in<br />
seinem Bauch anspräche und sie ersuche kühl (unwirksam) zu werden, und daß er<br />
diese dringende Bitte von Herzen und nicht bloß mit den Lippen ausspreche.« (Ibid.:<br />
88) Es geht kaum zu weit zu behaupten, daß derjenige, der reinen Herzens ist und in<br />
gutem Einvernehmen mit seinen Nachbarn lebt, niemals der Hexerei beschuldigt<br />
wird, da sein Name kaum jemals Gegenstand der Orakelbefragung ist.<br />
Hexerei ist demnach »tendenziell identisch mit den Gefühlen, die sie angeblich<br />
verursachen, so daß die Zande Haß, Neid und Habgier als Hexerei und umgekehrt<br />
Hexerei als die Gefühle, die sie ausdrückt, denken.« (Ibid.) Ein "gutes Mitglied<br />
der Gemeinschaft" hext nicht (so scheint es) und pflegt zu allen Zeiten gute<br />
Nachbarschaft. »Ein guter Mann ist wohlgelaunt, ein guter Sohn, Ehemann und Vater,<br />
seinem Prinzen treu, im Umgang mit seinen Mitmenschen gerecht, in seinen<br />
Geschäften redlich, ein Mann der die Gesetze befolgt und Frieden stiftet, einer, der<br />
Ehebruch verabscheut, der gut über seine Nachbarn spricht und jemand, der gewöhnlich<br />
gefällig und höflich ist.« (Ibid.: 97) 303 — Soviel zu Hexerei und Gegenzauber.<br />
304 Magie muß nicht derartige Formen annehmen. Sie wird auch ausgeübt, um<br />
die Gleichförmigkeit und Berechenbarkeit des "Weltverlaufs" sicherzustellen. Ein<br />
Beispiel <strong>für</strong> eine sehr einfache diesbezügliche magisch-rituelle Handlung liefert Pierre<br />
Clastres: bei den bereits im ersten Teil bemühten Guayaki werden nach der Geburt<br />
eines Kindes verschiedene rituelle Zeremonien ausgeführt. Dem Ethnologen<br />
fallen hier einige scheinbar beiläufige Gesten eines jungen Mädchens auf:<br />
»Unter dem Blätterdach ihrer Eltern brennt ein Feuer; sie entnimmt ein brennendes Scheit,<br />
kommt, um es in den Behälter mit dem reinigenden Wasser einzutauchen, und bringt es so<br />
zum Erlöschen. Dann trägt sie es zur Hütte zurück und legt es wieder an seinen Platz neben<br />
den anderen Scheiten. Auf meine verwunderte Fragen hin antworten die Indianer, daß dieses<br />
303 Die Zande fühlen sich der Hexerei keinesfalls ausgeliefert, denn erstens ist sie alltäglich und zweitens<br />
gibt es Gegenmaßnahmen. Aus diesem Grund bezweifelt Evans-Pritchard, »daß jemals ein Zande, weil<br />
er wußte, daß er behext worden ist, gestorben ist, oder <strong>für</strong> längere Zeit an ernsthaften körperlichen Beschwerden<br />
litt.« (Ibid.: 82)<br />
304 Die Anwesenheit derartiger Vorstellungen schließt übrigens religiöse Vorstellungen nicht aus. Die<br />
Zande verehren laut Evans-Pritchard ein geisterhaftes "Höchstes Wesen" (Mbori), dem die Erschaffung<br />
der Welt zugeschrieben wird und das in einer Höhle am Fluß lebt (Ibid. 310).
Die Evidenzen des Fortschritts 177<br />
dazu diene "y pirä mombo, y pirä wachu ubmy mombo" zu verhindern: daß das rote Wasser nicht<br />
überflutet, daß das tiefe rote Wasser sich nicht erhebt und überflutet. Der Ausdruck rotes Wasser<br />
oder tiefes rotes Wasser bezeichnet in der Mythologie der Guayaki die Weltflut, die einst die<br />
Menschen fast völlig ausgelöscht hat. Das Verhalten des Mädchens trachtete also (sicher wohl<br />
auf Geheiß der Erwachsenen) danach, die Wiederholung einer solchen Sintflut zu verhindern.«<br />
(Clastres 1972: 28)<br />
Die Welt ist <strong>für</strong> die Menschen eingerichtet, und die Menschen sind <strong>für</strong> ihren Erhalt<br />
verantwortlich. Die blaue Rauchfahne, die aus dem Feuer, in welches die Frauen<br />
Wachsklumpen werfen, zum Himmel emporsteigt, erhält und bezeugt die Ordnung<br />
der Welt. Am Ursprung dieser Welt standen der Duft und der Rauch von verbranntem<br />
Wachs:<br />
»Damit die Welt werden konnte, was sie heute ist, bedurfte es eines Aché, der choa-Wachs ins<br />
Feuer goß. Das war zu jener Zeit, als die Sonne unbeweglich im Zenit stand und die Erde versengte.<br />
[...] Eines Tages war ein Mann mit seinem noch nicht initiierten Sohn unterwegs. Dabei<br />
stießen sie auf den großen Topf des Baiö. "Rühr ihn nicht an! Rühr den Baiö-Topf nicht<br />
an!" warnte der Vater. Doch das Kind gehorchte nicht, mit einem Schlag seines Knüppels zerschlug<br />
es den Tontopf. Aus der Öffnung, die sich auftat, floß ein Strom von Asche, auch die<br />
Tiere und Vögel des Waldes, alle Haustiere von Baiö und schließlich — furchterregend, weil<br />
man nicht wußte, was das war — die Dunkelheit, die Nacht, die sich an Stelle des ewigen<br />
Lichts, des ewigen Tages schob und alles überflutete. [...] Die ungezogene Hand des Jungen<br />
hatte die ewige Nacht hervorgerufen. Man goß choa-Wachs ins Feuer; der angenehme Duft erhob<br />
sich in die Luft und bewirkte das Wiedererscheinen des Tages. Die Aché lernten das endgültige<br />
Angesicht der Welt kennen, das die Bewegung der Sonne in der regelmäßigen Abwechslung<br />
von Tag und Nacht zeichnet. Seither sind die Dinge unverändert geblieben.« (Ibid.:<br />
111f.)<br />
Wenn das Chaos die Ordnung der Welt bedroht, müssen sie ihm entgegentreten.<br />
Dies ist bei den Guayaki auch der Fall,<br />
»wenn der <strong>für</strong>chterliche Bewohner des Himmels, der große blaue Jaguar, auf den Mond oder<br />
die Sonne losgeht, um sie zu verschlingen. Die Menschen wären gezwungen, von neuem in<br />
ewigem Licht oder in der ewigen Finsternis zu leben, das wäre das Ende der Welt. Man hat<br />
daher große Angst, man spart nicht an Bemühungen, dem Einhalt zu gebieten, man muß den<br />
Jaguar erschrecken. Die Frauen stoßen durchdringende Schreie aus, sie werfen Schilfrohr ins<br />
Feuer, wo es explodiert, die Männer ... bedrohen das Tier mit ihrem Gebrüll, mit ihrer Streitaxt<br />
hacken sie wütend auf die Erde ein. [...] Schließlich bekommt es die Bestie mit der Angst<br />
zu tun, läßt von ihrer Beute ab, die Sonne erscheint wieder, der Mond findet erneut seinen<br />
Schimmer, das Leben der Welt nimmt wieder seinen geregelten Lauf.« (Ibid.: 112)<br />
Derartige Vorstellungen sind uns fremd. Im Zeitalter der Aufklärung veränderte sich<br />
der Blick auf die Natur: »Die Geschichte des Menschen löst sich zunehmend von der<br />
des Planeten. [...] Die uralte Erde, gleichgültig gegenüber ihren Bewohnern, erhebt<br />
sich zu einer neuen, erhabenen Größe. Das eintönige, ununterbrochene Rauschen<br />
der immer wiederkehrenden Wellen bezeugt hinfort die Ewigkeit der Welt.« (Corbin<br />
1988: 139) Unser Verhältnis zur Natur ist seither ein Paradoxon; sentimentale<br />
Stilisierung bis hin zur Sakralisierung auf der einen, extreme Profanisierung und<br />
hemmungslose Ausbeutung der Ressourcen auf der anderen Seite. Ein gespaltenes<br />
Bild: Heilige Mutter und Hure. Auch eine Art von Entfremdung. Die "Naturvölker"
178 Die Evidenzen des Fortschritts<br />
dagegen scheinen die Trennung, die in diesem Bild zum Ausdruck kommt, nicht zu<br />
erfahren. Ihre Praxis ist, um mit Jürgen Habermas zu sprechen, beherrscht von einer<br />
Konfusion von Natur und Kultur, die es historisch vermeintlich zu überwinden galt.<br />
MAGIE, RELIGION UND WISSENSCHAFT<br />
In Frazers evolutionistischer Lesart besteht eine historische Abfolge von Magie, Religion<br />
und Wissenschaft. 305 Nach Frazer zielen sowohl Magie als auch Religion ebenso<br />
wie die Wissenschaft auf die Beherrschung der Natur, sie stellen (vermeintlich) Mittel<br />
bereit, den Verlauf der Dinge zu beeinflussen. Angesichts der »elementaren<br />
Gleichförmigkeit der menschlichen Bedürfnisse überall und zu allen Zeiten« und<br />
»der großen Unterschiede der Mittel, derer er sich in den verschiedenen Zeitaltern<br />
bediente« kommt Frazer zu dem Schluß, daß die Bewegung des menschliches Geistes<br />
von der Magie über die Religion hin zur Wissenschaft ging (1922: 712) Die Magie<br />
steht der Wissenschaft allerdings näher als die Religion: Nach Frazer geht der Magier<br />
ebenso wie der Wissenschaftler von der Annahme aus, daß bestimmte Ursachen oder<br />
Handlungen stets die gleichen Wirkungen zeitigen, erfüllt ihn ein "echter und fester<br />
Glaube" an die Ordnung und die Gleichförmigkeit der Natur, ein blindes Vertrauen<br />
in »ein unechtes System von Naturgesetzen« (Ibid.: 11). »Wo auch immer die Magie<br />
in ihrer reinen, unverfälschten Form auftritt, setzt dieselbe voraus, daß in der Natur<br />
ein Ereignis notwendig auf das andere folgt ohne die Einmischung irgendwelcher<br />
geistigen oder persönlichen Kräfte. So ist ihre Grundauffassung identisch mit derjenigen<br />
der modernen Wissenschaft.« (Ibid.: 49) 306 Das Verhältnis des Magiers zur<br />
Natur ist demnach nicht den unwägbaren Launen eines Gottes unterworfen. Während<br />
Religion und der Glaube an das Heilige zur Abstraktion führen, neigen Magie<br />
und Wissenschaft in der Frazerschen Lesart zum Konkreten.<br />
»Der psychologische Teil seiner These bestand darin, Magie und Wissenschaft als Gegensätze<br />
zur Religion darzustellen, wobei Magie und Wissenschaft eine unveränderlichen Naturgesetzen<br />
unterworfene Welt voraussetzen..., und Religion eine Welt, in der die Ereignisse von den<br />
Launen der Geister abhängig sind. Während also der Magier und der Wissenschaftler, <strong>für</strong>wahr<br />
ein seltsames Gespann, ihre Arbeit mit ruhiger Zuversicht tun, wirkt der Priester in Furcht<br />
und Zittern. Psychologisch gesehen, sind Wissenschaft und Magie gleich, obwohl die eine<br />
falsch, die andere richtig ist.« (Evans-Pritchard 1965: 62f.)<br />
Auch wenn die Magie bei Frazer häufig als Ausgeburt des Irrationalen erscheint (im<br />
Herzen der Finsternis zelebriert der Schamane einen namenlosen Ritus, während<br />
seine Gefährten in die Häute ihrer getöteten Feinde gekleidet unter schauerlichen<br />
305 Vgl. auch die ausgezeichnete Frazer-Biographie von R. Ackerman (1987).<br />
306 »Neben der Auffassung, daß die Welt von höheren Kräften durchdrungen ist, hat der primitive<br />
Mensch eine andere, vermutlich noch ältere, in der wir den Keim des modernen Begriffes vom<br />
Naturgesetz zu entdecken vermögen, nämlich jene Anschauung, daß sich die Natur aus einer Reihe von<br />
Ereignissen zusammensetze, die sich in unveränderlicher Folge, ohne Eingreifen einer persönlichen<br />
Macht wiederholen.« (Frazer 1922: 10)
Die Evidenzen des Fortschritts 179<br />
Gesängen das Feuer umtanzen) sind der Magier und seine Magie dennoch nicht einfach<br />
"irrational", sondern vielmehr "protorational". Denn die magischen Handlungen<br />
und Vorstellungen sind rationalisierungsfähig und bilden den Ausgangspunkt des<br />
langen Wegs der Evolution der Naturerkenntnis. »Von den ältesten Zeiten an ist der<br />
Mensch damit beschäftigt gewesen, nach allgemeinen Gesetzen zu suchen, welche<br />
die Ordnung der natürlichen Erscheinungen zu seinem eigenen Nutzen kehren würden,<br />
und in dieser langen Suche hat er einen ganzen Berg solcher Grundsätze aufgetürmt.«<br />
(Ibid.: 50) Für den viktorianischen Anthropologen war Magie also "irrtümliche<br />
Wissenschaft" und das Ritual "ineffiziente Technik": nutz– und wirkungslos<br />
— aber die "primitiven" Menschen, umfangen vom mythischen Schleier, erkennen<br />
dies nicht, weil sie an die Allmacht (weniger ihrer Gedanken als) ihrer Handlungen<br />
und Worte glauben. Der Mensch gibt die Magie erst dann auf, wenn er seinen<br />
Irrtum bemerkt, »wenn er ... einsieht, daß sowohl die Ordnung der Natur, auf die<br />
er sich bezog, als auch die Kontrolle, die er auszuüben glaubte reine Imaginationen<br />
waren.« An diesem Punkt verläßt er sich nicht länger auf seine Intelligenz sondern<br />
wendet sich der Religion zu; er unterwirft sich demütig »gewissen großen unsichtbaren<br />
Wesen hinter dem Schleier der Natur, denen er nun all jene weitreichenden<br />
Kräfte zuschreibt, über die er einst selbst zu verfügen glaubte.« (Ibid.) 307 Schließlich<br />
wird auch die Religion abgelöst — von der Wissenschaft. »Nachdem der Mensch so<br />
lange im Dunkel herumirrte, hat er hier endlich den Ausweg aus dem Labyrinth gefunden,<br />
einen goldenen Schlüssel der viele Zugänge zu den Geheimnissen der Natur<br />
öffnet.« (Ibid.: 712) 308<br />
Aus der Perspektive der "aufgeklärten" westlichen Kultur sind Magie, Zauber, Hexerei,<br />
Schamanismus vor allem eins: wirkungslos — was jedem einigermaßen vernünftigen<br />
und zivilisierten Menschen umstandslos klar sein sollte. Ist Magie somit<br />
Ausdruck einer "Urdummheit", waren die Wilden wie Kinder, die erst noch<br />
schmerzlich an der Realität lernen, ihren Vorstellungen von Allmacht und magischem<br />
Wortsinn entwachsen mußten, um vom Glauben zum Wissen zu gelangen?<br />
Und sind die Akteure, die magische Handlungen vollziehen, in toto ebenso "irrational"<br />
wie ihre Praktiken? Letzteres ganz offensichtlich nicht. Sie sind zu "rationalem"<br />
(und das heißt zunächst wenig mehr als: wirksamem) Handeln durchaus in der Lage.<br />
Hierauf weist Bronislaw Malinowski ausdrücklich hin. Für den Frazer-Schüler Mali-<br />
307 Unter Religion versteht Frazer »eine Versöhnung oder Beschwichtigung von Mächten, die dem<br />
Menschen übergeordnet sind und von denen er glaubt, daß sie den Lauf der Natur und das menschliche<br />
Leben lenken.« (Ibid.: 50)<br />
308 »Das Allermerkwürdigste ist, wie von zahlreichen Lesern und Kritikern des Goldenen Zweigs ...<br />
festgestellt wurde, daß die überreichlichen Informationen über Opferkulte aus räumlich und zeitlich<br />
völlig unzusammenhängenden Kulturen Frazer anscheinend nie zu seiner ersehnten Schlußfolgerung<br />
führten. Tatsächlich zieht die Qualität seines Textes, auf die er zu recht so stolz war — die Lebendigkeit<br />
der ethnographischen Schilderungen —, den Leser genau in eine Richtung, die den Intentionen des<br />
Autors entgegengesetzt ist: zu den Tiefen des mythischen Waldes und nicht zu der glatt gemähten<br />
Wiese, auf die Frazers Intellekt aus war.« (Schama 1995: 231)
180 Die Evidenzen des Fortschritts<br />
nowski ist der magische Akt zwar ebenfalls eine zielgerichtete, die Manipulation von<br />
Gegenständen, Personen, Ereignissen bezwekende Handlung, der bestimmte irrige<br />
Vorstellungen zugrunde liegen; aber die "Primitiven" kennzeichnet gerade, daß sie<br />
ebenso zu folgerichtigem Denken und Handeln in der Lage sind, wie sie auf der anderen<br />
Seite magischen Vorstellungen anhängen. So bemerkt Malinowski:<br />
»Wenn man einem Eingeborenen nahelegen würde, er solle seine Pflanzung vor allem durch<br />
Zauber bestellen und seine Arbeit vernachlässigen, würde er über solche Einfalt einfach lachen.<br />
Er weiß ebensogut wie wir, daß es natürliche Bedingungen und Ursachen gibt, und er weiß<br />
auch durch seine Beobachtungen, daß er diese natürlichen Kräfte durch geistige und körperliche<br />
Leistungen unter Kontrolle bringen kann. Sein Wissen ist ohne Zweifel begrenzt, aber so<br />
weit es reicht, ist es vernünftig und gegen Mystizismus gefeit.« (1925: 14) 309<br />
Damit impliziert Malinowski, daß, wiewohl sie sich wechselseitig durchdringen,<br />
"mythisches" und "rationales" Verhalten in primitiven Gesellschaften klar voneinander<br />
zu trennen sind, und daß es stets einen Bereich rationalen Denkens und Handelns<br />
geben muß, damit die Gesellschaft überleben kann. 310 Es ist tatsächlich nur schwer<br />
vorstellbar, daß Menschen versuchen, allein mit Hilfe magischer Beschwörungen satt<br />
zu werden. Sollten sie es doch jemals getan haben, gäbe es heute keinen Beleg mehr<br />
<strong>für</strong> diese Praxis: sie wären schlicht ausgestorben. — Evans-Pritchard hebt in seiner<br />
berühmten Zande-Monographie auf einen anderen Punkt ab, die logische Konsistenz<br />
der magischen Vorstellungen. Diese sind demnach<br />
»obgleich rituell, folgerichtig, und die Gründe, die sie <strong>für</strong> ihr Verhalten angeben, sind logisch,<br />
auch wenn sie mystisch sind. [...] Würden ihre mystischen Vorstellungen es ihnen gestatten,<br />
aus ihren Beobachtungen allgemeine Schlüsse zu ziehen, würden sie wie wir gewahr werden,<br />
daß ihr Glauben der Grundlage entbehrt. [...] Ihre Blindheit ist nicht Folge ihrer Dummheit:<br />
im System ihrer Glaubensanschauungen denken sie sehr vernünftig.« (1937: 225)<br />
Das Vorhandensein bestimmter magischer Vorstellungen impliziert also keineswegs,<br />
daß die Angehörigen der betreffenden Kultur nicht zu folgerichtigem Denken fähig<br />
sind. Die mythischen Vorstellungen der Zande »sind in hohem Maße kohärent, sie<br />
sind durch ein Netzwerk logischer Vorstellungen miteinander verbunden und so angeordnet,<br />
daß sie niemals allzu kraß der sinnlichen Erfahrung widersprechen, sondern<br />
im Gegenteil durch die Erfahrung gerechtfertigt zu werden scheinen.« (Ibid.:<br />
216) Die "Wilden" sind auch keinesfalls leichtgläubig. Claude Lévi-Strauss präsentiert<br />
eine diesbezüglich sehr aufschlußreiche Anekdote: »Wir kampierten seit ein<br />
paar Wochen bei einer kleinen Gruppe von Nambikwara-Indianern im Quellgebiet<br />
des Tapajoz [...] Es waren ungefähr dreißig, die sich im Laufe des zufallsreichen Nomadenlebens<br />
zusammengefunden hatten [...] Wie die meisten dieser Horden hatten<br />
309 »Keine auch noch so primitive Kunst oder Fertigkeit [konnte] erdacht oder ausgeführt, keine<br />
planmäßige Form von Jagd, Fischerei, Ackerbau oder Nahrungssuche ausgeübt werden ... ohne die<br />
Fähigkeit, vernunftgemäß zu denken, und ohne Vertrauen in die Macht der Vernunft, das heißt, ohne die<br />
ersten Ansätze von Wissenschaft.« (Ibid.: 3)<br />
310 Ob diese Unterscheidung zwischen "mythischen" und "profanen" Einstellungen von den<br />
Eingeborenen selbst vorgenommen wird oder erst durch die Arbeit des Ethnologen aufgedeckt wird,<br />
steht an dieser Stelle noch nicht zur Diskussion.
Die Evidenzen des Fortschritts 181<br />
sie einen Häuptling und einen Medizinmann« (1949a: 185) Eines Abends erschien<br />
der Medizinmann nicht zur gewohnten Stunde im Lager.<br />
»Die Nacht fiel herein und die Feuer wurden angezündet: Die Indianer verhehlten ihre Unruhe<br />
nicht; zahlreich sind die Gefahren im Busch: reißende Flüsse, die zweifellos unwahrscheinliche<br />
Gefahr, einem großen wilden Tier, einem Jaguar oder einem Ameisenbär zu begegnen, oder<br />
die der Vorstellung der Nambikwara weit näherliegende, daß ein anscheinend friedliches Tier<br />
die Verkörperung eines feindlichen Geistes der Gewässer oder Wälder sei; vor allem aber sahen<br />
wir allabendlich seit einer Woche geheimnisvolle Lagerfeuer, die bald näher, bald ferner<br />
von den unseren leuchteten. Jede unbekannte Horde ist möglicherweise feindlich eingestellt.«<br />
(Ibid.: 187f.)<br />
Auf einer Erkundung fanden sie schließlich den Gesuchten, unbeweglich lag er am<br />
Boden in der nächtlichen Kälte. Er wurde zurück ins Lager geführt und berichtete:<br />
»Ein Gewitter ... war am Nachmittag niedergegangen, der Donner hatte ihn mehrere<br />
Kilometer bis an einen Ort, den er bezeichnete, entführt und vollständig entblößt<br />
wieder an die Stelle zurückgebracht, wo wir ihn gefunden hatten.« (Ibid.: 186) Man<br />
schenkte seiner Geschichte nur wenig Glauben. Jene Horde, die Lévi-Strauss begleitete,<br />
war nämlich erst vor relativer kurzer Zeit aus dem Zusammenschluß zweier<br />
unterschiedlicher Gruppen entstanden; die erste hatte eine Seuche dezimiert, die<br />
zweite hatte sich von einer anderen Gruppe abgespalten. Es gab guten Grund, anzunehmen,<br />
»daß die unbekannten Gruppen, die in der Savanne umherzogen, zu dem Stamm der abtrünnigen<br />
Gruppe gehörten, zu der auch der Medizinmann rechnete. Dieser hatte ohne Zweifel, indem<br />
er sich die Rechte seines Kollegen, des politischen Führers anmaßte, Kontakt mit seinen<br />
Landsleuten aufnehmen wollen, um über eine Rückkehr zum alten Stamm zu verhandeln, um<br />
sie anzureizen, die neuen Verbündeten anzugreifen, oder auch, um sie hinsichtlich der Pläne<br />
der Verbündeten jenen gegenüber zu beruhigen; wie dem auch sei, er brauchte einen Vorwand,<br />
um sich wegzubegeben, und die Entführung durch den Donner war zu diesem Zweck<br />
erfunden worden.« (Ibid.: 187)<br />
Der Medizinmann war also nicht auf den Flügeln des Donners davongetragen worden,<br />
alles war nur Theater. Diese Skepsis gegenüber seiner Erzählung implizierte<br />
aber keineswegs, daß die Indianer nicht länger an derartige Dinge glaubten, im Gegenteil,<br />
sie hätten geschehen können, »sie waren unter anderen Umständen effektiv<br />
geschehen, sie gehörten zum Erfahrungsbereich. Daß ein Zauberer intime Beziehungen<br />
zu übernatürlichen Gewalten unterhielt, war sicher.« (Ibid.: 188) Magie und<br />
Betrug schließen einander nicht aus. Obwohl die Eingeborenen also zu rationalem<br />
Denken und Handeln fähig sind, »findet sich Magie in allem, was sie tun« (Malinowski<br />
1925: 13). Die Frage, »warum eine handelnde Person, die hinreichend rational<br />
ist, um zu wissen, daß die Saat ausgesät werden muß, sich noch mit Magie abgibt«<br />
(Jarvie und Agassi 1967: 120), 311 drängt sich aus dieser Perspektive nachgerade auf.<br />
Fragt sich weiterhin, wie, warum und auf welcher Grundlage Menschen zu ihren<br />
311 Die Bestimmung der Magie ist <strong>für</strong> Malinowski ebenso wie <strong>für</strong> Frazer rein utilitaristischer Natur. Die<br />
Religion verfolgt hingegen keine instrumentellen Ziele, die religiösen Riten sind »selbst die Erfüllung<br />
ihres Zwecks« (Ibid.: 72).
182 Die Evidenzen des Fortschritts<br />
magischen Vorstellungen gelangen konnten, wie diejenigen, die diese Praktiken vollziehen,<br />
sich die Wirksamkeit ihrer Magie erklären, und warum sie schließlich trotz<br />
widerstreitender Evidenzen an diesen Vorstellungen festhalten?<br />
Nach Tylor erklärt sich der "Wilde" (explizit oder implizit) die Wirksamkeit<br />
seiner Rituale auf Grundlage animistischer Vorstellungen, die umgekehrt die Magie<br />
überhaupt erst ermöglichen. Für den Animismus, nach Tylor die früheste Religion<br />
der Menschheit, ist die Welt beseelt, wohnt allen materiellen Dingen ein immaterielles<br />
Wesen inne, welches die Menschen beeinflussen können. Tylors in Primitive<br />
Culture (1871) dargelegte Theorie des Animismus besteht aus zwei Hauptthesen,<br />
von denen die erste den Ursprung, die zweite die Entwicklung religiöser Vorstellungen<br />
betrifft.<br />
»Die Reflexion des Primitiven über solche Erfahrungen wie Tod, Krankheit, Trancezustände,<br />
Visionen und vor allem Träume führt ihn zu dem Schluß, daß sie auf das Vorhandensein oder<br />
Nichtvorhandensein einer immateriellen Wesenheit, der Seele, zurückzuführen sind. [...] Der<br />
Primitive übertrug diese Vorstellung von Seele dann auf andere Lebewesen, die ihm in einigen<br />
Dingen glichen, und sogar auf unbeseelte Objekte, die sein Interesse weckten. Da die Seele<br />
von ihrem materiellen Gehäuse abtrennbar war, konnte sie als unabhängig von ihm gedacht<br />
werden. Daraus ergab sich die Vorstellung von geistigen Wesen, deren angebliche Existenz<br />
Tylors Minimaldefinition von Religion ausmacht...« (Evans-Pritchard 1965: 59 ff.) 312<br />
Für Frazer hat die Magie hingegen keine spirituelle, sondern eine rein logische Basis.<br />
Zwei elementare Ideen strukturieren demnach die magischen Vorstellungen: »einmal,<br />
daß Gleiches wieder Gleiches hervorbringt, oder daß eine Wirkung ihrer Ursache<br />
gleicht; und dann, daß Dinge, die einmal in Beziehung zueinander gestanden haben,<br />
fortfahren, aus der Ferne aufeinander zu wirken, nachdem die physische Berührung<br />
aufgehoben wurde. Der erste Grundsatz kann das Gesetz der Ähnlichkeit, der<br />
zweite das der Berührung oder direkten Übertragung genannt werden.« (1922: 11)<br />
Ähnlichkeit (Similarität) und Berührung (Kontaguität) begründen und strukturieren<br />
dergestalt magisches Denken und Handeln. »Beide Arten der Magie ... können leichter<br />
unter dem gemeinsamen Namen "sympathetische Magie" verstanden werden, da<br />
beide annehmen daß die Dinge aus der Ferne durch eine geheime Sympathie aufeinander<br />
wirken« (Ibid.: 12); die wechselseitige Teilhabe (Partizipation) begründet die<br />
Möglichkeit der Beeinflussung.<br />
312 »Tylor wollte zeigen, daß die primitive Religion rational sei, daß sie sich aus Beobachtungen und<br />
logischen Deduktionen ... entwickelt habe, so unzureichend die einen und so falsch die anderen gewesen<br />
sein mögen; daß sie eine einfache Naturphilosophie darstelle. In seiner Behandlung der Magie, die er von<br />
der Religion mehr aus Gründen der Darstellung als im Hinblick auf Begründung und Geltung unterschied,<br />
betonte er ebenfalls das rationale Element dessen, was er "diese Anhäufung von Unsinn" nannte.<br />
Auch die Magie beruht auf Beobachtung, auf der Klassifikation von Ähnlichkeiten, dem ersten wesentlichen<br />
Prozeß menschlicher Erkenntnis.« (Ibid.: 60f.) Freud merkt hierzu in Totem und Tabu an: »Der Animismus<br />
ist ein Denksystem, er gibt nicht nur die Erklärung eines einzelnen Phänomens, sondern<br />
gestattet es, das Ganze der Welt als einen einzigen Zusammenhang, aus einem Punkte zu begreifen. Die<br />
Menschheit hat, wenn wir den Autoren folgen wollen, drei solcher Denksysteme, drei große Weltanschauungen<br />
im Laufe der Zeiten hervorgebracht: die animistische (mythologische), die religiöse und<br />
die wissenschaftliche. Unter diesen ist die erstgeschaffene, die des Animismus, vielleicht die folgerichtigste<br />
und erschöpfendste, eine, die das Wesen der Welt restlos erklärt.« (1912/13: 366)
Die Evidenzen des Fortschritts 183<br />
Derartige magischen Vorstellungen sind <strong>für</strong> Frazer »unmittelbar von den elementarsten<br />
Denkprozessen abgeleitet« und »ein Fehler, in den der Geist fast spontan verfällt«<br />
in seinem Bestreben, sich die Naturkräfte dienstbar zu machen (Ibid.: 79). Die<br />
"Gesetze der Sympathie" sind somit notwendige und hinreichende Bedingung von<br />
Magie: »Beide Gedankengänge sind in der Tat äußerst einfach und elementar. Es<br />
könnte kaum anders sein, da sie ja in ihrer konkreten, wenn auch freilich nicht in ihrer<br />
abstrakten Form dem rohen Verständnis nicht nur des Wilden sondern aller unwissenden<br />
und geistig trägen Menschen vertraut sind.« (Ibid.: 12) 313<br />
Zwar ist auch <strong>für</strong> Malinowski Magie das "natürliche" Ergebnis "natürlicher"<br />
Bedingungen, im Unterschied zu Frazer, der eine "intellektualistische" Erklärung liefert,<br />
ist sein Ansatz aber rein "affektionistisch": angesichts der unzureichenden Beherrschung<br />
der Natur durch den primitiven Menschen entwickelt Magie sich quasi<br />
spontan: »Im Stich gelassen von seinen Kenntnissen, irregeführt durch seine frühere<br />
Erfahrung und seine technische Fähigkeit, realisiert er seine Ohnmacht. Aber sein<br />
Verlangen packt ihn um so heftiger; seine Furcht, seine Ängste und Hoffnungen erzeugen<br />
eine Spannung in seinem Organismus, die ihn zu irgendeiner Aktivität<br />
treibt.« (1925: 63) Aus diesen Gefühlsausbrüchen, der schmerzlich erfahrenen Diskrepanz<br />
zwischen Streben einerseits und Unvermögen andererseits entspringt die<br />
Magie als Ersatzhandlung, welche die emotionale Spannung mindert und das Gefühl<br />
der Bedrohung abschwächt. Magische Vorstellungen entstehen demnach notwendig,<br />
spontan und zufällig, welcher inneren Logik sie folgen, ist <strong>für</strong> Malinowski von untergeordneter<br />
Bedeutung. Das magische Ritual versucht somit, die Kluft zwischen Wollen<br />
und Können aufzuheben. Begreift man den magischen Akt dergestalt als instrumentellen,<br />
ist er fraglos rationalisierungsfähig und antizipiert in gewissem Sinne den<br />
technischen Akt, dem die "wissenschaftliche" Einsicht in die realen (nicht phantasierten)<br />
Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zugrundeliegt: »Die Magie [erfüllt] die<br />
Aufgabe der Wissenschaft und [ist] Platzhalter der entstehenden Wissenschaften«<br />
(Ibid.: 97). Magie wäre also offenbar disfunktional, könnte die Spannung zwischen<br />
Streben und Unvermögen abgebaut werden. 314<br />
313 Damit unterscheidet Frazer nicht systematisch zwischen der Frage, wie die Magie Praktizierenden<br />
sich deren Wirksamkeit erklären und der Frage, auf welcher Grundlage sich magische Vorstellungen<br />
generieren, welcher Logik sie folgen. Beide Ebenen fallen bei ihm in eins.<br />
314 Auf diese Weise, so Evans-Pritchard, werden Magie und Religion letztlich auf psychologische<br />
Zustände reduziert: »Spannungen, Frustrationen, Emotionen und Empfindungen, Komplexe und<br />
Wahnvorstellungen dieser oder jener Art.« (1965: 80f.) Seine Kritik an derartigen emotionalistischen<br />
Ansätzen kumuliert in der Feststellung: »Wenn Riten von einem emotionalen Ausdruck begleitet<br />
werden, kann es durchaus der Ritus sein, der die Emotionen produziert, nicht umgekehrt. [...] Ganz<br />
bestimmt gehen wir nicht in die Kirche, weil wir uns in einem gehobenen Gefühlszustand befinden;<br />
doch kann unsere Beteiligung an den Riten einen solchen Zustand hervorrufen. Was gibt es nun im<br />
Hinblick auf die kathartische Funktion der Magie <strong>für</strong> einen Beweis da<strong>für</strong>, daß ein Mann frustriert ist,<br />
wenn er Acker-, Jagd– oder Fischzauber veranstaltet, oder daß die Ausübung des Ritus sein Unbehagen<br />
beseitigt, wenn er sich in einem Spannungszustand befindet? Meiner Ansicht nach wenig oder gar<br />
keinen. Ohne Rücksicht auf seine Gefühle muß der Magier seine Riten auf jeden Fall durchführen, da sie<br />
ein üblicher und obligatorischer Teil des Verfahrens sind. Man könnte mit gutem Recht sagen, daß der<br />
Primitive diese Riten veranstaltet, weil er an ihre Wirkung glaubt. Da er weiß, daß er über Mittel zur
184 Die Evidenzen des Fortschritts<br />
Warum schließlich erkennen die "Wilden" die Wirkungslosigkeit dieser irrigen Vorstellungen<br />
und der aus ihnen resultierenden Praktiken nicht? Evans-Pritchard, der<br />
sich ausführlich mit diesem Problem befaßt, führt bezüglich des Hexereiglaubens der<br />
Zande nicht weniger als zweiundzwanzig Gründe an (1937: 277ff.), die alle mehr<br />
oder weniger auf den Punkt hinauslaufen, daß im Universum der Zande kein Punkt<br />
existiert, von welchem aus ein Zweifel an ihren magischen Auffassungen formuliert<br />
werden könnte. Malinowskis Antwort auf die Frage, warum die trügerischen Aspekte<br />
der Magie, die <strong>für</strong> den primitiven Menschen eigentlich unmittelbar einsichtig sein<br />
müßten, so lange unentdeckt blieben, ist hingegen vergleichsweise schlicht, er verweist<br />
auf »die bekannte Tatsache, daß im menschlichen Gedächtnis der Beweis eines<br />
positiven Falls immer den negativen überschattet. Ein Gewinn wiegt leicht mehrere<br />
Verluste auf. So sind Beispiele, welche die Magie bestätigen, immer viel deutlicher<br />
sichtbar als solche, die sie verneinen.« (1925: 66)<br />
Vielleicht sind die verneinenden Beispiele sogar außerordentlich selten: Malinowski<br />
selbst weist darauf hin, daß bei den Trobriand-Insulanern Magie und Arbeit<br />
sich wechselseitig durchdringen, so daß es auf den ersten Blick schwerfällt, beide zu<br />
trennen. In diesem Fall ist das Risiko, daß die Magie fehlschlägt, gering — solange<br />
die Arbeiten sorgfältig ausgeführt werden. Der Erfolg des magischen Ritus ist also in<br />
vielen Fällen gar nicht überprüfbar: »Für die Primitiven ist zweifellos die Magie unerläßlich<br />
<strong>für</strong> das Gedeihen der Pflanzungen. Keiner kann genau sagen, was ohne sie<br />
geschehen würde, denn keine Pflanzung eines Eingeborenen ist je ohne ihr Ritual bestellt<br />
worden.« (Ibid.: 14).<br />
Muß man ihnen also lediglich zeigen, daß ihre Rituale nutzlos sind, um sie von ihren<br />
magischen Vorstellungen zu "heilen"? So wie angeblich die christlichen Missionare<br />
nur die heiligen Eichen zu fällen brauchten, um die Heiden von der Machtlosigkeit<br />
ihrer Götter zu überzeugen und sie zum Christentum zu bekehren?<br />
Überwindung auftretender Schwierigkeiten verfügt, gibt es nicht viele Ursachen <strong>für</strong> Frustrationen. Wir<br />
können also sagen, daß Magie weniger Spannungen mildert als die Steigerung von Spannungen<br />
verhindert.« (Ibid.: 82f.)
8. Kapitel<br />
DAS LICHT DER VERNUNFT<br />
»Ich <strong>für</strong>chte fast, daß unsere Augen größer sind als unsere Mägen<br />
und unsere Neugierde größer ist als unsere Fassungskraft. Wir greifen<br />
nach allem, aber fassen nur den Wind.« (Michel de Montaigne)<br />
Das okzidentale Weltverständnis erhebt Anspruch auf universelle und ausschließliche<br />
Gültigkeit seiner Denk– und Handlungsweisen; es gibt den Maßstab vor, an dem sich<br />
die anderen Kulturen messen lassen müssen. Dieser Anspruch ist <strong>für</strong> Jürgen Habermas<br />
berechtigt, weil unser Weltbild die objektiv richtigen Grundbegriffe zur Deutung<br />
der Welt zur Verfügung stellt (vgl. 1987, I: 75). 315 Aus der Perspektive der<br />
westlichen Zivilisation sind magische Akte durch ein eklatantes Defizit gekennzeichnet<br />
und mythische Weltbilder »weit davon entfernt, in unserem Sinne rationale<br />
Handlungsorientierungen zu ermöglichen. Sie bilden, was die Bedingungen der ...<br />
rationalen Lebensführung angeht, einen Gegensatz zum modernen Weltverständnis.«<br />
(Ibid.: 73)<br />
Nach Habermas, der in seiner "Theorie des kommunikativen Handelns" weitgehend<br />
den diesbezüglichen common-sense wiedergibt, kann von der "Rationalität<br />
einer Lebensführung" erst dann gesprochen werden, wenn man <strong>für</strong> eine Gruppe von<br />
Individuen systematisch erwarten darf,<br />
»daß <strong>für</strong> ihre Äußerungen gute Gründe bestehen und daß ihre Äußerungen, sei es in der kognitiven<br />
Dimension zutreffend oder erfolgreich, in der moralisch-praktischen Dimension zuverlässig<br />
oder einsichtig, in der evaluativen Dimension klug oder einleuchtend, in der expressiven<br />
Dimension aufrichtig und selbstkritisch, in der hermeneutischen Dimension verständnisvoll,<br />
oder gar in allen Dimensionen "vernünftig" sind.« (Ibid.: 72)<br />
Die Äußerungen resp. Anschauungen der "Wilden" wären also unzutreffend, unzuverlässig<br />
oder uneinsichtig, unklug oder nicht einleuchtend, unaufrichtig und unkritisch;<br />
und die "Primitiven" gefangen im "Konkretismus eines anschauungsverhafteten<br />
Denkens" (Ibid.: 77), der gekennzeichnet ist durch eine »Konfusion zwischen<br />
Natur und Kultur« (Ibid.: 79) sowie die »mangelhafte Differenzierung zwischen<br />
Sprache und Welt«, d.h. »die systematische Verwechslung zwischen internen<br />
Sinn– und externen Sachzusammenhängen« (Ibid.: 81). — Das sind, wie erwähnt,<br />
die gängigen Vorurteile. Im folgenden ist zu klären, ob und inwieweit sie zutreffen.<br />
VERNUNFT UND UNVERNUNFT<br />
Bezogen auf instrumentelle Akte ist das Rationalitätskriterium ein reines Effizienzkriterium:<br />
Rational ist die rationelle Verfahrensweise (und die entsprechende Einsicht).<br />
Begreift man Magie dergestalt als Zwecktätigkeit, leuchtet Habermas Zuschreibung<br />
unmittelbar ein. Magische Auffassungen sind in instrumenteller Hinsicht ebenso-<br />
315 Habermas "Projekt" ist »die Verteidigung des normativen Universalitätsanspruchs der okzidentalen<br />
Moderne« (Stender 1995: 379).
186 Das Licht der Vernunft<br />
wenig zutreffend wie die aus ihnen resultierenden Handlungen erfolgreich sind. Zudem<br />
sind sie offenbar weder kritisierbar und empirisch überprüfbar, man muß an die<br />
Magie glauben und darf sie nicht infrage stellen. "Kritisches" Denken, eine empirische<br />
Überprüfung wäre der Tod der Magie, diese Ansicht fand sich in allen bislang<br />
zitierten Texten.<br />
Dennoch erscheint der "magische Komplex" bei vielen Autoren nicht als<br />
schlicht irrational, sondern vielmehr als "proto-rational", sowohl aus historischgenetischer<br />
als auch aus systematischer Perspektive: Magie verweist auf Wissenschaft<br />
(und weist Ähnlichkeiten zur Wissenschaft auf), die angeblich aus ihr hervorgeht, sie<br />
operiert logisch und folgerichtig; die Menschen, welche ihr anhängen, verfügen zudem<br />
gleichzeitig über ein zuverlässiges praktisches Wissen... Wir haben es also mit<br />
"rationalen" oder zumindest potentiell rationalen Akteuren zu tun, die "irrationalen"<br />
oder proto-rationalen Praktiken anhängen. Dieser Dualismus prägt Ian C. Jarvies<br />
und Joseph Agassis Aufsatz mit dem Titel "Das Problem der Rationalität von<br />
Magie". Für die Autoren ist eine Handlung dann rational, wenn der Handelnde zumindest<br />
glaubt, daß sie »den gewünschten Zwecken förderlich ist [...] Einem Handeln<br />
wollen wir dann Rationalität zuschreiben, wenn ein Ziel vorhanden ist, auf das<br />
es sich richtet.« (1967: 121) Menschen würden also grundsätzlich immer dann rational<br />
handeln, wenn sie den Zweck bzw. das Ziel ihres Tuns angeben können. Da eine<br />
solche Minimaldefinition als analytische Kategorie schwerlich taugt, differenzieren<br />
Jarvie und Agassi zwischen Rationalität im schwachen Sinn und solcher im starken<br />
Sinn. Erstere umfaßt lediglich rationales Handeln im obigen Verständnis, während<br />
letztere meint, »daß ein Mensch auf Grundlage rationaler Anschauungen rational<br />
handelt.« (Ibid.)<br />
Eine Glaubensanschauung [belief] ist demnach dann rational, »wenn er einem<br />
der vorhandenen Rationalitätsmaßstäbe oder –Kriterien genügt, daß er z.B. auf sicheren<br />
Beweisen beruht, über berechtigte Zweifel erhaben ist oder Kritik offensteht<br />
usw.« (Ibid.) Der magische Akt wäre also insofern rational, als die Menschen mit<br />
seiner Hilfe ein Ziel zu erreichen suchen — Bedingung der Möglichkeit von Rationalität<br />
ist Intentionalität —, er ist dagegen irrational, soweit er in instrumenteller<br />
Hinsicht wirkungslos ist bzw. die ihm zugrunde liegenden Vorstellungen von Ursache<br />
und Wirkung "falsch" sind und somit im Vergleich zum auf wissenschaftlicher<br />
Erkenntnis beruhenden technischen Akt defizitär. Jarvie und Agassi fragen am Ende<br />
ihres Essays folgerichtig: »Können Menschen mit ineffizienten magischen Anschauungen<br />
diesen gegenüber kritisch werden, unter welchen Bedingungen und in welchem<br />
Ausmaß?« (Ibid.: 149) 316 Sie können es unter diesem Blickwinkel in dem Maße,<br />
in dem ihre Einsicht in die realen Wirkungszusammenhänge wächst, sie ihre<br />
316 In einem späteren Aufsatz differenzieren Jarvie und Agassi ihr Konzept von "Rationalität im starken<br />
Sinn": »Wir wollen jetzt diese zweite Kategorie sorgfältig zerlegen und starke Rationalität trennen in<br />
(2a) relativ starke Rationalität, bei der der Standard der Rationalität der der eigenen Gemeinschaft ist, und<br />
(2b) sehr starke Rationalität, welche die höchsten Standards von Rationalität überhaupt kennzeichnet,<br />
nämlich (wie wir sagen) die des kritischen Denkens.« (nach Kippenberg/Luchesi 1978: 42)
Das Licht der Vernunft 187<br />
Welt "entzaubern". "Schwache" Rationalität schlüge dann in "starke" um, wenn die<br />
Menschen um die "wahren" Kausalitäten wüßten — die Magie wäre obsolet. Ich zitiere<br />
erneut Jarvie und Agassi: »Statt zu sagen, daß primitive Menschen Samen säen<br />
und dann irrationale magische Rituale vollführen, läuft unser Vorschlag darauf hinaus,<br />
daß sie Produkte auf höchst ineffiziente Weise anbauen, da sie keine Traktoren<br />
haben und nicht wissen, daß es keinen Unterschied macht, ob ein Ritual abgehalten<br />
wird oder nicht.« (Ibid.: 148f.)<br />
"TRADITIONALES" UND WISSENSCHAFTLICHES DENKEN<br />
Vielleicht ist der magische Akt als technischer tatsächlich wirkungslos, aber eines ist<br />
er sicher nicht: bedeutungslos. Es dürfte im Zweifelsfall einen gewaltigen Unterschied<br />
machen, ob das Ritual ausgeführt wird oder nicht — ein Unterschied, dem<br />
gegenüber das utilitaristische Paradigma, in welchem sich Jarvie und Agassi (als<br />
selbsternannte "Neo-Frazerianer") bewegen, blind ist. Deren Ansatz ist viel zu beschränkt,<br />
um die Magie als gesellschaftliches und kulturelles Phänomen erklären zu<br />
können (falls die Autoren dies überhaupt wollen).<br />
Inwiefern ist es überhaupt sinnvoll, Magie und Wissenschaft zu vergleichen?<br />
Liegt hier nicht von vornherein ein dem okzidentalen Ethnozentrismus geschuldeter<br />
Kategorienfehler vor? Der gemeinsame Nenner aller magischen Akte besteht im Minimum<br />
nur darin, daß sie bestimmte Wirkungen erzielen wollen und die ihnen zugrundeliegenden<br />
Vorstellungen nicht wissenschaftlicher und auch nicht religiöser<br />
Natur sind, sondern eben magisch. Die Bestimmung des Gegenstands "Magie" erfolgt<br />
ex negativo: Magie ist nicht Wissenschaft, sie ist auch nicht Religion. Damit<br />
sind aber die drei Bereiche zueinander in Beziehung gesetzt, es muß ein Gemeinsames<br />
geben, das sie verbindet und die Abgrenzung ebenso wie den Vergleich ermöglicht.<br />
Dieses Gemeinsame sind die Zwecke, die mit den jeweiligen Handlungen verfolgt<br />
werden, und diese sind instrumenteller Natur. Bereits die Gegenstandsbestimmung<br />
gründet somit in einem Kategorienfehler bzw. einer fehlerhaften projektiven<br />
Klassifikation. Vor allem die Frage, warum "rationale" Menschen trotz deren<br />
evidenter Wirkungslosigkeit dauerhaft an magischen Praktiken festhalten, ist in diesem<br />
Rahmen nicht zu beantworten. "Magie" muß noch eine andere Bestimmung haben<br />
als eine rein instrumentelle. Frazers These von der Strukturhomologie zwischen<br />
Magie und Wissenschaft ist also mehr als problematisch. 317 Dennoch könnte seine<br />
Auffassung so etwas wie ein "Unterpfand der Wahrheit" enthalten, allerdings nicht<br />
auf der instrumentellen Ebene.<br />
Wie Evans-Pritchard so hervorragend beschreibt, präformieren die magischen<br />
Vorstellungen der Zande ihre Wahrnehmung der "Wirklichkeit" ebenso, wie die<br />
wissenschaftliche Weltauffassung die unsere präformiert. »Unsere wissenschaftliche<br />
317 Überhaupt mutet sein Bild einer auf ewig unwandelbaren, dem menschlichen Schicksal gegenüber<br />
vollkommen gleichgültigen Natur etwas zu modern an, um <strong>für</strong> den "Wilden" wahr zu sein.
188 Das Licht der Vernunft<br />
Betrachtungsweise, so betont er, ist ebenso eine Funktion unserer Kultur, wie die<br />
magische Betrachtungsweise des "Wilden" eine Funktion der seinen ist.« (Winch<br />
1964: 75) Könnte es sein, daß Magie und Wissenschaft in unterschiedlichen Kulturen<br />
die gleiche Rolle wahrnehmen? Robin Horton knüpft in seinem ausnehmend einflußreichen<br />
Aufsatz "African Traditional Thought and Western Science" hier an. Für<br />
Frazer waren Magie, Religion und Wissenschaft gleichermaßen Mittel zur Beeinflussung<br />
der Natur.<br />
Malinowski hingegen ging von einem anderen Klassifikationsschema aus: Im<br />
Unterschied zu Frazer, der Magie, Religion und Wissenschaft als historisch aufeinander<br />
folgende Verfahren zur Beeinflussung des Naturverlaufs (wobei nur Wissenschaft<br />
tatsächlich "funktioniert") 318 betrachtete, sind <strong>für</strong> Malinowski alle drei Formen (zumindest<br />
im Ansatz) in allen Gesellschaften vorhanden. Zwar sind auch <strong>für</strong> ihn magische<br />
Akte instrumentelle "Ersatzhandlungen", die Religion (d.h. Glaubensvorstellungen<br />
und Rituale ohne erkennbaren instrumentellen Zweck) stellt aber einen geschlossenen<br />
(selbstbezüglichen) separaten Korpus dar. Malinowski unterscheidet zudem<br />
zwischen Arbeit (auf Grundlage empirischer Kenntnisse; einer Art Vorstufe der<br />
Wissenschaft) und Magie: »So gibt es eine klare Unterscheidung: auf der einen Seite<br />
der Komplex der wohlbekannten Umstände, der natürliche Verlauf des Wachstums<br />
und die gewöhnlichen Mißgeschicke und Gefahren, gegen die man sich durch Einzäunen<br />
und Jäten zur Wehr setzen muß. Auf der anderen Seite die Domäne der unberechenbaren<br />
und feindlichen Einflüsse, ebenso wie der große, unverdiente Mehrertrag<br />
durch einen glücklichen Zufall. Den ersten Umständen begegnet man mit<br />
Kenntnissen und Arbeit, den zweiten mit Magie.« (1925: 14f.) Arbeit und (magisches)<br />
Ritual wechseln sich bei den Trobriand-Insulanern (auf diese bezieht Malinowski<br />
sich bei seinen Ausführungen) ab und sind klar unterschieden. Während Magie<br />
dergestalt praktische Zwecke verfolgt, ist Religion die »Gesamtheit in sich abgeschlossener<br />
Handlungen, die selbst die Erfüllung ihres Zwecks sind.« (Ibid.: 71f.)<br />
Horton wiederum unterscheidet nicht zwischen Magie und Religion (beide<br />
werden bei ihm unter dem Etikett "traditionales Denken" zusammengefaßt), er<br />
wechselt zudem die Vergleichsebene und richtet sein Augenmerk weniger auf die instrumentellen<br />
denn auf die explanativen Zwecke des Denkens. Seine Quintessenz<br />
lautet in etwa: traditionales und wissenschaftliches Denken haben gemeinsam, daß<br />
sie die Welt intelligibel, also im wahrsten Sinn "denkbar" machen, aber sie tun dies<br />
auf sehr unterschiedliche Art und Weise, und diese Unterschiede spiegeln tiefgreifende<br />
kulturelle Differenzen wider. In beiden Fällen ist nach Horton »die Suche<br />
nach einer erklärenden Theorie in erster Linie die Suche nach einer der scheinbaren<br />
Mannigfaltigkeit zugrundeliegenden Einheit; nach einer der scheinbaren Komplexität<br />
zugrundeliegenden Einfachheit; nach einer der scheinbaren Unordnung zugrundeliegenden<br />
Ordnung; nach einer den scheinbaren Anomalien zugrundeliegenden Regelhaftigkeit.«<br />
(Horton 1967: 132)<br />
318 Unter diesem rein instrumentellen Blickwinkel sind die beiden ersteren notwendig defizitär und ver-<br />
fehlen ihr Ziel.
Das Licht der Vernunft 189<br />
Typischerweise bezieht dieses Bemühen die Ausarbeitung eines Systems von "Wesen"<br />
oder Kräften ein, die hinter oder innerhalb der Welt der common sense-Wahrnehmungen<br />
wirken. Dieses theoretische System ist mit der Alltagswelt durch Korrespondenzregeln<br />
verbunden. »Die Götter einer gegebenen Kultur bilden ein System,<br />
welches die endlose Mannigfaltigkeit der Alltagserfahrung als Ausdruck der Handlungen<br />
einer relativ begrenzten Anzahl von Kräften interpretiert.« (Ibid.: 133) Das<br />
theoretische Denken als solches arbeitet in allen Kulturen auf gleiche Art und Weise.<br />
Erstens: »Jede Theorie zerlegt die einheitlichen Objekte des common sense in Aspekte<br />
und plaziert die resultierenden Elemente dann in einen umfassenderen kausalen<br />
Kontext. Das heißt, sie abstrahiert und analysiert zunächst und re-integriert anschließend.«<br />
(Ibid.: 144) Und zweitens: »Bei der Entwicklung eines theoretischen<br />
Systems scheint der menschliche Verstand gezwungen zu sein, Inspiration aus der<br />
Analogie zwischen den verwirrenden Beobachtungen, die erklärt werden sollen, und<br />
bestimmten bereits bekannten Phänomenen zu ziehen.« (Ibid.: 146)<br />
D.h., etwas dem Vertrauten verwandtes wird als die dem Unverstandenen<br />
zugrundeliegende Realität postuliert. Die Analogien werden allerdings aus unterschiedlichen<br />
Bereichen gezogen: In komplexen, sich schnell wandelnden Industriegesellschaften<br />
ist nach Horton der zwischenmenschliche Bereich beständigem Wandel<br />
unterworfen. Ordnung, Regelhaftigkeit, Vorhersagbarkeit, Einfachheit scheinen dort<br />
beklagenswert abwesend. Sie finden sich in der Welt der unbelebten Dinge. Deshalb<br />
fühlen sich viele Menschen hier eher aufgehoben als bei ihren Mitmenschen, und<br />
deshalb auch suchen wir unsere Analogien in der unbelebten Natur. In traditionalen<br />
afrikanischen Gesellschaften ist die Situation anders: der zwischenmenschliche Bereich<br />
ist geordnet, berechenbar, voraussehbar. Deshalb ziehen die Menschen dort<br />
ihre Analogien aus diesem Bereich; formulieren ihre Theorien in einem personalen<br />
Idiom.<br />
Die fundamentale Differenz zwischen traditionalem und wissenschaftlichen Denken<br />
ist <strong>für</strong> Horton aber vor allem durch die (auf Karl Popper zurückgehenden) Kategorien<br />
"Offen" und "Geschlossen" bestimmt. Erstens gibt es in traditionalen Gesellschaften<br />
kein entwickeltes Bewußtsein von Alternativen zu dem etablierten Korpus<br />
theoretischer Lehrsätze, während in wissenschaftlich orientierten Kulturen dieses<br />
Bewußtsein hochentwickelt ist. Das "traditionale" Glaubenssystem »durchdringt<br />
den Glaubenden mit einer unwiderstehlichen Kraft. Auf diese Kraft beziehen wir<br />
uns, wenn wir bestimmte Glaubenssätze als geheiligt bezeichnen.« (Ibid.: 154). Auf<br />
dieser Grundlage kann sich <strong>für</strong> Horton kein (selbst)reflexives theoretisches Denken<br />
entfalten: Traditionales Denken erledigt seine explanatorischen Aufgaben, ohne innezuhalten<br />
und über die Natur und Regeln seines Vorgehens zu reflektieren. Da der<br />
traditionale Denker keine Vorstellung von Alternativen hat, ist eine solche Ebene<br />
der Reflexion weder möglich noch notwendig. Er hat keine Wahl zu treffen und bedarf<br />
folglich keiner Kriterien <strong>für</strong> diese (vgl. Ibid.: 159f.). Zweitens ist jeder Angriff<br />
auf die etablierten Lehren eines traditionalen Glaubenssystems eine Bedrohung durch
190 Das Licht der Vernunft<br />
das Chaos, den "kosmischen Abgrund", und ruft deshalb intensive Angst hervor 319 .<br />
Deshalb nimmt der "Primitive" im Unterschied zum "Wissenschaftler" eine beschützende<br />
Haltung seinem theoretischen Korpus gegenüber ein: Eine Infragestellung von<br />
Glaubenssystemen bzw. Glaubensanschauungen ist in traditionalen Gesellschaften<br />
nicht "denkbar". Der Weg ist versperrt, weil die Denkenden Opfer der Geschlossenheit<br />
ihres Glaubenssystems sind. Etablierte Glaubensanschauungen haben<br />
<strong>für</strong> sie absolute Gültigkeit, und jede Infragestellung dieser Anschauungen ist eine erschreckende<br />
Bedrohung: 320 »Wer springt von der kosmischen Palme, wenn er keine<br />
Hoffnung hat, sich auf einen anderen Thron zu schwingen?« (Ibid.: 163) Der Wissenschaftler<br />
hingegen hat laut Horton eine prinzipiell kritische Einstellung zu etablierten<br />
Denksystemen, und vor allem hierin unterscheidet er sich vom traditionalen<br />
Denker. Wie auch immer er sich zu seiner Theorie verhält, letztlich weiß er demnach,<br />
daß sie nichts zeitloses oder absolutes ist. 321 Diese grundlegende Bereitschaft,<br />
319 Eine solche unscharfe Sichtweise könnte zu der Aussage verführen, daß die Glaubenssysteme nur<br />
erschaffen werden, um mit dem Chaos die Angst zu bannen. Damit aber würde Angst zum alleinigen<br />
Schlüssel des Verstehens menschlicher Kultur, eine absurde Vorstellung. Man sollte vielmehr mit<br />
Durkheim dahingehend argumentieren, daß ein Angriff auf die kollektiven Klassifikationsmuster das<br />
soziale Band, die Solidarität innerhalb der Gesellschaft und diese Gesellschaft selbst, infrage stellt, eine<br />
sehr reale Bedrohung, auf die tatsächlich mit Angst reagiert werden dürfte.<br />
320 Barry Barnes zeigt auf, daß dies in primitiven Kulturen notwendig so sein muß »wo das Problem der<br />
begrifflichen Ordnung mit dem Problem der gesellschaftlichen Ordnung identisch ist, und wo eine<br />
Solidarität, anders als in differenzierten Gesellschaften, nicht durch eine starke Rollendifferenzierung<br />
und den Einsatz spezialisierter gesellschaftlicher Kontrollinstanzen aufrechterhalten werden kann. [...]<br />
Die primitive Kultur muß ihre entscheidenden sozialen Klassifikationen streng verbindlich machen und<br />
Unterschiede betonen.« (1973: 225) Ganz ähnlich argumentiert Mary Douglas.<br />
321 Horton rekurriert schließlich auf die unterschiedliche Einstellung zur Kategorie "Zeit": In der<br />
typischen traditionalen Kultur wird davon ausgegangen, daß die Dinge im goldenen Zeitalter der<br />
kulturstiftenden Heroen besser waren als heutzutage. Diese Anschauung bezieht sich auch auf den Lauf<br />
des Jahres: das Jahresende wird als der Zeitpunkt angesehen, an dem alles ausgelaugt und träge ist, überwältigt<br />
von einer Ansammlung von Unordnung und Befleckung. Eine logische Folge dieser Einstellung<br />
ist die Entwicklung von Aktivitäten, die das Verstreichen der Zeit negieren durch eine symbolische<br />
"Rückkehr zum Beginn". Diese Aktivitäten gründen in der magischen Vorstellung, daß der symbolische<br />
Ausdruck eines archetypischen Ereignisses dieses Ereignis in einem gewissen Sinn neu erschaffen kann<br />
und die seit seinem ursprünglichen Auftreten verstrichene Zeit damit scheinbar ausgelöscht ist. Das<br />
Neue und das Fremde sind, soweit sie nicht in das etablierte System der Klassifikationen und Theorien<br />
passen, als Andeutungen des Chaos so weit als möglich zu meiden. Die fortschreitende Zeit, mit ihrem<br />
unvermeidlichen Bestandteil des nichtrepetetiven Wandels, ist das Vehikel des Neuen und Fremdartigen<br />
par excellence. Deshalb müssen ihre Auswirkungen um jeden Preis annulliert werden. Der<br />
Wissenschaftler hingegen hat eine positive Einstellung zur Kategorie "Zeit". Erstens hat "Veränderung"<br />
<strong>für</strong> ihn nichts per se bedrohliches an sich, was in der Existenz von Alternativen und dem Bewußtsein<br />
darum begründet ist. Zweitens führt den Wissenschaftler seine eigene Erfahrung mit der Art und Weise,<br />
wie Theorien angesichts widersprechenden Datenmaterials über den Haufen geworfen und durch Ideen<br />
mit noch größerer explanatorischer und prognostischer Kraft ersetzt werden, fast unvermeidlich zu<br />
einer positiven Einschätzung des Zeitverlaufs. (Ibid.: 169) Drittens stellt die "Offenheit" zwar Alternativen<br />
bereit, aber nichts, das vergleichbar wäre mit der Geborgenheit, die der traditionale Denker<br />
innerhalb seines Glaubenssystems findet. »Im Bereich der Wissenschaft existiert ein andauerndes Gefühl<br />
von Unsicherheit, welches die Idee des Fortschritts mit einer mächtigen Anziehungskraft ausstattet.<br />
Dadurch, daß diese Idee Menschen in die Lage versetzt, sich an irgendeinen erhofften Zustand perfekten<br />
Wissens zu klammern, hilft sie ihnen, mit der Einsicht in die Unvollkommenheit und Vorläufigkeit der<br />
gegenwärtigen Theorien zu leben.« (Ibid.: 169f.)
Das Licht der Vernunft 191<br />
Theorien aufgrund mangelhaften prognostischen Werts auszurangieren oder auf einen<br />
reduzierten Geltungsbereich einzuschränken, ist <strong>für</strong> Horton das vielleicht wichtigste<br />
Einzelmerkmal wissenschaftlicher Einstellung. Aber sie kann nur entwickelt<br />
werden, wenn das Bewußtsein um Alternativen dem Angriff auf Theorien das Bedrohliche<br />
nimmt.<br />
Soweit die kurze Darstellung von Hortons Argumentation, die selbstverständlich<br />
nur eine idealtypische Gegenüberstellung darstellt. 322 Die von ihm vertretene<br />
Position repräsentiert so etwas wie den sozialanthropologischen mainstream: Einerseits<br />
zielen sowohl Magie als auch Wissenschaft auf die Beeinflussung (Beherrschung)<br />
der äußeren Natur und haben insofern eine je unterschiedliche "kognitive Effizienz"<br />
(vgl. Horton 1981: 202), andererseits dienen magische Vorstellungen durch die Bereitstellung<br />
einer klassifikatorischen Ordnung auch der Sicherstellung des gesellschaftlichen<br />
Zusammenhalts. Das magische Ritual wäre demnach "rational" und<br />
wirksam soweit es darum geht, die Welt intelligibel zu machen, also denkbar — was<br />
umstandslos das Festhalten an magischen Praktiken angesichts widerstreitender Evidenzen<br />
zumindest zum Teil erklärte —, in kognitiver und instrumenteller Hinsicht<br />
hingegen wäre es defizient und wirkungslos. 323<br />
WIRKUNG VERSUS BEDEUTUNG?<br />
Auch bei Horton erscheint traditionales Denken als Vorstufe des wissenschaftlichen.<br />
Für J.H.M. Beattie hingegen ist das primitive Denken "reif" und verweist nicht auf<br />
die Wissenschaft. Im Unterschied zu Horton befaßt sich Beattie allerdings weniger<br />
mit mythischen Denkweisen als mit magischen Ritualen. 324 Er merkt zu Jarvies und<br />
Agassis Aufsatz an: Menschen würden wohl kaum Magie praktizieren, wenn sie nicht<br />
von deren Wirksamkeit überzeugt wären — das »sollte man zumindest meinen. Die<br />
Tatsache, daß sie es glauben und aufgrund dieses Glaubens handeln, kann wohl kaum<br />
eine Erklärung darstellen: sie ist vielmehr — als Aussage über das Handeln der Menschen<br />
— selbst dasjenige, was der Erklärung bedarf.« (1970: 178). Beattie, der zwi-<br />
322 Sein Text "funktioniert" nur auf der Ebene der allgemeinsten Postulate, im Detail ergeben sich eine<br />
Vielzahl von Problemen, die vornehmlich daraus resultieren, daß Horton versäumt, erstens<br />
gesellschaftliche Rückbezüge herzustellen und zweitens auf die bereits vorliegenden Arbeiten zur<br />
"primitiven" Klassifikation" zurückzugreifen. Zudem sei dahingestellt, ob seine normativen Setzungen<br />
durchweg <strong>für</strong> die Realität des Wissenschaftsbetriebs zutreffen.<br />
323 In einem späteren Aufsatz präzisiert Horton seine Fragestellungen folgendermaßen: »Inwiefern kann<br />
wissenschaftliches Theoretisieren den Anspruch auf größere kognitive Effizienz als seine vorwissenschaftlichen<br />
Widerparts erheben?«, und »Was sind, insofern der Anspruch auf kognitive Überlegenheit<br />
begründet ist, die Quellen dieser Überlegenheit?« (1981: 202)<br />
324 Wenn man sich anschaut, was offensichtlich alles unter "Magie" subsumiert werden kann, steht man<br />
schließlich vor einer derart verwirrenden Vielfalt von Praktiken und Zielen, daß sich fragt, ob der Begriff<br />
als analytische Kategorie überhaupt noch taugt. Das mag der Grund da<strong>für</strong> sein, daß der Begriff sozusagen<br />
aus dem Diskurs "herausdiffundiert": erst geht es um Magie, dann um Rituale, schließlich nur noch um<br />
"traditionales Denken": Hortons Ansatz schließt zwanglos auch die Religion mit ein und entzieht sich<br />
damit der Schwierigkeit, Magie, Religion, Ritual eindeutig zu definieren. Wahrscheinlich zu recht.
192 Das Licht der Vernunft<br />
schen instrumentellen und expressiven Handlungen bzw. Handlungsanteilen differenziert,<br />
325 schreibt: »Instrumentales Verhalten muß unter Bezugnahme auf die angestrebten<br />
und erreichten Ergebnisse verstanden werden; expressives Handeln unter<br />
Bezugnahme auf den Sinn, auf die Ideen die es ausdrückt.« (zit. nach Jarvie und Agassi<br />
1967: 133) 326<br />
In der Praxis sei es häufig schwer, die beiden Aspekte zu trennen, worauf<br />
Beattie ausdrücklich hinweist, aber dennoch zwingend notwendig. Der expressive<br />
Anteil des Rituals drückt nach Beattie symbolisch Dinge und Ideen aus wie Gruppensolidarität,<br />
Autorität usw. »Die Symbolik ist hauptsächlich expressiv; sie macht es<br />
möglich, etwas wichtiges zu sagen, etwas, das direkt zu sagen unmöglich oder unausführbar<br />
ist.« (nach Ibid.: 132) So »hebt die Kanumagie der Trobriander die Bedeutung<br />
des Kanubaus <strong>für</strong> die Trobriander hervor, das Ritual des Blutsbundes unterstreicht<br />
die Notwendigkeit gegenseitiger Hilfe zwischen den Parteien; das Vermeidungsritual<br />
macht die Notwendigkeit der Aufrechterhaltung guter Beziehungen<br />
zwischen den affinal verbundenen Gruppen geltend.« (nach Ibid.: 133)<br />
Beattie fragt somit nicht nach den Intentionen der Handelnden sondern nach den inneren<br />
Bezügen des Symbolismus der Magie, nach der Struktur ihres Universums,<br />
wenn man so will. Ihm geht es primär um den "Sinn" der magischen Handlung, in<br />
diesem liegt <strong>für</strong> ihn ihre Rationalität begründet: »Beattie gibt ohne weiteres zu, daß<br />
Magie und Ritual nicht in dem Sinn "rational" sein mögen, daß sie dem Kanon westlicher<br />
Wissenschaft entsprechen; doch er insistiert darauf, daß sie nichtsdestoweniger<br />
einen "rationalen Kern" haben — eine Bedeutung in der Kultur, in der sie vorkommen.«<br />
(Hanson 1981: 254) Der Sinn, so Beattie, »ist nicht mit dem expliziten<br />
Ziel, das eine magische Handlung verfolgt, identisch.« (1970: 186) Deshalb bedarf es<br />
des Ethnologen, um diesen Sinnbezug aufzudecken — denn er ist dem Eingeborenen<br />
gewissermaßen nicht bewußt. Die mythisch/magischen Vorstellungen wären als<br />
symbolische also interpretationsbedürftig. Wie im zweiten Kapitel bereits erwähnt,<br />
325 »Ein jeder Mensch handelt das eine Mal rational in Jarvie und Agassis "starken" Sinn und eine<br />
anderes Mal rational in ihrem "schwachen" Sinn. Das mangelnde technische Wissen jedoch (was nicht<br />
dasselbe wie "Irrationalität" ist) bringt, und darauf haben schon viele hingewiesen, präliterale und<br />
technologisch weniger entwickelte Völker in eine größere Abhängigkeit vom Ritual als die Angehörigen<br />
moderner westlicher Gesellschaften, obwohl sie selbstverständlich immer auch eine Technologie<br />
haben.« (Beattie 1970: 186)<br />
326 Die Differenz zwischen dem utilitaristischen Ansatz Jarvies und Agassis und demjenigen Beatties<br />
entspricht in etwa der begrifflichen zwischen Magie und Ritual, wie sie in folgender Definition zum<br />
Ausdruck kommt: Insofern gewisse Handlungen obligatorisch sind, haben sie stets einen rituellen<br />
Charakter. »Als rituell wird in der Ethnologie ein körperliches und sprachliches Handeln dann bezeichnet,<br />
wenn es keinem rational-technischen Zweck dient, sich aber an der Beachtung bestimmter<br />
Regeln orientiert [...] Es besteht keine Einigkeit darüber, ob Rituale notwendigerweise symbolische<br />
Bedeutungen beinhalten und der Kommunikation mit spirituellen Mächten dienen.« (F. Kramer in<br />
Streck 1987). Damit wäre das Ritual von der technisch-instrumentellen Zwecken dienenden Magie zu<br />
scheiden. Bei derartigen Definitionsversuchen stellt sich allerdings die Frage, ob nicht jede Differenzierung<br />
immer eine "künstliche" bleiben muß, die wenig erklärenden Wert hat, und den wahren Charakter<br />
der Phänomene im dunklen läßt.
Das Licht der Vernunft 193<br />
"erledigen" sich unter Umständen viele vermeintlich abergläubische Anschauungen<br />
bei einer genaueren Analyse, da sich herausstellt, daß eine bildliche Rede fälschlicherweise<br />
wörtlich genommen wurde. So sagen z.B. die Guayaki: »Wer mit seiner<br />
Mutter schläft, wird in einen Tapir verwandelt; wer sich mit seiner Schwester vergnügt,<br />
in einen Brüllaffen; wer seine eigene Tochter verführt, wird zum Rehbock.«<br />
(Clastres 1972: 152) Glauben die Indianer das tatsächlich? Der Anthropologe liefert<br />
folgende Deutung dessen, was die Indianer mit dieser Redensart ausdrücken:<br />
»Der Mann der Inzest begeht, zerstört die Menschlichkeit in sich, deren wesentliche Regel er<br />
mißachtet hat. Er gibt sich auf und stellt sich außerhalb der Kultur, er fällt in den Naturzustand<br />
zurück, er wird zum Tier. Man spielt nicht ungestraft damit, Unordnung in die Welt hineinzutragen.<br />
Man muß die verschiedenen Ebenen, aus denen sie sich zusammensetzt, an ihrem<br />
Platz belassen, hier die Natur mit ihren Tieren, dort die Kultur mit ihrer menschlichen Gesellschaft.<br />
Von einem zum anderen gibt es keinen Übergang.« (Ibid.)<br />
Ob Clastres damit die Metaphorik der Redeweise richtig erfaßt hat, sei einmal dahingestellt,<br />
wichtig ist allein, daß viele "mythische" Erzählungen metaphorischer Natur<br />
sein dürften, und die Ethnographen oder deren Exegeten dies nicht erkennen.<br />
Ein notorisches Beispiel hier<strong>für</strong> ist eine Passage aus Evans-Pritchards Nuer Religion.<br />
Dort schreibt der Autor: »Es erscheint einem Europäer merkwürdig, beinahe absurd,<br />
wenn man ihm sagt, daß ein Zwilling ein Vogel ist — als ob dies eine offensichtliche<br />
Tatsache sei, denn die Nuer sagen nicht, daß ein Zwilling wie ein Vogel<br />
ist, sondern daß er ein Vogel ist.« (1956: 131; Hervorh. von mir) Die Aussage<br />
scheint einen völligen Widerspruch zu enthalten, ein Mensch ist ganz offensichtlich<br />
kein Vogel; ein Lebewesen kann nicht zugleich es selbst und ein anderes sein. Wie<br />
Evans-Pritchard bemerkt sind es gerade solche Beispiele, auf die Lucien Lévy-Bruhls<br />
Theorie der "prälogischen Mentalität" (die derartige Widersprüche angeblich zuließ)<br />
sich stützte. Aber tatsächlich beinhaltet die Aussage keinen Widerspruch. »Sie erscheint<br />
im Gegenteil demjenigen als sehr vernünftig, sogar wahr, der sich diese Anschauung<br />
innerhalb der Sprache und des religiösen Denksystems der Nuer vergegenwärtigt.«<br />
(Ibid.) 327 Wer sich also in das Denken der Nuer versetzt, nimmt ihre Aus-<br />
327 Wie Evans-Pritchard an anderer Stelle schreibt, sind »Aussagen über die religiösen Vorstellungen<br />
eines Volkes ... immer mit der größten Vorsicht zu betrachten, weil wir uns dabei mit Dingen<br />
beschäftigen, die weder ein Europäer noch ein Eingeborener direkt beobachten kann, mit Begriffen,<br />
Bildern und Worten, zu deren Verständnis eine gründliche Kenntnis der Sprache ebenso erforderlich ist<br />
wie die Berücksichtigung des gesamten Ideensystems, von dem jeder Glaube ein Teil ist; dieser Glaube<br />
kann alle Bedeutung verlieren, wenn er aus dem Gesamtzusammenhang von Vorstellungen und<br />
Verhaltensweisen gelöst wird, zu dem er gehört.« (1965: 38f.) Die viktorianischen Gelehrten hingegen<br />
zeichneten aus bruchstückhaften und willkürlich zusammengesuchten Informationen ein »verzerrtes<br />
Bild, ja eine Karikatur des primitiven Geistes, der danach abergläubisch, kindisch, unfähig zu kritischem<br />
oder zusammenhängendem Denken war.« (Ibid.: 40f.) So schreibt z.B. A.E. Crawley: »Die Amaxosa<br />
trinken Ochsengalle, um sich wild zu machen. Der berühmte Mantuana trank die Galle von dreißig<br />
Häuptlingen in dem Glauben, das würde ihn stark machen. Viele Völker, beispielsweise die Joruba,<br />
glauben, daß das "Blut das Leben ist". Die Neukaledonier essen ihre erschlagenen Feinde, um Mut und<br />
Kraft zu bekommen. In Timorlaut wird das Fleisch eines getöteten Feindes zur Behebung von Impotenz<br />
verspeist. Die Bewohner von Halmahera trinken das Blut erschlagener Feinde um tapfer zu werden. In<br />
Amboina trinken die Krieger das Blut ihrer getöteten Feinde, um deren Mut zu bekommen. Die<br />
Einwohner von Celebes trinken das Blut von Feinden, um stark zu werden. Die Eingeborenen von Dieri
194 Das Licht der Vernunft<br />
sage über Zwillinge nicht wörtlicher, als sie selbst es tun. Denn die Nuer behaupten<br />
nicht, daß ein Zwilling einen Schnabel, Federn usw. habe. Auch behandeln sie Zwillinge<br />
nicht wie Vögel, sondern wie Männer und Frauen. Die Geburt von Zwillingen<br />
ist lediglich Ausdruck einer spirituellen Manifestation; Zwillinge und Vögel haben,<br />
allerdings aus unterschiedlichen Gründen, eine besondere Verbindung zur Göttlichkeit,<br />
und das macht aus Zwillingen wie aus Vögeln "Leute von oben" und "Kinder<br />
Gottes", und deshalb ist ein Vogel ein passendes Symbol um die spezielle Beziehung<br />
auszudrücken, in welcher eine Zwilling zu Gott steht.« (Ibid.: 131f.) Ein besonderes<br />
geistiges Band verbindet also Zwillinge und Vögel, sie teilen deshalb keineswegs eine<br />
biologische Natur.<br />
Derartige Subtilitäten liegen etlichen Autoren offenbar fern — aber vielleicht interessieren<br />
sie sie nur nicht. 328 Hat man es hier mit zwei unterschiedlichen, aber letztlich<br />
kompatiblen Paradigmen zu tun? F. Allan Hanson versucht, die Positionen zu<br />
versöhnen. Gewisse Eigentümlichkeiten der in den späten 60er und frühen 70er Jahren<br />
vor allem in England geführten "Rationalitätsdebatte" sind seiner Ansicht nach<br />
darauf zurückzuführen, »daß die Philosophen, die sich an der Debatte beteiligt haben,<br />
ein Paradigma <strong>für</strong> die Erklärung menschlichen Handelns verwenden, das sich<br />
von dem in der Anthropologie gebräuchlichen sehr unterscheidet.« In die Debatte<br />
haben sich demnach deshalb »nur recht wenige Anthropologen eingeschaltet, weil in<br />
ihr Fragen und Annahmen thematisiert wurden, die dem anthropologischen Ansatz<br />
einigermaßen fremd sind.« (1981: 245) Nach Hanson ist<br />
»das elementare Modell menschlichen Handelns, von dem die an der Rationalitätsdebatte beteiligten<br />
Philosophen ausgehen, ... von entwaffnender Schlichtheit. [...] Die zentrale Annahme<br />
bei diesem Paradigma ist, daß menschliches Verhalten zielgerichtet ist. Menschen haben Zwecke<br />
vor Augen; ihr Verhalten ist dazu bestimmt, diese Zwecke zu erreichen. Daher gilt eine<br />
Handlung als verstanden, wenn man erstens das Ziel kennt, auf das sie gerichtet ist, und zweitens<br />
weiß, wie im Bewußtsein des Handelnden diese bestimmte Handlung zum Ziel führt.« (Ibid.:<br />
246)<br />
Hanson verwendet <strong>für</strong> diesen Ansatz die Bezeichnung "Motivationsanalyse". Das ist<br />
der Boden, auf dem die Position von Jarvie und Agassi angesiedelt ist. Beattie hingegen<br />
ist als Sozialanthropologe einem anderen Paradigma verpflichtet: der "<strong>Institut</strong>ionenanalyse".<br />
Sie versucht, die Sinn– und Bedeutungszusammenhänge in einer Kultur<br />
und ihre Nachbarstämme essen einen Menschen und trinken sein Blut, um seine Stärke zu erwerben; mit<br />
dem Fett werden Kranke eingerieben.« (nach Ibid.: 41) Das ist nichts als eine Aneinanderreihung aus<br />
ihrem kulturellen Kontext gerissener Details, die lediglich geeignet sind "den Wilden", fremdartig,<br />
exotisch aber auch dumm und lächerlich erscheinen zu lassen. Malinowski karikierte diese Art der<br />
Beschreibung einmal folgendermaßen: »Wenn ein Eingeborener in Alt-Kaledonien zufällig eine Whisky-<br />
Flasche am Wegrand findet, leert er sie mit einem Zug und macht sich danach sofort auf die Suche nach<br />
einer weiteren Flasche.« (nach Ibid.)<br />
328 Obwohl Evans-Pritchards Ausführungen diesbezüglich von völliger Klarheit sind, versucht Ernest<br />
Gellner (1970) hartnäckig, gerade diese spezielle Vorstellung als Beispiel <strong>für</strong> "prälogisches" Denken zu<br />
identifizieren. Ich kann das so wenig nachvollziehen, daß ich auf Gellners Aufsatz hier nicht näher<br />
eingehen will; Talad Assad (1986) liefert diesbezüglich eine dezidierte Kritik.
Das Licht der Vernunft 195<br />
aufzudecken. Hanson zitiert Beatties Auflistung der kulturellen Komplexe und Sachverhalte,<br />
in die sich der Anthropologe vertieft und die er zueinander in Beziehung zu<br />
setzen sucht:<br />
»Die Struktur der Symbole in Glauben und Ritus im Kontext bestimmter Kulturen; die Art<br />
der damit zusammenhängenden symbolischen Klassifikation; der unterschiedliche Sinn und die<br />
verschiedenen Sinnebenen der symbolischen Verfahrensweisen; die Voraussetzungen, auf die<br />
die betreffenden Anschauungen sich gründen; die Gründe da<strong>für</strong>, warum man Riten <strong>für</strong> kausal<br />
wirksam hält; die Art und Weise, in der die auftretenden symbolischen Vorstellungen zu anderen<br />
in der Kultur gängigen Vorstellungen in Beziehung stehen.« (Beattie 1970: 197)<br />
Derartige Problemstellungen treten nach Hanson im Rahmen der Motivationsanalyse<br />
schlicht nicht auf. Es bleibt aber eine elementare Differenz: Das Problem des "Verstehens"<br />
einer Kultur stellt sich im jeweiligen Paradigma grundlegend anders dar.<br />
Während laut Hanson die Motivationsanalyse versucht, allein auf Grundlage der von<br />
den Handelnden gelieferten bewußtseinsfähigen Begründungen und Erklärungen deren<br />
Vorstellungen von Mitteln und Zwecken zu "verstehen", liefert die <strong>Institut</strong>ionenanalyse<br />
das Konstrukt eines Sinn– und Bedeutungsgeflechts, das den Individuen<br />
selbst unbewußt sein mag (die Termini "bewußt" und "unbewußt" sind hier weniger<br />
im affektiven denn im kognitiven Sinn zu verstehen). 329<br />
Aber so einfach dürfte es kaum sein. Meines Erachtens schlägt Hansons Vermittlungsversuch<br />
fehl, weil die beiden skizzierten Paradigmen hinsichtlich (mindestens)<br />
eines zentralen Aspekts tatsächlich inkompatibel sind. Als "verfehlte" instrumentelle<br />
Handlung wäre der magische Ritus fraglos rationalisierungsfähig, aber gerade<br />
der instrumentelle Anteil könnte uns bezüglich seiner Bestimmung irreführen.<br />
Beattie fragt deshalb nicht, wie im Bewußtsein des Handelnden (und sei es in seinem<br />
kognitiven Unbewußten) der magische Akt sein Ziel erreicht; seine Argumentation<br />
läuft auf einen ganz anderen Punkt hinaus: der magische Ritus ist eine eminent gesellschaftliche<br />
Angelegenheit, er zielt nicht auf die äußere, sondern auf die soziale<br />
Wirklichkeit. 330 Er darf also nicht mit einem instrumentellen Akt gleichgesetzt werden.<br />
Aus diesem Grund auch ist dieser Ansatz mit demjenigen von Jarvie und Agassi<br />
weitgehend inkompatibel. Dies betrifft schon den Gegenstand: Zwar leugnet Beattie<br />
nicht den instrumentellen Anteil des magischen Aktes, aber schließlich befaßt er sich<br />
329 Eine weitere wichtige Differenz zwischen beiden Ansätzen ist nach Hanson, daß Beschreibungen im<br />
Rahmen des "<strong>Institut</strong>ionenparadigmas" kein Wertungsproblem aufwerfen. Hanson bezieht sich auf<br />
Clifford Geertz' Essay "Person, Zeit, gesellschaftlicher Umgang auf Bali", wenn er schreibt: »Das<br />
balinesische Volk und die balinesische Kultur bleiben unberührt davon, ob wir Geertz' Erklärung<br />
irrational, falsch, infantil oder was immer finden. Der einzige, der unter solchen ablehnenden Urteilen<br />
leiden ... könnte, ist Geertz selbst... Bei der Motivationsanalyse verhält es sich anders. Dort wird der<br />
explanatorische Zusammenhang von den Menschen selbst vertreten; er gehört ihrer Kultur an. Wenn<br />
wir daher die Wahrheit, die Rationalität oder den Abstraktionsgrad des Zusammenhangs ... beurteilen,<br />
fällen wir zwangsläufig ein Urteil über ihre Kultur.« (Hanson 1981: 262f.)<br />
330 Jede Aussage über die instrumentellen Zwecke eines magischen Aktes beinhaltet (explizit oder<br />
implizit) Annahmen bezüglich der Intentionen der Handelnden; im Zweifelsfall geht man stillschweigend<br />
davon aus, daß die Ziele der "Primitiven" die gleichen sind wie diejenigen, welche wir in einer ähnlichen<br />
Situation verfolgten (würden).
196 Das Licht der Vernunft<br />
nicht mit Magie, sondern mit Ritualen, eine bedeutsame Differenz. Beatties Position<br />
ist in gewisser Hinsicht das Echo einer berühmten Studie von Henri Hubert und<br />
Marcel Mauss. Die Autoren rekurrieren zwar auch, ebenso wie Malinowski, auf "Erregungszustände",<br />
um die Genesis der Magie zu erklären, aber diese Gefühlslagen<br />
sind bei ihnen nicht individueller sondern kollektiver Natur, was den Schwerpunkt<br />
zwangsläufig auf die rituelle Praxis verschiebt.<br />
»Der ganze soziale Körper wird von einer einzigen Bewegung belebt. Es gibt keine Individuen<br />
mehr. Sie sind sozusagen die Einzelteile einer Maschine oder, besser noch, die Speichen eines<br />
Rades, dessen magischer, tanzender und singender Rundlauf das ideale, vielleicht urtümliche<br />
Bild wäre... Seine rhythmische, gleichmäßige und kontinuierliche Bewegung ist der unmittelbare<br />
Ausdruck eines Geisteszustandes, in dem das Bewußtsein jedes Einzelnen von einem einzigen<br />
Gefühl, einer einzigen halluzinatorischen Idee, nämlich der des gemeinsamen Ziels<br />
übermannt wird. Alle Leiber haben dieselbe Schwingung, alle Gesichter tragen dieselbe Maske<br />
und alle Stimmen sind ein einziger Schrei ... Um in allen Gestalten das Bild seines Verlangens<br />
zu sehen, um aus allen Mündern den Beweis seiner Gewißheit zu vernehmen, fühlt sich ein jeder<br />
ohne irgend möglichen Widerstand von der Überzeugung aller mitgerissen. In der Bewegung<br />
ihres Tanzes und im Fieber ihrer Erregung durcheinandergewürfelt bilden sie nur noch<br />
einen einzigen Leib und eine einzige Seele. Erst dann ist also der soziale Körper wahrhaft realisiert...<br />
Unter solchen Bedingungen ... vermag die universelle Übereinstimmung Realitäten zu<br />
schaffen.« (1902/03: 165) 331<br />
Diese Beschreibung eines magischen Ritus dürfte zugleich diejenige seines Ursprungs<br />
sein: Die »eigentliche Wurzel der Magie« sind <strong>für</strong> Hubert und Mauss »affektive Zustände<br />
..., die Illusionen erzeugen.« (Ibid.: 162) Keine individuellen, sondern eben<br />
kollektive affektive Zustände wohlgemerkt. »Selbst die gewöhnlichsten Riten, die<br />
höchst mechanisch ablaufen, werden immer von einem Minimum an Emotionen,<br />
Ängstlichkeit und vor allem Hoffnungen begleitet. Die magische Kraft des Verlangens<br />
ist so sehr bewußt, daß ein großer Teil der Magie nur aus Wünschen besteht.«<br />
(Ibid.) 332 Die Magie ist »Gegenstand eines sozialen Einverständnisses, Übersetzung<br />
eines sozialen Bedürfnisses, unter dessen Druck eine ganze Reihe von Phänomenen<br />
der kollektiven Psychologie ausgelöst wird.« (Ibid.: 158) Für Hubert und Mauss ist<br />
die Magie eine soziale Tatsache, und der Glaube an ihre Wirksamkeit und die Not-<br />
331 Diese Bedingungen werden »in unseren Gesellschaften nicht mehr, nicht einmal von den erregtesten<br />
unserer Massen realisiert« (Ibid.) — womit sich umstandslos erklärte, warum uns die Magie "fremd"<br />
und nicht zugänglich ist.<br />
332 Im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts fand bezüglich der Erklärungen magischer Praktiken eine<br />
Art "Paradigmenwechsel" statt, man argumentierte nicht mehr "intellektualistisch" sondern eher<br />
"emotionalistisch" (wobei der Unterschied aber keinesfalls überbetont werden sollte, wie nicht nur die<br />
frühen Arbeiten von Marcel Mauss belegen). So schreibt Robert R. Marret in The Threshold of Religion<br />
(1909): »Primitive Religionen werden mehr getanzt als gedacht.« (zit. nach Evans-Pritchard 1965: 68)<br />
— man tanzt aufgrund bestimmter affektiver Zustände. Zur Charakterisierung des von ihm postulierten<br />
"präanimistischen", "magisch-religiösen" Zeitalters, in welchem die Differenz zwischen Magie und<br />
Religion nicht existierte, griff auch Marret auf das melanesische Konzept des mana zurück: »Nach Marett<br />
haben die Primitiven das Gefühl, daß eine geheimnisvolle Kraft in einigen Personen und Dingen wirkt<br />
und daß das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein dieses Gefühls das Heilige vom Profanen, die Welt<br />
der Wunder von der Welt des Alltags scheidet, wobei es Funktion des Tabus ist, die eine von der<br />
anderen zu trennen; es handelt sich um das Gefühl der Ehrfurcht... Was immer dieses Gefühl hervorruft<br />
und folglich als Geheimnis behandelt wird, ist Religion.« (Ibid.: 69)
Das Licht der Vernunft 197<br />
wendigkeit, magische Akte zu vollziehen — magische Akte werden nur »aufgeführt<br />
..., weil sie vorgeschrieben, und nicht weil sie logisch realisierbar sind.« (1902/03:<br />
84) — nicht von den Elementen her zu erklären, aus denen die magischen Vorstellungen<br />
sich zusammensetzen. »Tatsächlich hat es den Anschein, als wäre die Magie<br />
eine gigantische Variation über das Thema des Kausalprinzips. Doch diese Auffassung<br />
lehrt uns nicht das mindeste, denn es wäre ganz erstaunlich, daß Magie etwas anderes<br />
sein könnte, da es doch ihr ausschließliches Ziel ist, Wirkungen hervorzubringen.«<br />
(Ibid.: 97) Mit anderen Worten: Frazer beschreibt wenig mehr als die Bedingung<br />
der Möglichkeit der Magie, ihre Existenz als gesellschaftliches Phänomen kann<br />
er nicht erklären. »Die Magie ... definiert sich weder durch ihre Ziele noch durch<br />
ihre Verfahrensweisen, noch durch ihre Begriffe.« (Ibid.: 119) 333 Sie definiert sich<br />
durch die Vorstellung einer wirkenden Kraft, die »entsprechend den symbolischen<br />
Klassifikationen wirksam ist.« (Ibid.: 146) Nach Hubert und Mauss ist das »Vorstellungsminimum,<br />
welches jeder magische Akt enthält, ... die Vorstellung von seiner<br />
Wirkung.« (Ibid.: 94) 334<br />
Die magischen Tatsachen müssen, »falls sie überhaupt eine einheitliche Klasse<br />
von Tatsachen bilden, auf ein einziges Prinzip zurückgehen ..., das allein die Überzeugung,<br />
deren Gegenstand sie sind, zu rechtfertigen vermöchte. Wenn jeder dieser<br />
Vorstellungen eine bestimmte Klasse von Riten korrespondiert, so muß der Gesamtheit<br />
der Riten eine andere, gänzlich allgemeine Vorstellung korrespondieren.«<br />
(Ibid.: 130f.) Die Vorstellung einer Kraft eben, welche die Wirkungen hervorruft.<br />
Die fragliche Kraft ist das Mana der Polynesier, das Orenda der Huronen. Sie erklärt<br />
die Wirksamkeit der Magie, ist Substrat des Glaubens an diese Wirksamkeit, der<br />
wiederum nur qua gesellschaftlicher Konvention möglich ist. 335 Nach Hubert und<br />
Mauss beruft sich die Magie nur selten auf die Analyse oder die Erfahrung, sie ist »in<br />
sehr geringem Maße analytisch, nur wenig experimentell und so gut wie vollkommen<br />
a priori.« (Ibid.: 156) Sie entzieht sich der Kritik »weil man sie nicht überprüfen<br />
wollen kann.« (Ibid.) Die sinnliche Erfahrung hat »niemals den Beweis <strong>für</strong> ein<br />
magisches Urteil geliefert« — ebensowenig wie sich dem Geist diese Urteile aufgezwungen<br />
haben (Ibid.: 155). Während die Wissenschaft »immer als positiv und er-<br />
333<br />
Die Sympathie ist <strong>für</strong> die Autoren nur der Weg, den die magische Kraft nimmt, nicht diese Kraft<br />
selbst (vgl. Ibid.: 134)<br />
334<br />
Wäre der Entwurf von Hubert und Mauss nicht mehr als zwanzig Jahre vor Malinowskis Arbeit<br />
veröffentlicht worden, könnte man konstatieren, daß er eine Korrektur und Präzisierung seines<br />
Standpunktes beinhalte.<br />
335<br />
»Es versteht sich von selbst, daß ein derartiger Begriff keinen Seinsgrund außerhalb der Gesellschaft<br />
hat, daß er vom Standpunkt der reinen Vernunft absurd ist und daß er lediglich aus der Funktionsweise<br />
des kollektiven Lebens resultieren kann.« (Ibid.: 153) Gleichzeitig hat dieser Begriff »die Funktion einer<br />
Kategorie und ermöglicht die magischen Ideen« (Ibid.: 151), kommt ihm »die Rolle des Mittels und der<br />
Ursache zu.« (Ibid.: 146) Eine imaginierte, nicht mechanische sondern eben magische Kraft kollektiven<br />
Ursprungs also am Urgrund der Magie; eine Kraft, die den magischen Gegenständen bestimmte<br />
wirkende Eigenschaften verleiht. — In der Magie sind nach Hubert und Mauss dieselben kollektiven<br />
Kräfte gegenwärtig wie in der Religion (vgl. Ibid.: 123); die Untersuchung der magischen Riten enthüllt<br />
die Wurzeln des Heiligen (vgl. Ibid.: 151).
198 Das Licht der Vernunft<br />
fahrungsbezogen begriffen wird, ist der Glaube an die Magie immer apriorisch. Der<br />
Glaube an die Magie geht notwendig der Erfahrung voraus.« (Ibid.: 125) Die Magie<br />
ist demnach Gegenstand einer einzigen Behauptung. »Ebenso wie die Magie realer ist<br />
als ihre Teile, ist auch der Glaube an die Magie überhaupt tiefer verwurzelt als der,<br />
dessen Gegenstand ihre Elemente sind. Wie die Religion ist die Magie ein Block,<br />
entweder man glaubt an sie oder nicht.« (Ibid.: 124) Aufgrund ihres kollektiven Ursprungs<br />
(von sozialer Funktion der Magie sprechen die Autoren noch nicht) haben<br />
die magischen Anschauungen<br />
»eine solche Autorität, daß eine widersprechende Erfahrung den Glauben im Prinzip nicht erschüttern<br />
kann. In Wirklichkeit ist sie jeder Kontrolle entzogen. Selbst Tatsachen, die gegen<br />
sie sprechen, schlagen zu ihren Gunsten aus, da man sie immer <strong>für</strong> die Wirkung eines Gegenzaubers<br />
hält, auf Fehler bei der Durchführung eines Rituals oder allgemein darauf zurückgeführt,<br />
daß die notwendigen Bedingungen der Praktiken nicht realisiert wurden.« (Ibid.: 125)<br />
Der magische Akt ist aus dieser Perspektive nur ein Ritual unter vielen, durchaus<br />
auch nicht-magischen. Auch wenn Beattie dies nicht explizit formuliert, liegt seiner<br />
Argumentation ein funktionalistisches, auf Durkheim zurückgehendes, Erklärungsmodell<br />
zugrunde: Warum glauben Menschen an die Macht der Magie? Weil sie eine<br />
<strong>Institut</strong>ion ist, eine machtvolle kollektive Vorstellung — eine soziale Tatsache. Sie<br />
müssen daran glauben, da die magischen Anschauungen Teil des gesellschaftlichen<br />
Konsensus sind, welcher im Ritual dargestellt wird. So ist zum einen der magische<br />
Ritus allein aufgrund gesellschaftlicher Konvention wirksam, und zum anderen steht<br />
es dem oder der einzelnen nicht frei, sich seiner zu bedienen oder nicht. 336<br />
Magie als <strong>Institut</strong>ion übt, um mit Durkheim zu sprechen, einen Zwang auf die<br />
Individuen aus, den ein individualistisch-handlungstheoretischer Ansatz nicht zu erklären<br />
vermag. In echt funktionalistischer Manier — vor der Beattie nicht ganz zu<br />
unrecht zurückschreckt 337 — müßte man in Analogie zu der Differenz zwischen instrumentellen<br />
und expressiven Handlungsanteilen zwischen zwei grundlegend verschiedenen<br />
Formen von Handlungsrationalität unterscheiden: einer "expliziten" und<br />
einer "impliziten", 338 wobei die zweite scheinbar nur innerhalb eines funktionalisti-<br />
336 Hubert und Mauss fordern zwar, magische von sozialen Praktiken zu scheiden, sehen aber sehr wohl,<br />
wie schwer es ist, beide zu trennen. Die "sozialen Praktiken" sind Rituale; aber im Grunde genommen<br />
gibt es keine magischen Akte, die nicht ritualisiert sind, keinen symbolischen bzw. expressiven Charakter<br />
haben. Aus diesem Grund sollte eigentlich stets von "magisch-rituellen" Akten oder "magischen<br />
Riten" gesprochen werden, um Mißverständnisse zu vermeiden. Aber Magie und Ritual gehen nicht ineinander<br />
auf; wenn auch alle magischen Akte rituellen Charakter haben, ist nicht jedes Ritual ein magisches.<br />
337 Beattie zieht sich auf die sichere Position einer "Kulturwissenschaft" zurück, die nicht mehr den<br />
Anspruch erhebt, über Ursachen, Wirkungen und gesellschaftliche Prozesse zu räsonieren sondern<br />
selbstgenügsam Sinn– und Bedeutungszusammenhänge aufdeckt und archiviert. Die Frage "Warum<br />
Magie?" stellt sich <strong>für</strong> Beattie im Grunde gar nicht, auch wenn er sie explizit formuliert. Sein Ansatz ist<br />
lediglich geeignet, die innere Logik der magischen Handlungen und Vorstellungen zu entschlüsseln.<br />
338 Diese Unterscheidung entspricht in etwa der Parsonschen von intrinsischer und symbolischer<br />
Rationalität (vgl. Parsons 1937: 431). Für Parsons ist im Anschluß an Durkheim die intrinsische<br />
Rationalität auf den Bereich des Profanen, der Natur im weitesten Sinn bezogen, während die<br />
symbolische Rationalität auf das Sakrale, "Übernatürliche" zielt: Durkheim »erweiterte das Zweck-
Das Licht der Vernunft 199<br />
schen Paradigmas erfaßt werden kann: die Menschen glauben demnach z.B., ihre<br />
Ernteerträge sicherzustellen, tatsächlich aber festigen sie den sozialen Zusammenhalt.<br />
Die instrumentellen Anteile einer Handlung sind unter diesem Blickwinkel bei<br />
dem Versuch, das magische Denken zu "verstehen", weitgehend bedeutungslos. 339<br />
Eines dürfte unstrittig sein: Wer den Blick allein auf seinen instrumentellen<br />
Zweck richtet und versucht, das magische Ritual auf diesen zu reduzieren, reißt die<br />
so definierten magischen Akte aus dem Gesamtgeflecht der kollektiven Vorstellungen<br />
einer Gesellschaft heraus und verfehlt in seinem willkürlichen Reduktionismus<br />
den Kern des Phänomens. Dieser ist eher in der rituellen Praxis zu suchen und in<br />
den Sinnbezügen, die diese bereitstellt. Ein magischer Akt ist keine verfehlte instrumentelle<br />
Handlung — zumindest nicht notwendig und nicht per definitionem —<br />
und damit auch nicht umstandslos rationalisierungsfähig.<br />
DIE GESELLSCHAFTLICHE FUNKTION DER MAGIE<br />
Während <strong>für</strong> Frazer und Malinowski die Magie eine profane Angelegenheit mit rein<br />
utilitaristischer Bestimmung ist, identifiziert Durkheim sie als "Primitive Religion"<br />
und unterscheidet die magischen Einstellungen nicht grundsätzlich von anderen<br />
Glaubenshaltungen. Wie könnte er auch; denn <strong>für</strong> ihn ist die instrumentelle Seite<br />
der Magie weitgehend uninteressant, er fragt vielmehr nach ihrer gesellschaftlichen<br />
Funktion. Will man den Unterschied zwischen dem individualistisch-utilitaristischen<br />
bzw. "intentionalistischen" und dem funktionalistischen Ansatz in einem Satz zum<br />
Ausdruck bringen, sagt man wohl am besten: während im ersten Fall das Ganze (die<br />
Gesellschaft, die <strong>Institut</strong>ionen) von den bestimmenden Teilen (interessegeleiteten<br />
Handlungen der Individuen) her erklärt wird, werden im zweiten Fall die Teile (die<br />
individuellen Handlungen) über die Funktion (der sozialen Tatsachen, also <strong>Institut</strong>ionen<br />
und kollektiven Vorstellungen) in bezug auf den sozialen Zweck hin, der<br />
gleichzeitig das bestimmende Ganze ist (die Gesellschaft), erklärt. 340 Die folgende<br />
Mittel-Schema um einen <strong>für</strong> Handlungssysteme fundamentalen normativen Bestandteil, welchen die<br />
Positivisten als lediglich "irrational" verwarfen. Rituelle Handlungen sind nicht einfach irrational oder<br />
proto-rational und gründen in fehlerhaftem vorwissenschaftlichem Wissen, wie letztere behaupteten,<br />
sondern haben einen völlig anderen Charakter und können demzufolge nicht mit den Standards der<br />
intrinsiscvhen Rationalität gemessen werden.« (Ibid.) Dem entspricht die nach Durkheim duale Natur<br />
des Menschen: dieser zerfällt »in ein individuelles Wesen, das seine Basis im Organismus hat und dessen<br />
Wirkungsbereich dadurch eng begrenzt ist, und in ein soziales Wesen, das in uns, im intellektuellen und<br />
moralischen Bereich die höchste Wirklichkeit darstellt, die wir durch die Erfahrung erkennen können:<br />
ich meine die Gesellschaft.« (Durkheim 1912: 37)<br />
339 Allerdings ist es mit dem "Verstehen" unter funktionalistischen Blickwinkel nicht weit her: Kultur<br />
erscheint häufig allein als eine Funktion der Gesellschaft, d.h. als Ausfluß der Notwendigkeit, angesichts<br />
der divergierenden Einzelinteressen der Individuen den sozialen Zusammenhalt zu sichern. Die<br />
Substruktur der Gesellschaft ist auch <strong>für</strong> Durkheim der Hobbes'sche bellum omnium contra omnes.<br />
340 Während innerhalb des von Jarvie und Agassi augenscheinlich vertretenen intentionalisitisch-utilitaristischen<br />
bzw. (in seiner modernen Fassung) "rational choice" Paradigmas das Soziale sich sozusagen<br />
notwendig aus individueller Handlungsrationalität generiert, ist innerhalb des im zweiten Fall vertretenen<br />
gesellschaftstheoretischen Paradigmas das Soziale vorgängig, immer schon vorhanden.
200 Das Licht der Vernunft<br />
Passage ist Programm: »Sobald also der Soziologe die Erforschung irgendeiner Gattung<br />
soziologischer Tatbestände in Angriff nimmt, muß er sich bestreben, sie an einem<br />
Punkt zu betrachten, wo sie sich von ihren individuellen Manifestationen losgelöst<br />
zeigen.« (Durkheim 1901: 139) 341 Der letzte Halbsatz meint nicht allein einen<br />
Prozeß der Abstraktion, sondern vor allem, daß soziale Tatsachen nur mit sozialen<br />
Tatsachen zu erklären sind — vielleicht die berühmteste Formulierung Durkheims,<br />
der mit seinen "Regeln der soziologischen Methode" nicht zuletzt den beliebigen<br />
Rückgriffen seiner Zeitgenossen auf (individual-)psychologische Erklärungen ein Ende<br />
setzen wollte.<br />
»Die Gruppe denkt, fühlt und handelt ganz anders, als es ihre Glieder tun würden, wären sie<br />
isoliert. Wenn man also von den letzteren ausgeht, so wird man die Vorgänge in der Gruppe<br />
niemals verstehen können. Kurz, die <strong>Soziologie</strong> ist von der Psychologie in derselben Weise getrennt<br />
wie die Biologie von den physikalisch-chemischen Wissenschaften. Jedesmal, wenn ein<br />
soziologischer Tatbestand unmittelbar durch einen psychologischen erklärt wird, kann man<br />
daher dessen gewiß sein, daß die Erklärung falsch ist.« (Ibid.: 188)<br />
Durkheims Kritik richtet sich explizit gegen jede Art von utilitaristischer oder "naturalistischer"<br />
Begründung gesellschaftlicher Sachverhalte (d.h. sozialer Tatsachen).<br />
Das "natürliche Individuum" ist nicht die wirkende Ursache, von der eine Erklärung<br />
gesellschaftlicher Sachverhalte auszugehen hat, Intentionen und affektive Zustände<br />
werden eher erzeugt, als daß sie spontan oder zwangsläufig aus sich heraus entstehen.<br />
<strong>Institut</strong>ionen befriedigen demnach keine individuellen Bedürfnisse, jedenfalls<br />
nicht unmittelbar. Folgerichtig lautet eine der "Regeln" Durkheims: 342<br />
»Die bestimmende Ursache eines soziologischen Tatbestands muß in den sozialen Phänomenen, die ihm<br />
zeitlich vorangehen, und nicht in den Zuständen des individuellen Bewußtseins gesucht werden. [...] Die<br />
Funktion eines sozialen Phänomens kann nicht anders als sozial sein, d.h. sie besteht in der Erzeugung<br />
von Wirkungen, die sozial nützlich sind. Allerdings kann es vorkommen, und es<br />
kommt tatsächlich vor, daß sie zugleich den Individuen dient. Doch macht dieses glückliche<br />
Ergebnis nicht den unmittelbaren Grund ihres Daseins aus. Wir können also den obigen Satz<br />
folgendermaßen vervollständigen: Die Funktion eines sozialen Phänomens muß immer in Beziehung<br />
auf einen sozialen Zweck untersucht werden.« (Ibid.: 193)<br />
341 Durkheims <strong>Soziologie</strong> ist also eine Wissenschaft sui generis die sich mit einem originären Gegenstand,<br />
der von allen anderen Gegenständen geschieden ist, befaßt: soziale Tatsachen, <strong>Institut</strong>ionen, kollektive<br />
Vorstellungen.<br />
342 Als er die <strong>Soziologie</strong> zu einer unabhängigen Wissenschaft erklärte, hielt es Durkheim zwar <strong>für</strong><br />
notwendig, sie von der Psychologie abzugrenzen, (vgl. Lukes 1974: 16), aber Durkheim hat sich nie<br />
gegen psychologische Erklärungen an sich gewandt. »Wo Durkheim gegen die Psychologie polemisiert, meint er<br />
gar nicht Psychologie im allgemeinen, sondern einzig und allein die ... atomistische Psychologie. Mit anderen<br />
Worten: er meint immer nur sehr pointiert jene Psychologie, die ... "das Eigenrecht der Gesellschaft"<br />
aufhebt. Man kann das auch als "Psychosoziologie bezeichnen.« (König 1961: 36f.) Durkheim bemerkt<br />
zum Verhältnis des Ganzen und der Teile: »Die lebende Zelle enthält nur mineralische Bestandteile,<br />
ebenso wie die Gesellschaft nichts außer den Individuen enthält; und dennoch ist es offensichtlich<br />
unmöglich, daß die charakteristischen Erscheinungen des Lebens den Atomen des Wasserstoffs, Stickstoffs,<br />
Kohlenstoffs und Sauerstoffs innewohnen. [...] Das Leben läßt sich nicht derart zerlegen; es ist<br />
einheitlich, und infolgedessen kann es nur die lebende Substanz in ihrer Totalität zum Sitz haben. Es ist<br />
im Ganzen, nicht in den Teilen.« (1901: 93)
Das Licht der Vernunft 201<br />
Dieser Zweck ist primär die Perpetuierung des sozialen Bandes. 343 Man könnte also<br />
in Anlehnung an Durkheim sagen: Auf der expressiven oder symbolischen Ebene<br />
werden gewisse kollektive Vorstellungen zum Ausdruck gebracht, dargestellt, dramatisiert<br />
und damit gleichzeitig in den Individuen verankert — um darüber das soziale<br />
Band neu zu knüpfen, welches wiederum im Ritual "erlebt" wird. Der Magie,<br />
besser gesagt dem in magischen Vorstellungen gründenden Ritual (denn nur um diesen<br />
Aspekt geht es hier), scheint dergestalt eine irreduzible Rolle bei der Vergesellschaftung<br />
in "primitiven" Gesellschaften zuzukommen; die Preisgabe der magischen<br />
Vorstellungen bedeutete die Preisgabe der Kultur der "Wilden" — und dies ist<br />
ihnen vielleicht nur allzu bewußt. Der quasi-instrumentelle Charakter des magischen<br />
Aktes ist somit aus funktionalistischer Perspektive mehr oder weniger bedeutungslos,<br />
hätte doch die auf Grundlage gesellschaftlicher Konvention wirksame und<br />
allzu oft vorgeschriebene Handlung allein den Zweck, die Handelnden an die Gesellschaft<br />
zurückzubinden. In diesem Zusammenhang kommt dem kollektiven Ereignis,<br />
das viele magische Riten sind, besondere Bedeutung zu — was auch Hubert und<br />
Mauss in ihrer bereits zitierten Arbeit immer wieder hervorhoben.<br />
Man hätte es also mit zwei unterschiedlichen Formen von Handlungsrationalität zu<br />
tun, einer expliziten, "intrinsischen" und einer "symbolischen", die sozusagen hinter<br />
dem Rücken der Menschen wirkt. Die letzte Formulierung verweist auf die dem<br />
funktionalistischen Ansatz zugrundeliegende "implizite regulative Idee". Eine treffende<br />
Skizze dieser Denkfigur liefert Jon Elster: »Wenn man zeigen kann, daß ein<br />
gegebenes Verhaltensmuster nicht-intendierte, unerkannte und vorteilhafte Wirkungen<br />
hat, dann hat man ebenfalls erklärt, warum es existiert und Bestand hat.« (1979:<br />
60) Der Funktionalismus verdoppelt in gewissem Sinne die Realität: der Handelnde<br />
tut nicht das, was er eigentlich zu tun glaubt, und die von ihm selbst angegebenen<br />
Ziele seiner Handlung sind ganz andere als die tatsächlichen Ziele, die er sozusagen<br />
"implizit" verfolgt. Die Arbeiten der Durkheim-Schule verweisen diesbezüglich bereits<br />
auf A.R. Radcliffe-Browns »Lieblingsargument, wonach Rituale die Funktion<br />
haben, die Solidarität zu festigen. [...] Durch die Ausführung der Kulthandlungen<br />
sollen jene Gefühle erzeugt werden, die zur Festigung der Solidarität beitragen.«<br />
(Douglas 1986: 63f.) — Was <strong>für</strong> Douglas am funktionalistischen Ansatz vor allem<br />
fragwürdig ist, ist die Verbannung des denkenden und wollenden Subjekts aus der<br />
Szene. 344 Denn es ist evident, das eine solche Analyse den "Wilden" letztlich unterstellt,<br />
daß sie nicht wissen, was sie tun. Im Rahmen des funktionalistischen Paradig-<br />
343 »Wird also die Erklärung eines sozialen Phänomens in Angriff genommen, so muß die wirkende Ursache, von der<br />
es erzeugt wird, und die Funktion, die es erfüllt, gesondert untersucht werden. Wir wählen den Ausdruck<br />
Funktion und nicht Zweck oder Ziel, gerade weil die sozialen Phänomene im allgemeinen nicht im<br />
Hinblick auf die nützlichen Ergebnisse, die sie hervorbringen, existieren.« (Ibid.: 181)<br />
344 Mary Douglas widerspricht Radcliffe-Browns Lesart energisch: »Die These, wonach Rituale<br />
bestimmte Gefühle auslösen, steht auf schwachen Füßen.« (Ibid.) Nach Douglas sollte man funktionale<br />
Erklärungen zurückweisen, »die auf der Vorstellung basieren, Gefühle hielten das System in Gang.«<br />
(Ibid.: 64)
202 Das Licht der Vernunft<br />
mas entsteht demnach<br />
»ein unannehmbares Bild menschlichen Tuns, denn der Mensch erschiene als ein passiver<br />
Agent, dessen Handeln unter einem mehr oder weniger vollständigen Zwang erfolgte. Diese<br />
Darstellung beruht letztlich auf einem soziologischen Determinismus, der dem einzelnen weder<br />
Eigeninitiative noch überhaupt Sinn und Verstand zubilligt. Es lag zum Gutteil an diesen<br />
Mängeln, wenn der soziologische Funktionalismus in den letzten dreißig Jahren nur wenig Ansehen<br />
genossen hat. Er hatte keinen Platz <strong>für</strong> die subjektive Erfahrung von Individuen, die mit<br />
Willen begabt sind und Wahlentscheidungen treffen. Wer unterstellt, der einzelne sei nur ein<br />
Rädchen im Getriebe einer komplizierten Maschine, der macht ihn zu einem passiven Objekt,<br />
so daß er Schafen oder Robotern ähnelt. Noch schlimmer ist indessen, daß solche Theorien<br />
Wandel nicht zu erklären vermögen, es sei denn als eine Veränderung, die von außen durch<br />
unwiderstehlichen Zwang durchgesetzt wird. Wer ein solches Maß an Stabilität in den sozialen<br />
Beziehungen behauptet, der erwartet denn doch wohl zuviel Leichtgläubigkeit ...« (Ibid.: 59f.)<br />
Douglas sieht allerdings keine Alternative zu einer funktionalistischen Argumentation:<br />
wo sonst wäre Platz <strong>für</strong> »Durkheims ... Gedanken einer sozialen Gruppe die unbeabsichtigt<br />
Vorstellungen erzeugt, die ihrer eigenen Fortexistenz dienen?« (Ibid.:<br />
61) Womit sie erneut auf den zentralen Aspekt des funktionalistischen Begründungszusammenhangs<br />
verweist, den Douglas mit dem intentionalistischen verbinden<br />
möchte. Aber wie können überhaupt Handlungsmuster entstehen (und sich erhalten)<br />
die nicht-intendierte, aber <strong>für</strong> die Gesellschaft nützliche oder gar notwendige Folgen<br />
zeitigen? Diese Frage führt zurück auf den Aufsatz von Hubert und Mauss; ich will<br />
die Problematik hier nicht weiter vertiefen, sondern lediglich benennen, da sie innerhalb<br />
dieses Paradigmas nicht zu klären ist.<br />
Auch wenn sie einiges zur Aufklärung des Sachverhalts beiträgt, bleiben die<br />
bisher dargestellten interpretativen resp. funktionalistischen Argumentationen in<br />
zweierlei Hinsicht unbefriedigend. Erstens erscheint der expressive Anteil des magischen<br />
Aktes mit jenem Bereich zu korrespondieren, den Max Weber mit dem Attribut<br />
"wertrational" belegte. Weber unterschied zwischen "zweck-" und "wertrationalem"<br />
Handeln, wobei er auch letzterem — im Unterschied zu affektuellem und<br />
traditionalem Handeln (welches als unreflektiert und "bewußtlos" erscheint) — ausdrücklich<br />
Rationalität zubilligte, eine restringierte Rationalität allerdings (vgl. Weber<br />
1922: 17f.). 345<br />
345 Max Weber unterteilte menschliches Handeln in vier idealtypische Kategorien: (1) zweckrationales<br />
Handlungen sind bezogen auf ein gegebenes Ziel vernunftorientiert, d.h. in eine Zweck-Mittel Relation<br />
eingebunden; (2) wertrationales Handeln ist vernunftorientiert in Bezug auf einen (moralisch/ethischen)<br />
Wert, d.h. es orientiert sich nicht an Zwecken sondern an gesellschaftlichen Werten, die angestrebt<br />
werden; (3) affektuelles Handeln ist durch jeweils aktuelle Affekte und Emotionen bestimmt; (4) traditionales<br />
Handeln schließlich ist von Traditionen, d.h. "eingelebten Gewohnheiten" bestimmt. (vgl. Weber<br />
1922: 17) Weber belegte nur die ersten beiden Typen mit dem Attribut "rational", sie sind die einzig<br />
reflektierten. Jürgen Habermas merkt hierzu kritisch an, daß aus Webers Blickwinkel nur die Wirksamkeit<br />
eines kausalen Eingriffs in eine bestehende Situation und die Wahrheit einer empirischen Aussage<br />
über eine zweckrationale Mittelorganisation einer objektiven Beurteilung zugänglich sind. Deshalb wählt<br />
Weber die zweckrationale Handlung als Bezugspunkt <strong>für</strong> seine Typologie (vgl. 1981: 379f.). »In dieser<br />
Konstruktion kann Weber freilich "wertrationales" Handeln nur unterbringen, wenn er diesem eine<br />
restriktive Bedeutung beilegt. Hier kann dieser Typus nur gesinnungsethische, nicht aber verantwortungsethische<br />
Handlungsorientierungen einschließen.« (Ibid.: 380) Das Problem tritt aber nur dann auf,
Das Licht der Vernunft 203<br />
Die meisten Sozialanthropologen sind sich (zweitens) zudem offenbar darin einig,<br />
daß der instrumentelle Anteil eines magischen Aktes erstens existent und zweitens<br />
bezogen auf dessen erklärtes Ziel wirkungslos ist. Wie Evans-Pritchard exemplarisch<br />
schrieb: »Hexer, wie die Zande sie sich vorstellen, kann es offensichtlich nicht geben.«<br />
(Evans-Pritchard 1937: 60). Auf der technischen Ebene erscheinen Denken<br />
und Handeln der "Primitiven" somit offenbar weiterhin als defizitär. Das Problem<br />
besteht nun darin, daß wir vielleicht etwas zu vorschnell glauben, die expliziten Ziele<br />
einer Handlung begriffen zu haben; unsere Wahrnehmung ist unter Umständen<br />
ebenso präformiert wie die der Zande, wenn sie das Hühnerorakel befragen. Wir<br />
sollten uns jedenfalls davor hüten, die unserer Kultur eigenen Maßstäbe den Bräuchen<br />
anderer Völker voreilig überzustülpen und zu glauben (sic!), sie auf dieser<br />
Grundlage verstehen oder erklären zu können.<br />
wenn man unterstellt, das alle Menschen zu allen Zeiten die gleichen Ziele verfolgten.
9. Kapitel<br />
WIRKSAMKEIT UND WIRKLICHKEIT<br />
»Das Instrument unseres Denkens, unsere Sprache, ist nicht sonderlich<br />
gut geeignet, primitive Vorstellungen zu beschreiben.«<br />
(Henri Frankfort)<br />
Die Betrachtungen des vorigen Kapitels führen zurück zu der Frage, warum die<br />
"Primitiven" die Wirkungslosigkeit ihrer magischen Praktiken nicht einsehen. Wie<br />
kam es also, »daß intelligente Menschen nicht schon früher das Trügerische der Zauberei<br />
entdeckten? [...] Warum sich an Auffassungen klammern, die von der Erfahrung<br />
so rundweg ad absurdum geführt wurden? Wie konnte man es wagen, Versuche<br />
zu wiederholen, die so häufig fehlgeschlagen waren?« (Frazer 1922: 85) 346<br />
Evans-Pritchard merkt diesbezüglich zum Hexereiglauben der Zande an: »Außerhalb<br />
oder gegen ihre Anschauungen ... können sie nicht denken, weil sie kein System haben,<br />
in dem sie ihre Gedanken ausdrücken können.« (1937: 225f.) Die der Magie<br />
zugrundeliegenden Vorstellungen müssen demnach als Teil eines umfassenden Systems<br />
begriffen werden, außerhalb dessen kein Punkt existiert, von dem aus ein<br />
Zweifel formuliert oder auch nur gedacht werden kann.<br />
Die berühmtesten Passagen von Evans-Pritchards Zande-Monographie befassen<br />
sich mit den Mechanismen, über die dieses System gegen ihm widersprechende<br />
Erfahrungen abgeschottet wird bzw. diese Erfahrungen gar nicht erst zuläßt. Es ist<br />
mitnichten so, daß die Zande Widersprüche und Fehlschläge nicht wahrnehmen, sie<br />
erwarten sie sogar; Hexerei und Magie sind allgegenwärtig, man muß stets mit Gegenzauber<br />
rechnen. Das magische System ist somit letztlich zirkulär und stellt die<br />
Mittel bereit, jede Situation, die Zweifel erwecken könnte, in seinen Termini auszudeuten.<br />
So wird Epizykel an Epizykel gekettet und die Wahrnehmung letztlich dem<br />
Glauben untergeordnet.<br />
DIFFERENZ UND DIFFERENZIERUNG<br />
Aber letztlich gibt diese Lesart, ebenso wie jegliche Differenzierung zwischen instrumentellen,<br />
utilitaristischen und symbolischen, "expressiven" Handlungsanteilen<br />
nur die klassifikatorische Logik unserer Gesellschaft wider, <strong>für</strong> deren Selbstverständnis<br />
diese Differenzierung zentral ist. Wir projizieren unsere Kategorien auf die<br />
fremden Gesellschaften. Diesen Punkt hebt beispielhaft Jack Goody hervor: »Die<br />
Verortung eines "symbolischen" oder "expressiven" Elements im religiösen (d.h.<br />
"nicht-rationalen") Verhalten« stellt sich oft lediglich als »Eingeständnis der Unfähigkeit<br />
des Beobachters heraus, eine Handlung im Rahmen einer intrinsischen Mit-<br />
346 Frazer sieht selbst, daß diese Fragen nur bedingt zulässig sind: die Täuschungen waren durchaus nicht<br />
leicht zu erkennen, das Mißlingen lag keineswegs unmittelbar auf der Hand, »da in vielen, vielleicht in<br />
den meisten Fällen das ersehnte Ereignis tatsächlich über kurz oder lang dem Ritus, der es herbeiführen<br />
sollte, folgte.« (Ibid.)
Wirksamkeit und Wirklichkeit 205<br />
tel-Zweck-Beziehung, eines "rationalen" Ursache-Wirkungs-Schemas verständlich<br />
machen zu können.« (1961: 156) Weshalb der Beobachter vermutet, daß die fragliche<br />
Handlung etwas anderes ausdrückt oder es symbolisiert. An diesem Punkt ist<br />
<strong>für</strong> Goody die Einsicht in den "äußerlichen" Charakter Dichotomien Sakral-Profan<br />
und Übernatürlich-Natürlich von zentraler Bedeutung. Der Referent des Symbols<br />
wird demnach bei derartigen Konstrukten »vom Beobachter eingebracht ... und<br />
nicht vom Handelnden. Was nach Annahme des ersteren ausgedrückt (oder symbolisiert)<br />
wird, ist seine Interpretation von "Gesellschaft", "letzten Werten", "sozialer<br />
Ordnung" oder "sozialer Struktur".« (Ibid.)<br />
In einem derartigen Schema werden »symbolische Handlungen im Gegensatz<br />
zu rationalen Handlungen definiert und bilden eine Restkategorie, der vom Beobachter<br />
"Bedeutung" zugeschrieben wird«, um Verhalten, daß ihm ansonsten als<br />
irrational, pseudo-rational oder nicht-rational erschiene, verständlich machen zu<br />
können (Ibid.: 157). Eine eher hilflose Geste also. Es geht Goody nun aber nicht etwa<br />
darum, den symbolischen Charakter der fraglichen Handlungen zu leugnen, im<br />
Gegenteil: Was er hervorhebt, ist die Tatsache, daß auch in unserer Gesellschaft<br />
sämtliche Handlungen symbolisch vermittelt sind, was auch und gerade die Zwecktätigkeit<br />
betrifft 347 . Wenn Magie und Mythos (und Religion) vor allem den Zweck<br />
verfolgen, die "Welt" zusammenzufügen und zu einer Einheit zu integrieren, wenn<br />
ihr "Zweck" ist, dem Leben und den Sinneseindrücken "Sinn" zu geben, der menschlichen<br />
Tätigkeit (als unhintergehbar gesellschaftlicher) "Bedeutung" zu verleihen,<br />
eine intelligible Welt zu schaffen, in welcher sinnvolle instrumentelle, expressive<br />
und kommunikative Handlungsorientierungen möglich sind, dann ist die resultierende<br />
Synthese nur allzu wirklich. Ein westlicher Beobachter kann z.B. beim Gartenbau<br />
der Trobriander die Magie von der Zwecktätigkeit analytisch trennen, und auch die<br />
jeweiligen Diskurse unterscheiden, eine solche Differenzierung dürfte aber den<br />
Trobriandern selbst fremd und <strong>für</strong> sie bedeutungslos sein, da sie ihre Handlungen<br />
anders wahrnehmen (und klassifizieren).<br />
Warum können wir fremde Gesellschaften unter Umständen nicht verstehen? Was<br />
unterscheidet sie so sehr von der unseren? Der Schlüsselbegriff <strong>für</strong> das Verständnis<br />
der Differenz zwischen "ihnen" und "uns" ist, wie Barry Barnes im Anschluß an Mary<br />
Douglas sehr richtig anmerkt, "Differenzierung", und zwar in sehr vielfältiger<br />
Hinsicht. Die Unterscheidung zwischen "instrumentell" und "symbolisch" ist Teil<br />
dieser Differenzierung, und der "primitiven Kultur" eben deshalb unangemessen,<br />
weil diese in vielfältiger Hinsicht eine Einheit bildet. Um dies zu verdeutlichen zitiere<br />
ich einige Passagen aus Mary Douglas' "Reinheit und Gefährdung":<br />
»Selbstverständlich hoffen die Dinka, daß ihre Riten den natürlichen Ablauf der Ereignisse außer<br />
Kraft setzen. Selbstverständlich hoffen sie, daß Regenrituale Regen bringen, Heilungsrituale<br />
den Tod abwenden und Ernterituale eine gute Ernte bewirken werden. Doch dieser<br />
instrumentelle Aspekt ist nicht der einzige, unter dem wir die Wirksamkeit ihres symbolischen<br />
347 Auf diesen letzten Punkt verweist Goody allerdings nicht explizit.
206 Wirksamkeit und Wirklichkeit<br />
Handelns betrachten können. Es gibt noch eine andere Form der Wirksamkeit. Sie findet sich<br />
im Handeln selbst, in den Ordnungen, die dadurch geschaffen, und den Erfahrungen, die<br />
dadurch geprägt werden.« (1966: 91) »Die Kultur der Dinka bildet eine Einheit. Da alle ihre<br />
wesentlichen Erfahrungskontexte ineinandergreifen und sich durchdringen, sind fast alle ihre<br />
Erfahrungen — und folglich auch ihre wichtigsten Rituale — religiöser Natur. Unsere Erfahrungen<br />
dagegen entstammen Bereichen, die voneinander getrennt sind, und auch unsere Riten<br />
finden in getrennten Bereichen statt. [...] Wir modernen Menschen operieren in vielen verschiedenen<br />
symbolischen Handlungsfeldern. Für die Buschmänner, Dinka und viele andere<br />
primitive Kulturen existiert nur ein einziges symbolisches Handlungsfeld. Die Einheit, die sie<br />
... schaffen, umfaßt ... ein ganzes Universum, in dem alle Erfahrungen geordnet sind.« (Ibid.:<br />
92) »Der Unterschied zwischen ihnen und uns besteht nicht darin, daß sich unser Verhalten auf<br />
die Wissenschaft und das ihre auf Symbole stützt. Auch unser Verhalten trägt eine symbolische<br />
Bedeutung. Der eigentliche Unterschied ist der, daß wir in den verschiedenen Zusammenhängen<br />
nicht die gleichen ... Symbole einsetzen. Unsere Erfahrung ist fragmentiert.<br />
Unsere Rituale schaffen eine Vielzahl kleiner Subwelten, die nicht zusammenhängen. Ihre Rituale<br />
dagegen schaffen ein einziges, symbolisch konsistentes Universum.« (Ibid.: 93) »Das Ritual<br />
ist schöpferisch. Das, was die Magie des primitiven Rituals schafft, ist weit wunderbarer als<br />
die exotischen Höhlen und Paläste der Märchen: harmonische Welten mit abgestuften und geordneten<br />
Gruppen von Wesen, die die ihnen zugewiesenen Rollen spielen. Die primitive Magie<br />
ist alles andere als bedeutungslos. Sie ist es vielmehr, die dem Dasein Bedeutung verleiht.<br />
Das gilt nicht nur <strong>für</strong> die positiven, sondern genauso <strong>für</strong> die negativen Vorschriften. Die Verbote<br />
zeichnen die Konturen des Kosmos und die ideale soziale Ordnung nach.« (Ibid.: 97)<br />
Ich muß an dieser Stelle innehalten und einen kurzen Einschub machen, da Douglas'<br />
Beschreibung die Verhältnisse in den "primitiven" Kulturen etwas zu sehr idealisiert.<br />
In der Realität dürften diese sich kaum durchgängig als derart idyllisch darstellen. An<br />
anderer Stelle warnt Douglas selbst davor, den Kontrast zwischen "ihnen" und "uns"<br />
zu überzeichnen, wenn sie zu Webers These der "Entzauberung der Welt" in den<br />
modernen Industriegesellschaften anmerkt:<br />
»Die Geschichte endet mit Entschleierung und Entzauberung, Zweifel und dem Verlust der<br />
Legitimität. Unwahrscheinlich an der Geschichte, die solch institutionelles Denken hervorbringt,<br />
ist die Unterstellung, daß es eine Zeit gegeben habe, da Legitimität unumstritten gewesen<br />
wäre. Die These, daß es solch eine Zeit einmal gegeben habe, benutzen unsere <strong>Institut</strong>ionen<br />
zur Stigmatisierung subversiver Elemente. Hier wird listig das Gerücht ausgestreut, Inkohärenz<br />
und Zweifel seien Neuankömmlinge auf der Bühne der Geschichte, zusammen mit<br />
Straßenbahn und elektrischem Licht, unnatürliche Eindringlinge in die Welt ursprünglichen<br />
Vertrauens, wie sie die idyllische kleine Gemeinschaft darstellt. Dabei ist die These weitaus<br />
plausibler, daß die menschliche Geschichte von Anfang an durch Angriffe auf die jeweilige Autorität<br />
geprägt war.« (1986: 154f.)<br />
Aber auch wenn diese Kritik zutrifft: 348 Webers Diagnostik stellt die gesellschaftliche<br />
Wirklichkeit so dar, wie sie von vielen Angehörigen unserer "Zivilisation" empfunden<br />
wird, als Verlust umfassender und verbindlicher Sinn– und Bedeutungs-<br />
348 »Wer die Phänomene, die untersucht werden sollen, nach den bekannten und sichtbaren <strong>Institut</strong>ionen<br />
klassifiziert, der erspart sich die Schwierigkeit, seine Klassifikation rechtfertigen zu müssen,<br />
handelt es sich doch um das Begriffsschema, das allen, die in ähnlichen <strong>Institut</strong>ionen leben und durch sie<br />
denken, bereits vertraut ist.« (Ibid.: 153) Weber gibt demnach »nur das wieder, was seine Leser<br />
ohnehin <strong>für</strong> wahr halten.« (Ibid.: 155) Ich halte Douglas' Kritik zwar <strong>für</strong> überzogen, aber durchaus<br />
bedenkenswert.
Wirksamkeit und Wirklichkeit 207<br />
zusammenhänge, ein Auseinanderfallen der "entzauberten" Welt. Dieses Gefühl ist<br />
ebenso "wirklich" wie die Bedingtheiten unserer Ökonomie, und von daher hat die<br />
scharfe Kontrastierung der Verhältnisse in unterschiedlichen Gesellschaften, d.h. die<br />
idealtypische Gegenüberstellung durchaus Erklärungskraft. Ich muß aber an dieser<br />
Stelle nochmals ausdrücklich darauf verweisen, daß die Individuen in der "primitiven"<br />
Gesellschaft keine aus einer einzigen Schablone gestanzten identischen Kopien<br />
sind — dieser Vorbehalt sollte hier ins Gedächtnis zurückgerufen werden.<br />
Worum geht es also den "Wilden"? Um Erkenntnis, um Beeinflussung des Naturverlaufs<br />
oder schlicht um die Ordnung des Denkens, der Natur, der Gesellschaft?<br />
Vielleicht um all das zugleich, sie trennen diese Dinge nicht so, wie wir es tun. Das<br />
<strong>für</strong> uns dreifache Problem stellt sich, wenn man Douglas Glauben schenkt, bei ihnen<br />
offenbar als eines dar. Im magischen Ritus sind <strong>für</strong> uns unterschiedene Aspekte der<br />
"Realität" untrennbar verwoben, er schafft Zusammenhang und Kohärenz auf eine<br />
Art und Weise, die wir offenbar nur schwer nachvollziehen können. »Einer der wesentlichen<br />
Unterschiede zwischen der Art und Weise, wie wir reflektieren«, und<br />
derjenigen der "primitiven Völker" besteht, wie Claude Lévi-Strauss bemerkt, »in<br />
unserem Bedürfnis nach Zerlegung... Wir haben das von Descartes gelernt: Die<br />
Schwierigkeit in so viele Teile aufgliedern, wie zur leichtesten Lösung erforderlich<br />
sind. Das Denken der sogenannten primitiven Völker lehnt diese Zerstückelung ab.<br />
Eine Erklärung ist nur unter der Bedingung totaler Geltung von Wert.« (1988:<br />
163f.) 349 Man kann zudem nicht oft genug betonen, daß magische Akte nur aufgrund<br />
sozialer Konvention, allgemein geteilter Vorstellungen und Anschauungen wirksam<br />
und zudem weitgehend obligatorisch sind — ob sie nun öffentlich oder "privat" vollzogen<br />
werden. Sie bringen eine gemeinsame "Wirklichkeit" zum Ausdruck, welchen<br />
Status wir dieser Wirklichkeit auch immer zuschreiben.<br />
Muß man angesichts der Unschärfe und Vieldeutigkeit des Gegenstands "Magie" diesen<br />
ebenso wie den "totemistischen Komplex" als Illusion begreifen, als Konstrukt,<br />
das nur in den Köpfen der Anthropologen existiert? Dies ist scheint die Auffassung<br />
zu sein, welche Claude Lévi-Strauss im Anschluß an seine "Dekonstruktion" des To-<br />
349 Für Durkheim geht der »Unterschied zwischen primitiven und modernen Gesellschaften auf die<br />
Arbeitsteilung zurück. Wenn wir Solidarität verstehen wollten, müßten wir daher solche elementaren<br />
Gesellschaftsformen untersuchen, in denen kein Austausch hochdifferenzierter Güter und Dienstleistungen<br />
stattfindet. Nach Durkheim gelangen Individuen unter diesen elementaren Umständen zu<br />
einem übereinstimmenden Denken, indem sie ihre Idee der sozialen Ordnung verinnerlichen und sakralisieren.<br />
[...] Die gemeinsame Symbolwelt der natürlichen Klassifikationen verkörpert die Prinzipien der<br />
Autorität und Koordination. In einem solchen System treten keine Legitimationsprobleme auf, weil die<br />
Individuen die außerhalb ihrer selbst stehende gesellschaftliche Ordnung in sich tragen und auf die Natur<br />
projizieren. Eine entwickelte Arbeitsteilung zerstört indessen diese Harmonie zwischen Moral, Gesellschaft<br />
und Natur und ersetzt sie durch eine Solidarität, die auf dem Funktionieren des Marktes beruht.<br />
Durkheim glaubte nicht, daß in einer Industriegesellschaft eine Solidarität auf der Grundlage sakraler<br />
Symbolsysteme möglich sei.« (Douglas 1986: 33) Douglas gibt hier nur die Position Durkheims wider,<br />
vgl. ihre gerade zitierte Kritik an Weber.
208 Wirksamkeit und Wirklichkeit<br />
temismus in "Das Wilde Denken" vertritt; die magischen Tatsachen werden dort zurückgeführt<br />
auf den Versuch, Beziehungen zwischen Dingen, Lebewesen und Menschen<br />
herzustellen. Wenn Lévi-Strauss schreibt »Wer Logik sagt, sagt Herstellung<br />
notwendiger Beziehungen.« (1962b: 49), so ist das der Nachhall einer Formulierung<br />
von Hubert und Mauss, die schrieben: Im magischen Universum geschehen »alle<br />
Dinge nach Gesetzen, nach notwendigen Beziehungen, die zwischen den Dingen gesetzt<br />
sind, Beziehungen von Worten und Zeichen zu repräsentierten Objekten, nach<br />
Gesetzen der Sympathie allgemein und Gesetzen von Eigenschaften, die durch Klassifikationen<br />
kodifizierbar wären.« (1902/03: 140)<br />
Lévi-Strauss greift dergestalt die Auseinandersetzung der Durkheim-Schule<br />
mit Klassifikationssystemen und kollektiven Vorstellungen auf; und auch seine Orientierung<br />
an der (strukturalen) Sprachwissenschaft 350 erscheint als Fortführung von<br />
Teilen der Arbeit von Hubert und Mauss, die in ihrem "Entwurf einer allgemeinen<br />
Theorie der Magie" jenen Weg vorzeichnen, den Lévi-Strauss beschreitet: »Die Magie<br />
ist ... allein deswegen möglich, weil sie mit klassifikatorischen Arten operiert.<br />
Arten und Klassifikationen sind selber kollektive Phänomene, was sowohl durch ihren<br />
arbiträren Charakter als auch durch die geringe Anzahl der gewählten Objekte,<br />
auf die sie beschränkt sind, bewiesen wird. Sobald wir zur Vorstellung der magischen<br />
Eigenschaften kommen, haben wir also Phänomene vor uns, die denen der<br />
Sprache gleichen.« (Ibid.: 112) Alle Handlungen, Lebewesen und Dinge usw. (sowie<br />
deren Bestandteile) können, wenn sie hinreichend unterscheidbar und vergleichbar<br />
sind (und d.h. nicht völlig different) signifikant sein, d.h. zu Bedeutungsträgern werden.<br />
Sie verweisen dann zum einen direkt auf die anderen Elemente z.B. des Ritus<br />
oder Mythos, dem sie angehören (syntagmatische Beziehung), zum anderen indirekt<br />
auf mitgedachte, "ähnliche" Dinge, Sachverhalte etc. (paradigmatische Beziehung).<br />
351 Tatsächlich scheinen kulturelle Komplexe inneren Bildungsgesetzen zu folgen<br />
— wie die Sprache. Diese Einsicht — im Zusammenhang mit derjenigen in das<br />
Wesen der unbewußten Tätigkeit des Geistes, die darin besteht, einem Inhalt Formen<br />
aufzuzwingen, innere wie äußere Realität zu strukturieren 352 — macht die<br />
350 Da ich diesen Rückbezug bereits in Kapitel 3 ausführlich dargestellt habe, verzichte ich hier darauf,<br />
ihn nochmals zu erläutern.<br />
351 »Ebensowenig wie in der Religion vollzieht der Einzelne in der Magie Verstandesoperationen oder<br />
diese sind unbewußt. Ebensowenig wie der einzelne der Reflexion über die Struktur des Ritus bedarf,<br />
um ihn zu praktizieren, oder wie er sein Gebet oder sein Opfer begreifen muß, oder das Bedürfnis hat,<br />
daß der Ritus logisch ist, ebensowenig beunruhigt ihn die Frage, aus welchem Grunde die Eigenschaften<br />
wirken, die er verwendet, und er macht sich keine Gedanken über die rationale Rechtfertigung der<br />
Wahl und Verwendung der Substanzen. Gelegentlich können wir den verschütteten Weg<br />
zurückverfolgen, den die Ideen genommen haben, doch wer die Magie praktiziert, ist dazu im<br />
allgemeinen <strong>für</strong> sich nicht in der Lage. In seinem Denken gibt es nur die unbestimmte Idee einer<br />
möglichen Handlung, <strong>für</strong> die die Tradition die fertigen Mittel bereitstellt, um das gedanklich<br />
außerordentlich präzise bezeichnete Ziel zu erreichen.« (Hubert/Mauss 1902/3: 109)<br />
352 Lévi-Strauss, und dieser Punkt ist zentral, leugnet aber das von Durkheim und Mauss postulierte<br />
Primat des Sozialen ebenso wie den Rekurs auf das Mana als "magische Kategorie" (vgl. Lévi-Strauss<br />
1950). An dessen Stelle tritt der Geist, ein klassifizierender, von einem Grundbedürfnis nach Ordnung<br />
getriebener Geist.
Wirksamkeit und Wirklichkeit 209<br />
Qualität des strukturalistischen Ansatzes aus. Lévi-Strauss zeigt im "Wilden Denken",<br />
wie die Beziehungen des Menschen zum Menschen und zur Natur, wie Mythos,<br />
Ritus, Glaubensvorstellungen usw. in den kollektiven Vorstellungen als komplexes<br />
Ganzes existieren — existieren müssen. Dieses komplexe Ganze, die Wechselbeziehungen<br />
zwischen seinen Teilen und sein inneres Strukturprinzip meint der<br />
Begriff "Klassifikationssystem": Elemente werden identifiziert und innerhalb des<br />
Musters zueinander in Beziehung gesetzt.<br />
Aus dieser Tätigkeit entsteht ein sinnhaftes, "bedeutungsvolles" Konstrukt der<br />
Welt. 353 So handelt es sich zum Beispiel bei einer bestimmten symbolischen Handlung<br />
»nicht darum, zu wissen, ob durch Berührung mit einem Spechtschnabel Zahnschmerzen<br />
geheilt werden, sondern vielmehr darum, ob es möglich ist, in irgendeiner<br />
Hinsicht Spechtschnabel und Menschenzahn "zusammenzubringen" ... und durch<br />
solche Gruppenbildungen von Dingen und Lebewesen den Anfang einer Ordnung im<br />
Universum zu etablieren. Wie immer eine Klassifizierung aussehen mag, sie ist besser<br />
als keine Klassifizierung.« (1962b: 20f.) "Sinn" macht aber nur der Zusammenhang:<br />
»Der "Sinn" resultiert stets aus einer Kombination von Elementen, die selber<br />
nicht sinnvoll sind.« (Ibid.: 86) — Dies ist die stets wiederholte Grundformel des<br />
Strukturalismus. Dieser Prozeß muß schließlich notwendig kulturell vermittelt sein,<br />
um die Diskursivität der symbolischen Ordnung zu garantieren. Der Mensch bedarf<br />
einer solchen (stets "sekundären") Ordnung, welche geeignet ist seine Vorstellungswelt<br />
zu ordnen und seine Wahrnehmung zu organisieren. 354 Auch hier folgt<br />
Lévi-Strauss der Durkheim-Tradition: Der Zweck der Klassifikationssysteme besteht<br />
<strong>für</strong> Durkheim und Mauss<br />
»nicht darin, das Handeln zu erleichtern, sondern darin, die Beziehungen zwischen den Wesenheiten<br />
begreifbar, intelligibel zu machen. Sind erst einmal bestimmte, als fundamental erachtete<br />
Konzepte vorhanden, so hat der Geist das Bedürfnis, sie mit jenen Vorstellungen zu<br />
verbinden, die er sich von den übrigen Dingen macht. Solche Klassifikationen sind daher in erster<br />
Linie dazu bestimmt, die Ideen untereinander zu verknüpfen und dem Wissen Einheit zu<br />
verleihen« (1903: 249)<br />
Schließlich ist, wie bereits im 3. Kapitel deutlich wurde, <strong>für</strong> Lévi-Strauss die Herstellung<br />
von "Ordnung" das grundlegende Bedürfnis des Menschen und das vorran-<br />
353 Auf eben dieser Linie liegt auch S.J. Tambiahs Argumentation: »Eine Opferhandlung, die den<br />
Kosmos schafft, überdauert weil sie die Welt in einem Sinn "schafft", der von dem in einem<br />
Laboratorium bekannten unterschieden ist.« (1970: 294)<br />
354 Der Gedanke einer Ordnung des Symbolischen, welche die zwischenmenschliche Realität<br />
strukturiert, geht auf de Saussures Modell der Sprache als System wechselseitig aufeinander bezogener<br />
Zeichen zurück. Bei Claude Lévi-Strauss führt dies zum Begriff des (relativ autonomen) symbolischen<br />
Systems: Jede Kultur kann als Gesamtheit von Symbolsystemen betrachtet werden. Die Sprache<br />
strukturiert als diskursives System die innere Vorstellungswelt: in dem Maße wie sie Begriffe,<br />
Bezeichner zur Verfügung stellt, über die Vorstellungen organisiert werden. Voraussetzung da<strong>für</strong> ist<br />
allerdings das Sprechen: »Die Sprache ist erforderlich, damit das Sprechen verständlich sei und seinen<br />
Zweck erfülle. Das Sprechen aber ist erforderlich, damit die Sprache sich bilde; historisch betrachtet ist<br />
das Sprechen das zuerst gegebene Faktum.« (Saussure 1915: 22). Diese Aussage kann fraglos sowohl auf<br />
die Geschichte der Gattung wie auch auf die des Individuums bezogen werden.
210 Wirksamkeit und Wirklichkeit<br />
gige Ziel des "wilden" wie des "zivilisierten" Denkens (vgl. 1962b: 20f.). Der Prozeß,<br />
in dem sich diese Ordnung generiert, ist unbewußt und folgt eigenen Gesetzen:<br />
denen der Kontiguität und Similarität, womit sich der Kreis geschlossen hätte. 355<br />
Die Magie ist demnach in letzter Instanz auf das klassifikatorische Denken zurückzuführen.<br />
Sie stellte primär den Versuch dar, Beziehungen zwischen Gegenständen und<br />
Ereignissen zu postulieren. 356<br />
Diese Feststellung ist fraglos richtig, aber sie reicht nicht aus, denn »das magische<br />
Denken kann ... nicht von der Abstraktion leben.« (Hubert und Mauss<br />
1902/03: 108). Magie darf m.E. nicht umstandslos auf den doppelten Zweck, erstens<br />
die soziale Ordnung zu garantieren und zweitens das Bedürfnis des Geistes nach<br />
Ordnung zu befriedigen, zurückgeführt werden. Was also ist mit den instrumentellen<br />
Zwecken, die mit dem magischen Akt verknüpft sind? Jede Theorie der Magie,<br />
die Anspruch auf umfassende Geltung erheben will, muß schließlich in der Lage sein,<br />
auch diesen Aspekt zu integrieren. Denn Magie ist keine Illusion, sie ist nur allzu<br />
wirklich. Die Menschen spüren und nutzen ihre Kraft, wiewohl diese Kraft nur der<br />
gesellschaftlichen Konvention und damit den Menschen selbst entspringt. In dieser<br />
Hinsicht ist der Aufsatz von Henri Hubert und Marcel Mauss vielleicht das einsichtsvollste<br />
Werk, das je zu diesem Thema verfaßt wurde — trotz der von Lévi-Strauss<br />
angebrachten Vorbehalte und der von ihm vorgenommenen Präzisierungen und erzielten<br />
Fortschritte. Das große Verdienst Mauss' war und ist, auf der Wirklichkeit<br />
der von ihm untersuchten Phänomene zu beharren, sei es des Mana oder des Hau,<br />
jenes mysteriöse etwas, das der gegebenen Sache innewohnt. Mauss ging nicht etwa,<br />
wie Lévi-Strauss in seiner Einführung zur Mauss-Werkausgabe behauptet, den "Rationalisierungen“<br />
der Eingeborenen auf den Leim, er nahm sie ernst. Um sich die<br />
Kraft, die den Dingen in einer verzauberten Welt innewohnt vorzustellen, um die<br />
Wirksamkeit, der Magie in ihrer eigenen Wirklichkeit, zu erahnen, bedarf es allerdings<br />
keines großen Scharfsinns und auch keiner theoretischen Spitzfindigkeit. Selbst<br />
Malinowski 357 ahnte, was es mit der Magie auf sich hat:<br />
»Die Magie bietet dem Menschen eine Anzahl fixierter ritueller Akte und Glaubensvorschriften,<br />
eine bestimmte geistige und praktische Methode, die dazu dient, gefährliche Situationen<br />
in jeder wichtigen Beschäftigung und kritischen Lage zu überwinden. Sie befähigt den<br />
Menschen, seine wichtigen Aufgaben mit Vertrauen auszuführen, sein Gleichgewicht und seine<br />
geistige Integrität in Wutausbrüchen, in Qualen des Hasses, unerwiderter Liebe, der Verzweif-<br />
355 Noch ein weiterer wichtiger Punkt sei hier angesprochen: was den Menschen schließlich vom Tier<br />
unterscheidet, ist seine Fähigkeit, sich selbst zu objektivieren. Schließlich ist die vielleicht seit<br />
abertausenden von Jahren gestellte Frage "was ist der Mensch?" weitestgehend identisch mit "wer bin<br />
ich?". Der Mensch muß nicht nur Dinge und Ereignisse in einen Zusammenhang bringen, er muß auch<br />
sich selbst mit diesen in Zusammenhang setzen.<br />
356 Die Magie spielt offenbar in einigen Gesellschaften eine größere Rolle als in anderen, sie ist aber<br />
meines Wissens in keiner "primitiven" Kultur abwesend.<br />
357 Malinowski war beizeiten beseelt von einem kruden Utilitarismus: »Der Weg von der Wildnis zum<br />
Magen des Primitiven und infolgedessen zu seiner Seele ist sehr kurz, und <strong>für</strong> ihn ist die Welt ein<br />
neutraler Hintergrund, gegen den sich die nützlichen und vor allem die eßbaren Spezies der Tiere und<br />
Pflanzen abheben.« (1925: 30)
Wirksamkeit und Wirklichkeit 211<br />
lung und der Angst aufrechtzuerhalten. Die Funktion der Magie ist, den Optimismus des Menschen<br />
zu ritualisieren, seinen Glauben an den Sieg der Hoffnung über die Angst zu stärken. Die<br />
Magie drückt aus, daß Vertrauen <strong>für</strong> den Menschen eine größeren Wert hat als Zweifel,<br />
Standhaftigkeit größeren Wert als Unbeständigkeit und Optimismus größeren Wert als Pessimismus.<br />
[...] Ohne ihre Kraft und Führung hätte der primitive Mensch seine praktischen<br />
Schwierigkeiten nicht so meistern können, wie er es getan hat, noch hätte der Mensch höhere<br />
Kulturstufen erreichen können. Daher das universelle Vorhandensein der Magie in primitiven<br />
Gemeinschaften und ihr ungeheurer Einfluß. Deshalb finden wir, daß Magie ein unabänderliches<br />
Attribut bei allen wichtigen Tätigkeiten ist. Ich glaube, wir müssen in ihr die Verkörperung<br />
der sublimen Torheit der Hoffnung sehen, die dennoch die beste Schule <strong>für</strong> den Charakter<br />
der Menschen gewesen ist.« (1925: 73f.)<br />
Für Malinowski macht es also sehr wohl einen Unterschied, ob die magischen Riten<br />
ausgeführt werden oder nicht. Denn sie erfüllen ihren Zweck, wenn die Menschen<br />
auch nicht durchschauen, wie. Deshalb haben sie gute Gründe, an ihren Praktiken<br />
festzuhalten, die Erfahrung zeigt ihnen, daß sie wirksam und deshalb notwendig sind.<br />
Malinowskis funktionalistische Ausdeutung mag krude sein, aber man darf sie nicht<br />
einfach vom Tisch wischen. Sie räumt zumindest dem magischen Ritus eine Wirksamkeit<br />
ein, die sich allein aus dem Glauben an ihn, und damit aus dem sozialen<br />
Konsens speist (was in Malinowskis Ethnographie allerdings deutlicher wird als in<br />
seiner theoretischen Bearbeitung). Auch die Ritualisierung der Arbeiten, die mit der<br />
wechselseitigen Durchdringung von profanen Tätigkeiten und magischen Praktiken<br />
einhergeht, hat offenbar einen Wert an sich: sie fördert genau wie die magischen Riten<br />
die Konzentration und Zuversicht der Eingeborenen — in dem Maße, wie sie die<br />
Zwecktätigkeit "heiligt". Es ist ganz offensichtlich, daß der Trobriander seine Arbeit<br />
in einem anderen Geist (und in einer anderen, "verzauberten" Welt) verrichtet als<br />
der durchschnittliche Mitteleuropäer. Und wer würde meinen, daß die Trobriander,<br />
wenn sie den Ritus praktizieren, der den Baumstamm, aus dem einmal das Kanu<br />
werden soll, "leicht" macht und ihm die "Schwere" nimmt — damit das Boot später<br />
leicht über das Wasser gleiten wird — diesen Ritus ernster nehmen als wir, wenn<br />
wir einem Wunsch angesichts eines Vorhabens zum Ausdruck bringen, die Geste,<br />
mit der wir dies tun? Ein großer Teil unseres Unverständnisses dürfte auf der Überbetonung<br />
des Glaubens an die instrumentelle Wirksamkeit magischer Akte beruhen.<br />
JEDER IST IN SEINER EIGENEN WELT?<br />
Vielleicht sind die magischen Riten aber durchaus "wirksam" in einer "Wirklichkeit"<br />
die nicht die unsere ist — und vielleicht ist auch unsere Vorstellung von "Wirksamkeit"<br />
dem Gegenstand unangemessen. Insbesondere der erste der vorstehenden Sätze<br />
könnten die Quintessenz der Position Peter Winchs sein. Winch diskutiert Evans-<br />
Pritchards Beschreibung des Hexereiglaubens der Zande und kommt zu dem Schluß,<br />
daß Evans-Pritchard in einem entscheidenden Punkt irrt, nämlich »wenn er versucht,<br />
Wissenschaft im Sinn einer "Übereinstimmung mit der objektiven Wirklichkeit"<br />
zu bestimmen. Der Vorstellung, »die Ideen und Glaubensansichten der Menschen<br />
müßten durch Bezugnahme auf irgend etwas Unabhängiges — irgendeine
212 Wirksamkeit und Wirklichkeit<br />
Wirklichkeit — überprüfbar sein«, kommt zwar einerseits in unserer Kultur ein<br />
wichtiger Stellenwert zu, »sie aufzugeben, hieße in einen extremen protagoräischen<br />
Relativismus, mit allen dazugehörigen Widersprüchen zu verfallen. Andererseits ist<br />
sicherlich große Vorsicht geboten, wenn es um die genaue Bestimmung der Rolle<br />
geht, die diese Auffassung von einer unabhängigen Realität im menschlichen Denken<br />
spielt.« (1964: 76f.) Wenn ich ihn richtig verstehe, läuft Winchs Argumentation auf<br />
den folgenden Punkt hinaus: als Teil des Diskursuniversums der Zande "schafft" deren<br />
Magie sozusagen ihre eigene "Wirklichkeit". Somit ist auch ihre "Wirksamkeit"<br />
der magischen Handlung sozusagen inhärent: sie ist nicht universell wirksam oder<br />
unwirksam und kann mit unseren Kriterien empirisch nicht überprüft werden.<br />
Ein Standpunkt, wie Winch ihn vertritt, scheint vielen aufgrund des anklingenden<br />
Relativismus inakzeptabel. So widerspricht z.B. Steven Lukes in einem<br />
Aufsatz mit dem Titel »Zur gesellschaftlichen Determiniertheit von Wahrheit« vehement<br />
der Auffassung, wonach Wahrheitskriterien konventionell und kontextabhängig<br />
sind. Er vertritt im Gegenteil die These, daß sehr wohl bestimmte invariable<br />
und kontextunabhängige Wahrheits– und Geltungskriterien existieren, »und daß<br />
jene Kriterien, die tatsächlich kontextabhängig sind, ihnen aufliegen.« (1973a: 235)<br />
Nur wenn man von dieser Prämisse ausgeht, d.h. eine universalistische Position bezieht,<br />
können nach Lukes Unterschiede zwischen "Denkweisen" bezeichnet und Urteile<br />
über bestimmte Anschauungen gefällt werden. Was letztlich darauf hinaus läuft,<br />
daß die Existenz nicht-kontextbedingter Kriterien Bedingung der Möglichkeit von<br />
Kritik ist, da nur auf dieser Grundlage »Fragen nach der sozialen Rolle von Ideologie<br />
und falschem Bewußtsein« ermöglicht (Ibid.: 252) Diese entstehen demnach<br />
»überall dort, wo die Anschauungen der Menschen über ihre eigene Gesellschaft und über andere<br />
Gesellschaften als verzerrt oder falsch charakterisierbar sind, und wo diese Anschauungen<br />
infolge dieses Merkmals wichtige Auswirkungen auf die Gesellschaft haben. Nur wenn man<br />
annimmt, daß man ein verläßliches nicht relatives Mittel zur Feststellung der Differenz zwischen<br />
gesellschaftlichem Bewußtsein oder Kollektivvorstellungen einerseits und gesellschaftlicher<br />
Wirklichkeit andererseits zur Hand hat, kann man bestimmte Fragen über die Art<br />
und Weise aufwerfen, in der Glaubenssysteme sozialen Wandel verhindern oder vorantreiben<br />
können.« (Ibid.)<br />
Das heißt: »Nur durch die kritische Anwendung rationaler Maßstäbe ist eine Identifizierung<br />
jener Mechanismen möglich, die die Menschen an der Wahrnehmung der<br />
Falschheit oder Inkonsistenz ihrer Anschauungen hindern.« (Ibid.: 251) Dieser letzten<br />
Forderung ist sicher nicht pauschal zu widersprechen. Lukes geht offenbar von<br />
der Annahme aus, daß der Maßstab der Kritik ein unteilbarer, eben universaler ist,<br />
daß folglich wenn die Anschauungen der "Primitiven" nicht kritisierbar sind, dies<br />
auch auf unsere eigene Weltauffassung zutrifft. Lukes begeht hier m.E. einen Kategorienfehler.<br />
Die "Wahrheit" und "Wirklichkeit", auf die er rekurriert, weisen erstens<br />
über die Wahrheit und Wirklichkeit des Experiments hinaus, sind nicht nur<br />
"empirische" sondern eben gesellschaftliche Entitäten. Zweitens haben wir es bei<br />
den Zande, den Trobriandern, den Guayaki usw. nicht mit Ideologien in dem Sinne<br />
zu tun, den der Begriff bezogen auf unsere Gesellschaft hat. Glaubenssysteme und
Wirksamkeit und Wirklichkeit 213<br />
Weltauffassungen sind nicht per se Ideologien, weil sie zum Teil in einem vollkommen<br />
differenten gesellschaftlichen Zusammenhang situiert sind. 358<br />
Die vorstehenden Bemerkungen führen zurück auf das von Winch thematisierte<br />
Problem des "Verstehens" fremder Kulturen oder Glaubensanschauungen: die<br />
"Wirklichkeit Gottes" 359 ist denjenigen, <strong>für</strong> deren Sünden Jesus Christus sich ans<br />
Kreuz schlagen ließ, tatsächlich Realität, aber eine andere Realität als diejenige meiner<br />
Computertastatur. Winch schreibt in Die Idee der Sozialwissenschaft und ihr<br />
Verhältnis zur Philosophie:<br />
»Unsere Vorstellungen davon, was dem Bereich der Wirklichkeit angehöre, entstammen der<br />
Sprache, deren wir uns bedienen. Unsere Begriffe regeln die Form unserer Welterfahrung. Es<br />
dürfte gut sein, sich an die Trivialität zu erinnern, daß wir, wenn wir von der Welt sprechen,<br />
von dem sprechen, was wir mit dem Ausdruck "die Welt" faktisch meinen: wir haben keine<br />
Möglichkeit, uns jenseits der Begriffe zu begeben, in deren Rahmen wir Gedanken über die<br />
Welt fassen... Die Welt ist <strong>für</strong> uns das, was sich uns durch diese Begriffe hindurch darbietet.<br />
Das heißt nicht, daß unsere Begriffe sich nicht wandeln könnten; aber wenn sie das tun, bedeutet<br />
es, daß auch unser Begriff der Welt sich gewandelt hat.« (Winch 1958: 25)<br />
Wenn man ihn wendet, und die idealistische durch eine "realistische" Formulierung<br />
ersetzt ("Wenn unsere Welt sich ändert, wandelt sich unsere Vorstellung von der<br />
Wirklichkeit"), führt der letzte Satz direkt zu Émile Durkheim. 360 Ein Rückgriff auf<br />
dessen soziologische Erkenntnistheorie ist durchaus geeignet, einige grundsätzliche<br />
Mißverständnisse bezüglich der Frage nach der Kontextgebundenheit von Wahrheitskriterien<br />
auszuräumen.<br />
DIE ELEMENTAREN FORMEN DER ERKENNTNIS<br />
Für Durkheim sind die Grundlagen unserer Erkenntnisfähigkeit gleichermaßen relativ<br />
wie universell. Die "primitive Religion" 361 hat sich demnach »nicht darauf beschränkt<br />
..., den vorher ausgebildeten menschlichen Geist mit einer bestimmten Anzahl<br />
von Ideen zu bereichern, sie hat dazu beigetragen, ihn überhaupt zu bilden. Die<br />
358 Auch diesbezüglich sollte der Kontrast allerdings nicht überbetont und die Funktion bestimmter<br />
Anschauungen im Einzelfall überprüft werden. Zum Ideologiebegriff und der Bedingung der Möglichkeit<br />
von Ideologiekritik vgl. Ricœur 1977.<br />
359 »Der entscheidende Punkt ist, daß die Auffassung von der Wirklichkeit Gottes ihren Ort innerhalb<br />
des religiösen Sprachgebrauchs hat, obwohl dies ... nicht bedeutet, daß diese Auffassung von dem abhängt,<br />
was irgendwelche einzelnen zu behaupten gewillt sind. Wäre es so, dann hätte Gott keine<br />
Wirklichkeit.« (Winch 1964: 78)<br />
360 »Die Vorstellungen, die sich ein Mensch von der Wirklichkeit macht, durchwalten die gesellschaftlichen<br />
Beziehungen zu seinen Mitmenschen. "Durchwalten" ist sogar ein zu schwacher Ausdruck:<br />
gesellschaftliche Beziehungen sind Manifestationen von Realitätsvorstellungen.« (Ibid.: 34f.) Winch stellt<br />
zwar auch hier Durkheim gewissermaßen auf den Kopf, der Zusammenhang zwischen beiden Ansätzen<br />
ist aber evident.<br />
361 Durkheims Gegenstand in "Die elementaren Formen des religiösen Lebens" ist das, was Frazer dem<br />
Bereich der magischen Handlungen und Vorstellungen zuordnete, weil er »den tiefen religiösen<br />
Charakter der Glaubensüberzeugungen und Riten« nicht erkannte (1912: 45).
214 Wirksamkeit und Wirklichkeit<br />
Menschen verdanken ihr nicht nur zu einem bedeutsamen Teil den Inhalt ihrer<br />
Kenntnisse, sondern auch die Form, nach der diese Kenntnisse sich gebildet haben.«<br />
(Durkheim 1912: 27) Gegenstand der "Elementaren Formen des religiösen Lebens"<br />
sind auch die Wurzeln der menschlichen Erkenntnisfähigkeit und das Verhältnis von<br />
Begriff (Idee) und Sache (Wirklichkeit). — Was ist wahr, was wird fälschlich <strong>für</strong><br />
wahr gehalten, wie können wir zu wahrer Erkenntnis gelangen?<br />
Mit diesen epistemologischen Grundfragen befaßt sich eine lange philosophische<br />
Tradition. Die Rationalisten (z.B. Descartes) zweifelten an der Verläßlichkeit<br />
unserer Sinneswahrnehmung und gingen vom Primat der (angeborenen) Ideen<br />
aus. Die Erkenntnis des "Wesentlichen" erfolgt durch rationale Intuition auf Grundlage<br />
eines vorgängigen Wissens um das Wesen der Dinge (das sich in den Erscheinungen<br />
nur unvollkommen und widersprüchlich manifestiert). Die Ordnung der<br />
Wirklichkeit ist <strong>für</strong> die Rationalisten also im menschlichen Geist angelegt, wahr ist<br />
das, was wir durch Introspektion erfahren. 362 Für die Empiristen wie John Locke<br />
hingegen sind unsere Ideen und Konzepte allein Resultat von Sinneseindrücken: Der<br />
Geist ist anfänglich ein unbeschriebenes Blatt, dessen Inhalte sich durch Erfahrung<br />
formen und vervollkommnen (hier kommt bei Locke der wissenschaftliche Fortschritt<br />
ins Spiel). Die Ordnung der Wirklichkeit ist in der äußeren Natur gegeben<br />
und wird von Menschen nach und nach erkannt (damit ist auch keine Erkenntnis in<br />
normativen Fragen möglich). Kant versuchte, beide Positionen zu vereinen, indem<br />
er die Rolle der Anschauungsformen (Raum und Zeit) und Kategorien (Formen des<br />
Denkens) bei der Begriffsbildung (d.h. Verallgemeinerung, Abstraktion, Klassifikation)<br />
untersuchte. Demnach sind nicht die Ideen, wohl aber die formalen Strukturen,<br />
welche diese in Auseinandersetzung mit der Natur (Erfahrung) formen, allgemeingültig.<br />
Diese angeborenen Formen, welche die Erkenntnisfähigkeit begründen, machen<br />
das Transzendentalsubjekt aus. Erkenntnis beginnt demnach also mit Erfahrung<br />
(und ist nicht a priori gegeben, wie die Rationalisten behaupten), ist aber nicht durch<br />
sie determiniert (d.h. kein reines a posteriori, wie die Empiristen behaupten). Damit<br />
ist Kants Denken aber noch weitgehend dem Rationalismus verhaftet. Hier setzt<br />
Durkheim an. Für diesen sind die Kategorien (als Prinzipien der Klassifikation bzw.<br />
Begriffsbildung) nicht angeboren, sondern entspringen der Gesellschaft. Durkheims<br />
soziologische Erkenntnistheorie vereint, in seinen Worten, »die Vorteile der beiden<br />
rivalisierenden Theorien ..., ohne deren Nachteile zu haben. Sie behält alle wesentlichen<br />
Prinzipien des Apriorismus, und zu gleicher Zeit läßt sie sich von dem Geist der<br />
Positivität anregen, den zu befriedigen der Empirismus sich bemüht hatte. Sie läßt<br />
der Vernunft ihre spezifische Kraft, aber sie rechtfertigt sie, und das, ohne die beobachtbare<br />
Welt zu verlassen. [...] Die Kategorien hören also auf, als nichtanalysierbare<br />
Urfakten angesehen zu werden.« (1912: 41) 363<br />
362 Die rationalistische Position geht auch davon aus, daß angeborene Ideen von Moral und Religion<br />
existieren, die universell wahr sind.<br />
363 Die Kategorien »sind die allgemeinsten Konzepte, die es gibt, da sie sich auf die ganze Wirklichkeit<br />
beziehen und gleichzeitig keinem einzelnen Gegenstand anhaften; sie sind von jedem einzelnen
Wirksamkeit und Wirklichkeit 215<br />
Der berühmte Aufsatz "Über einige primitive Formen der Klassifikation" von Émile<br />
Durkheim und Marcel Mauss ist nicht nur ein "Beitrag zur Erforschung der kollektiven<br />
Vorstellungen" (wie der Untertitel lautet), sondern auch ein Schritt hin zur<br />
einer originär soziologischen Erkenntnistheorie, mithin der Versuch »in den Methoden<br />
des wissenschaftlichen Denkens echte soziale <strong>Institut</strong>ionen zu erblicken, deren<br />
Genese nur die <strong>Soziologie</strong> nachzuzeichnen und zu erklären vermag.« (1903: 171). 364<br />
Durkheim und Mauss argumentieren gegen jegliche rationalistische oder empiristische<br />
Erklärung der "Klassifikationsfunktion". Beide Auffassungen werden <strong>für</strong> die Autoren<br />
durch den Sachverhalt widerlegt, daß die Art und Weise, wie wir klassifizieren,<br />
»relativ neuen Datums ist«. Wären die Prinzipien des Klassifizierens invariant,<br />
d.h. im menschlichen Geist oder der Natur angelegt, hätten sich die Klassifikationssysteme<br />
historisch nicht wandeln können — was sie aber taten. Dies gilt speziell<br />
<strong>für</strong> die naturwissenschaftliche Klassifikation. Noch bis ins 18. Jahrhundert war man<br />
hauptsächlich an Metamorphosen, d.h. dem Übergang von einer Art zur anderen<br />
(und den untergründigen Verbindungen zwischen den Arten) interessiert (vgl. Jacob<br />
1970, 1. Kapitel). Die Vorstellung, daß die Arten durch klare Grenzen voneinander<br />
geschieden sind, begann sich erst im 17. Jahrhundert durchzusetzen; Carl von Linnés<br />
wissenschaftliches Ordnungssystem des Tier– und Pflanzenreichs ist ein Produkt der<br />
Neuzeit. Was nicht heißt, daß Menschen fremder und vergangener Kulturen nicht<br />
klassifizier(t)en. Sie tun dies sehr wohl — aber eben anders. 365 Wie bereits weiter<br />
oben erwähnt, befaßten sich Durkheim und Mauss ausführlich mit den sog. "totemistischen"<br />
Klassifikationen, bei denen nach Ansicht der Autoren die Sozialorganisation<br />
(d.h. die gesellschaftliche Segmentierung respektive soziale Morphologie) die Klassifikation<br />
der Natur bestimmt:<br />
»Die ersten logischen Kategorien waren soziale Kategorien; die ersten Klassen von Gegenständen<br />
waren Klassen von Menschen in die auch Dinge integriert waren. Weil die Menschen<br />
Gruppen bildeten und weil sie sich selbst als Gruppen wahrnahmen, faßten sie die übrigen<br />
Dinge und Lebewesen im Geiste gleichfalls zu Gruppen zusammen, und diese beide Arten der<br />
Gruppenbildung begannen dann bis zur Ununterscheidbarkeit ineinander zu verfließen. Die<br />
Phratrien waren die ersten Gattungen und die Klane die ersten Arten. Die Dinge galten als integraler<br />
Bestandteil der Gesellschaft; ihr Platz in der Gesellschaft bestimmte letztlich, welchen<br />
Platz sie in der Natur einnahmen.« (1903: 250f.)<br />
Gegenstand unabhängig.« (Durkheim 1912: 33)<br />
364 "Klassifikation" ist die systematische Einteilung von Begriffen respektive Gegenständen und Sachverhalten,<br />
d.h. jenes Verfahren, »das darin besteht, die Wesenheiten, Ereignisse und Tatsachen der Welt<br />
zu Gattungen und Arten einzuteilen, die einen unter die anderen zu subsumieren und ihre jeweilige<br />
Inklusion oder Exklusion zu bestimmen.« (Ibid.: 171)<br />
365 »Begrifflich denken heißt nicht einfach, gemeinsame Merkmale einer bestimmten Anzahl von<br />
Objekten zu isolieren und zusammenzufassen; es heißt, das Veränderliche dem Beständigen<br />
unterzuordnen, das Individuelle dem Sozialen. Und da das logische Denken mit dem Begriff beginnt,<br />
folgt daraus, daß es immer existiert hat. Es hat keine historische Periode gegeben, in der der Mensch<br />
chronisch in der Verwirrung und im Widerspruch gelebt hätte. Gewiß kann man nicht genug auf die<br />
unterschiedlichen Züge hinweisen, die die Logik zu den verschiedenen Zeiten gekannt hat. Sie<br />
entwickelte sich wie die Gesellschaften selbst. Wie groß diese Unterschiede aber auch seien, so dürfen<br />
sie doch nicht dazu führen, die Ähnlichkeiten zu verkennen, die nicht weniger wesentlich sind.«<br />
(Durkheim 1912: 587)
216 Wirksamkeit und Wirklichkeit<br />
Im Gegensatz zu uns, wo z.B. die Biene in der Klasse der Insekten und diese wiederum<br />
im Stamm der Gliederfüßler enthalten ist, kennt die "totemistische" Klassifikation<br />
diese Art der Abstraktion aufgrund "natürlicher" Merkmale nicht, hier ist<br />
die Biene vielleicht einem Unterklan zugeordnet, den sie bezeichnet ("Die Bienen"),<br />
und ist in einen Klan (beispielsweise dem des Donners) enthalten, der wiederum<br />
Teil einer "Hälfte" (z.B. der des Nordens) ist. Die dergestalt gedachte Beziehung<br />
zwischen den Arten, den Elementen und der Geographie entspricht derjenigen zwischen<br />
den sozialen Segmenten: »Nicht nur die äußere Form dieser Gegenstandsklassen<br />
ist sozialen Ursprungs; auch die Beziehungen, die zwischen ihnen bestehen,<br />
sind es. Weil die menschlichen Gruppen ineinandergeschachtelt sind — der Unterklan<br />
ist im Klan enthalten, der Klan in der Phratrie, die Phratrie im Stamm —,<br />
herrscht unter den Gruppen, zu denen die Dinge zusammengefaßt sind, dieselbe<br />
Ordnung.« (Ibid.: 251) Die gesellschaftliche Differenzierung ist diesbezüglich Bedingung<br />
der Möglichkeit einer Klassifikation der Natur. Wie Durkheim an anderer Stelle<br />
bemerkt, kann nichts in der Natur den Menschen »die Idee einer Klasse eingeben<br />
..., d.h. eines Rahmens, der die ganze Gruppe aller Objekte umfassen könnte, die<br />
dieselbe Bedingung erfüllen.« (1912: 589)<br />
Soviel zu ihren Wurzeln. Der Zweck der Klassifikationssysteme besteht <strong>für</strong><br />
Durkheim vor allem darin, die Welt mit (geordneter) Bedeutung zu versehen, durch<br />
sie werden die Dinge "denkbar". Das betrifft nicht nur die Natur, sondern auch die<br />
Gesellschaft selbst. Diese ist Quelle und Ziel der klassifikatorischen Tätigkeit. Die<br />
Gesellschaft setzt demnach »eine bewußte Organisation ihrer selbst voraus, die<br />
nichts anderes ist als eine Klassifizierung.« (Ibid.: 592) Sie besteht mithin »nicht einfach<br />
aus der Masse von Individuen, aus der sie sich zusammensetzt [...] sondern vor<br />
allem aus der Idee, die sie sich von sich selbst macht.« (Ibid.: 566)<br />
Die Bedeutung des Aufsatzes von Durkheim und Mauss liegt nicht zuletzt darin,<br />
daß das begriffliche Denken <strong>für</strong> die Autoren ein in doppelter Hinsicht gesellschaftliches<br />
ist, und Begriffe als kollektive Vorstellungen eine zentrale vergesellschaftende<br />
Funktion haben. Ebenso wie die Kategorien sozialen Ursprungs sind, ist <strong>für</strong><br />
Durkheim der erste Gegenstand, auf den sie bezogen werden, die Gesellschaft.<br />
»Wenn die Gesamtheit der Dinge als einheitliches System verstanden wird, so weil<br />
man auch die Gesellschaft in dieser Weise sieht. Sie ist ein Ganzes, oder genauer: Sie<br />
ist das einzige Ganze, auf das alles übrige bezogen ist.« (1912: 590) Die organisierte<br />
Gesellschaft ist nach Durkheim nur dann »möglich, wenn die Individuen und die<br />
Dinge, die sie zusammensetzen, in verschiedene Gruppen aufgeteilt, d.h. klassifiziert<br />
sind, und wenn diese Gruppen selbst in bezug aufeinander in Klassen eingeteilt<br />
sind.« (Ibid.: 592).<br />
Die begriffliche Ordnung ist demnach nicht von der sozialen (bzw. moralischen)<br />
Ordnung zu trennen; die Gesellschaft kann »die Kategorien nicht der Willkür<br />
der Individuen überlassen, ohne sich selbst aufzugeben. Um leben zu können,<br />
braucht sie nicht nur einen genügenden moralischen Konformismus; es muß auch ein<br />
Minimum an logischem Konformismus vorhanden sein, den sie nicht entbehren
Wirksamkeit und Wirklichkeit 217<br />
kann.« (Ibid.: 38) 366 Da wir uns Dinge nur vorstellen können, wenn sie unterschieden<br />
sind, ist die soziale Unterteilung folglich zwingend notwendig, um erstens die<br />
Gesellschaft und zweitens uns selbst als gesellschaftliche Wesen denken zu können.<br />
Das begriffliche Denken ist somit eine anthropologische Konstante: »Wenn man<br />
sagt, daß die Begriffe die Art und Weise ausdrücken, wie sich die Gesellschaft die<br />
Dinge vorstellt, heißt das auch, daß das begriffliche Denken gleichzeitig mit der<br />
Menschheit entstanden ist. [...] Ein Mensch, der nicht in Begriffen denkt, kann kein<br />
Mensch sein; denn er wäre kein soziales Wesen. Eingeschränkt allein auf die individuellen<br />
Wahrnehmungen, wäre er nicht von Tier zu unterscheiden.« (Ibid.: 586;<br />
Hervorh. von mir) 367 Der Mensch ist gesellschaftliches Wesen — oder er ist nicht.<br />
Auf die Schwächen des Ansatzes von Durkheim und Mauss wurde von verschiedenen<br />
Autoren hingewiesen. Nach Steven Lukes (1973: 445) sollte dessen empirische Validität<br />
von seiner theoretischen Signifikanz geschieden werden. Erstere ist durchaus in<br />
Zweifel zu ziehen. Zunächst einmal unterschlug das ethnographische Material entweder<br />
die Existenz weiterer Klassifikationssysteme, die neben den "totemistischen"<br />
in den fraglichen Gesellschaften vorhanden sind, oder die Autoren erkannten deren<br />
Vorhandensein nicht (Ibid.: 446). Am schwersten wiegt aber wohl der Einwand, daß<br />
das von Durkheim und Mauss präsentierte Material keineswegs überzeugend die<br />
These belegt, wonach eine spezifische Form der sozialen Organisation bzw. Morphologie<br />
eine bestimmte Systematik der Klassifikation verursacht (Ibid.: 448). 368<br />
366 Was <strong>für</strong> die Kategorien gilt, trifft demnach auch auf die Begriffe zu: sie sind sozialen Ursprungs.<br />
»Die Sprache, und folglich das System der Begriffe, die sie vermittelt, [ist] das Ergebnis einer kollektiven<br />
Ausarbeitung... Es drückt die Art und Weise aus, wie sich die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit die<br />
Objekte der Erfahrung vorstellt. Die Begriffe, die den verschiedenen Elementen der Sprache<br />
entsprechen, sind also kollektive Vorstellungen.« (Ibid.: 581)<br />
367 In diesem Zusammenhang kommt, wie in Kapitel 3 bereits ausgeführt, in segmentären<br />
Gesellschaften den Heiratsregeln eine zentrale Bedeutung zu, ohne sie ginge entweder die Differenzierung<br />
oder der gesellschaftliche Zusammenhalt verloren; bei regellosen Heiraten untereinander würden<br />
die Segmente zu einem konturlosen Konglomerat verschmelzen, genügten die Gruppen sich hingegen als<br />
"inzestuöse" Einheiten selbst, trieben sie auseinander.<br />
368 Marshall Sahlins merkt hierzu an: »Durkheims soziologische Erkenntnistheorie hatte als Bedeutungstheorie<br />
ihre Grenzen [...] Es war ... die fatale Unterscheidung von sozialer Morphologie und Kollektivvorstellung<br />
— die von modernen Autoren als Gesellschaft (oder soziales System) versus Kultur<br />
(oder Ideologie) wiederholt wird —, die die Reichweite des Symbolischen willkürlich begrenzte [...]<br />
Die Schwierigkeit war, daß Durkheim die Kategorien, die die Gesellschaft "voraussetzt", aus der bereits<br />
erreichten Beschaffenheit der Gesellschaft ableitete und so die Form der Gesellschaft, außer als "natürliche",<br />
unerklärt ließ. Daher der Dualismus von sozialer Struktur und kulturellem Inhalt.« (1976: 168)<br />
Lévi-Strauss übt eine ähnliche Kritik an Durkheim: »Kein soziales Phänomen kann erklärt werden, und<br />
die Existenz der Kultur selbst ist unverständlich, wenn der Symbolismus nicht als eine a priori<br />
Notwendigkeit des soziologischen Denkens eingesetzt wird. Durkheim war sich der Bedeutung des<br />
Symbolismus sehr bewußt, aber wahrscheinlich nicht genug. [...] Die <strong>Soziologie</strong> kann die Genesis des<br />
symbolischen Denkens nicht erklären, sie muß sie als im Menschen gegeben nehmen. Wo die<br />
funktionale Methode notwendig ist, wechselt Durkheim dagegen über zu der kausalen: er versucht, das<br />
Symbol aus der Vorstellung und das Zeichen aus der Erfahrung abzuleiten. [...] Gesellschaft kann ohne<br />
Symbolismus nicht existieren, aber anstatt aufzuzeigen, wie das Erscheinen des symbolischen Denkens<br />
das soziale Leben insgesamt möglich und notwendig macht, versucht Durkheim das Gegenteil, d.h. er<br />
läßt den Symbolismus aus der Gesellschaft erwachsen.« (1945b: 517f.)
218 Wirksamkeit und Wirklichkeit<br />
Durkheim und Mauss gingen fraglos zu weit, als sie die Prinzipien der primitiven<br />
Klassifikation mehr oder weniger direkt aus der sozialen Morphologie, dem Strukturprinzip<br />
der Segmentierung, herleiten wollten. Durkheim formuliert aber bereits<br />
in den "Elementaren Formen des religiösen Lebens" eine differenziertere Position. Dort<br />
hebt er hervor, daß »das kollektive Bewußtsein ... etwas anderes [ist] als eine einfache<br />
abgeleitete Erscheinung seiner morphologischen Basis« ist (1912: 567). Die Religion<br />
(als Denk– und Ordnungssystem) begnügt sich nicht damit, »die materiellen<br />
Formen einer Gesellschaft und ihre unmittelbaren Vitalinteressen in eine andere<br />
Sprache zu übersetzen.« (Ibid.) Damit sagt Durkheim meines Erachtens zweierlei:<br />
daß erstens die Klassifikationen der gesellschaftlichen Praxis entspringen, daß aber<br />
zweitens diese Praxis das geistige Leben einer Gesellschaft nicht determiniert. 369<br />
Wie relativistisch ist Durkheims Ansatz? Die Feststellung, daß sich die Prinzipien<br />
der Klassifikation, die ja auch diejenigen der Begriffsbildung sind, von Gesellschaft<br />
zu Gesellschaft unterscheiden, könnte zu dem Schluß führen, daß erstens die<br />
Beziehung von Begriff und Wirklichkeit eine rein konventionelle ist, und daß zweitens<br />
die Kategorienapparate der jeweiligen Kulturen radikal differieren. Im ersten<br />
Fall könnte es keine universellen Wahrheitskriterien geben (da keine allgemeingültigen<br />
Aussagen möglich wären), im zweiten Fall wäre keine interkulturelle Verständigung<br />
möglich (da jeglicher gemeinsame Bezugspunkt fehlt), und die Gesellschaften<br />
wären gefangen in ihren jeweiligen Sprachspielen. Nun ist aber die Gesellschaft »kein<br />
eigenständiger Bereich ...; sie ist Teil der Natur.« (Ibid.: 40) Man könnte auch sagen:<br />
eine Gesellschaft kann die natürlichen Gegebenheiten nicht ignorieren, sie ist<br />
nicht völlig frei in ihren Schöpfungen. Durkheim ist also durchaus Universalist 370 —<br />
und in gewisser Hinsicht auch Evolutionist. Für ihn weist die Zivilisation die Tendenz<br />
auf »rationaler und logischer zu werden.« (1902: 351) Dies liegt, wie er in der<br />
"Arbeitsteilung" ausführt, an den zunehmenden Abstraktionsleistungen der Menschen,<br />
die zur Bildung allgemeiner und universeller Begriffe führen, denn: »nur das<br />
ist rational, was universal ist.« (Ibid.)<br />
Das ist der Durkheim des 19. Jahrhunderts. Seine späteren Werke scheinen<br />
diese Auffassung zumindest zu relativieren, denn die Grundthese seiner Arbeiten zur<br />
<strong>Soziologie</strong> der Erkenntnis lautet, wie gerade gesehen, daß sich der Kategorienappa-<br />
369 Durkheim kann dergestalt die Erkenntnistheorie wie auch die Moralphilosophie (letzteres allerdings<br />
nicht explizit) aus dem Dilemma des in einem soziologischen bzw. epistemologischen "Atomismus"<br />
gefangenen Rationalismus bzw. Idealismus befreien, indem er zwischen individueller und kollektiver<br />
Erfahrung unterscheidet und die Gesellschaft als Transzendentalsubjekt, als erste Totalität bestimmt (vgl.<br />
insbes. 1912: 589f.). Fraglos hatten sowohl Platon als auch Kant mit der Annahme recht, daß unsere<br />
Erkenntnis– bzw. Urteilsfähigkeit niemals den Erfahrungen eines isolierten Individuums entspringen<br />
kann; Menschen sind aber niemals solche Wesen sondern immer eingebettet in das gesellschaftliche<br />
Leben als Quelle und Hort kollektiver Erfahrung.<br />
370 In seinen Vorlesungen über den Pragmatismus (1913/14) wendet er sich dezidiert gegen den von<br />
William James und anderen vertretenen "Irrationalismus" — jenem »Angriff auf die Vernunft« (Ibid.:<br />
11), der in der Behauptung gipfelt, wahr sei, was nützlich ist. Für Durkheim sind »Empirismus und<br />
Rationalismus letztlich nur zwei verschiedene Arten, die Vernunft zu bejahen« (Ibid.: 12), und<br />
wenngleich diese Denkweisen zu kritisieren sind, darf nicht die Vernunft selbst eliminiert werden.
Wirksamkeit und Wirklichkeit 219<br />
rat historisch wandelt. Einerseits bestreitet Durkheim nicht, daß so etwas wie eine<br />
"begriffliche Evolution" existiert: »Der Begriff, der ursprünglich <strong>für</strong> wahr gehalten<br />
wurde, weil er kollektiv ist, neigt dazu, nur unter der Bedingung kollektiv zu werden,<br />
daß er <strong>für</strong> wahr gehalten wird: Wir verlangen seine Richtigkeit, ehe wir ihm<br />
unser Vertrauen schenken.« (1912: 585) Die begriffliche Organisation differenziert<br />
sich und wird autonom, »das logische Denken wird ... immer unpersönlicher, während<br />
es sich universalisiert.« (Ibid.: 594) Diese Bewegung kann man durchaus als Rationalisierungsprozeß<br />
auffassen; der Wahrheitsgehalt der Begriffe wächst in gewisser<br />
Hinsicht. 371 Andererseits warnt Durkheim davor, eine zu scharfe Trennlinie zwischen<br />
"religiöser" (vormoderner) und "wissenschaftlicher" (moderner) Weltauffassung<br />
zu ziehen, denn erstens darf man nicht vergessen, »daß noch heute die meisten<br />
Begriffe, deren wir uns bedienen, nicht methodisch gebildet wurden; wir entnehmen<br />
sie der Sprache, d.h. der allgemeinen Erfahrung, ohne daß sie einer vorhergehenden<br />
Kritik unterworfen worden wären.« (Ibid.)<br />
Zweitens besteht offenbar nur ein gradueller Unterschied zwischen "wissenschaftlich"<br />
ausgearbeiteten Begriffen und jenen, »die ihre ganze Autorität daraus<br />
schöpfen, daß sie kollektiv sind... Eine kollektive Vorstellung bietet, weil sie kollektiv<br />
ist, schon Garantien der Objektivität. Denn sie hat sich nicht ohne Grund verallgemeinert<br />
und mit einer genügenden Beständigkeit erhalten können.« (Ibid.) 372 Die<br />
Art und Weise, wie bestimmte kausale Beziehungen konzipiert resp. erklärt werden,<br />
mag von Kultur zu Kultur differieren; die Tatsache, daß derartige Beziehungen existieren,<br />
kann aber nicht geleugnet werden — zumindest nicht an bestimmten vitalen<br />
Punkten. »Die Erklärungen der heutigen Wissenschaft sind zwar objektiver, weil sie<br />
methodischer sind und auf strengeren Beobachtungen beruhen, aber sie unterscheiden<br />
sich ihrer Natur nach nicht von den Erklärungen, die dem primitiven Denken<br />
genüge taten. Erklären heißt heute wie damals zeigen, wie eine Sache mit einer oder<br />
mehreren anderen zusammenhängt.« (Ibid.: 325)<br />
Durkheim hält also prinzipiell an der Auffassung von der überzeitlichen Gültigkeit<br />
bestimmter Wahrheitskriterien fest. »Weil die Ideen der Zeit, des Raumes,<br />
der Gattung, der Ursache, der Persönlichkeit aus sozialen Elementen aufgebaut sind,<br />
darf man nicht gleich schließen, daß sie keinen objektiven Wert hätten. Im Gegen-<br />
371 Für Habermas gestaltet sich diese Bewegung folgendermaßen: »Die Rationalisierung der Weltbilder<br />
drückt sich in einem Abstraktionsprozeß aus, der die mythischen Mächte zu transzendenten Göttern und<br />
schließlich zu Ideen und Begriffen sublimiert und, auf Kosten eines geschrumpften sakralen Bereichs,<br />
eine entgötterte Natur zurückläßt.« (1987, II: 127) Wolfram Stender merkt dazu an: »Der diskursiv<br />
erzielte Konsens einer Kommunikationsgemeinschaft ersetzt [<strong>für</strong> Habermas] in modernen Gesellschaften<br />
den religiösen Konsens der Glaubensgemeinschaft vormoderner Gesellschaften. Versprachlichung des<br />
Sakralen bedeutet also, Habermas zufolge, die evolutionäre Transformation der "ursprünglich" irrationalvorsprachlichen<br />
Form der Konsensbildung in eine kommunikativ-rationale Form der Konsensbildung.«<br />
(1995: 379) Diese Sichtweise ist wesentlich undifferenzierter als diejenige Durkheims, der gerade den<br />
graduellen Charakter jener Differenz hervorhebt.<br />
372 »Dem logischen Denken soziale Ursprünge beizumessen heißt nicht, es herabzuwürdigen, seinen<br />
Wert zu vermindern, es auf ein System künstlicher Verbindungen zu reduzieren. Es heißt im Gegenteil ,<br />
es auf eine Ursache zurückzuführen, die es auf natürliche Weise beinhaltet.« (Ibid.: 593)
220 Wirksamkeit und Wirklichkeit<br />
teil: ihr sozialer Ursprung läßt eher darauf schließen, daß sie in der Natur der Dinge<br />
begründet sind.« (Ibid.: 40f.) Diese universalistische Position hat schließlich auch<br />
Auswirkungen auf das Problem des Verstehens. Die "Sprachspiele" unserer und diejenigen<br />
der fremden und vergangenen Kulturen differieren nicht völlig. In gewisser<br />
Hinsicht ist der "soziologische Elementarismus" Durkheims Lösung des Relativismusproblems.<br />
Der Totemismus, jene vermeintlich einfachste und ursprünglichste<br />
Religion, konzipiert erstens Sachverhalte, die sich nicht grundsätzlich geändert<br />
haben. Zweitens ist er Teil unseres kulturellen Erbes: »Man geht fehl, wenn<br />
man glaubt, daß diese Geisteshaltung [die totemistische] keinen Bezug mit der unsrigen<br />
habe. Unsere Logik ist aus dieser Logik geboren worden.« (Ibid.: 325) Wir<br />
können diese Gesellschaften "verstehen", d.h. auch: gültige (wahre) Aussagen über<br />
sie treffen, weil sie unsere Geschichte repräsentieren und von dieser Welt sind.<br />
Die These vom sozialen Ursprung der Kategorien impliziert also nicht notwendig,<br />
daß die Annahmen der Aprioristen und der Empiristen vollkommen von der<br />
Hand zu weisen wären: Auch wenn die Kategorien, welche unser Erleben ordnen<br />
und strukturieren und somit Erkenntnis ermöglichen, nicht im Subjekt angelegt sind,<br />
muß dennoch eine (biologische) Potentialität im Menschen vorhanden sein als Bedingung<br />
der Möglichkeit von Erkenntnisfähigkeit. D.h., der Mensch ist prinzipiell in<br />
der Lage, Raum, Zeit und Kausalität zu erfahren, wenn sie entsprechend (gesellschaftlich)<br />
kategorisiert sind. Diese Befähigung ist universell und humanspezifisch,<br />
ebenso wie das Sprachvermögen. Ohne konkrete Eigenschaften der Welt, die es zu<br />
erkennen und zu ordnen gilt, wäre die Herausbildung eines Kategorienapparats aber<br />
unmöglich, von daher ist auch der empiristische Standpunkt durchaus begründet:<br />
Die Art und Weise, wie wir die Dinge betrachten, kann von Kultur zu Kultur nicht<br />
völlig differieren, weil es die gleiche physikalische Welt ist, in der wir leben. Für<br />
Durkheim haben also »die religiösen Glaubensansichten, wie fremdartig sie auch<br />
manchmal erscheinen mögen, ihre Wahrheit ..., die man entdecken muß.« (Ibid.<br />
325) 373<br />
Für Durkheim ist »das soziale Leben unter allen seinen Aspekten und zu allen<br />
Augenblicken seiner Geschichte nur dank eines umfangreichen Symbolismus möglich.«<br />
(Ibid.: 317) Dieser Symbolismus, diese »ganze Welt von Gefühlen, Ideen und<br />
373 Indem er den Wahrheitsbegriff auch auf die objektive, "äußere" Realität bezieht, wiederholt<br />
Durkheim allerdings den Kardinalfehler seiner Zeit, Wissenschaft und Religion zu vergleichen. Dabei<br />
zielen beide unter Umständen auf einen anderen Erklärungshorizont bzw. auf andere Arten von<br />
Handlungsorientierungen, und es sollte unbedingt zwischen Ethik, Kosmologie und Zwecktätigkeit<br />
unterschieden werden (wiewohl die Bereiche sich durchdringen und die Trennlinien in "primitiven<br />
Gesellschaften anders gezogen sind als in modernen Industriegesellschaften). Religion ist im Minimum<br />
eine Mischung aus Kosmologie und Ethik, eine spirituelle (und eben keine wissenschaftliche)<br />
Weltsicht, die jene Fragen beantwortet, die gerade nicht dem säkularen Horizont angehören (z.B.<br />
"warum existiert die Welt"). Durkheims wiederholter Rekurs auf die objektive Realität ist deshalb an<br />
zentralen Punkten seiner Argumentation durchaus fragwürdig — gerade auch im Kontext der "Elementaren<br />
Formen des religiösen Lebens". Durkheim evoziert dort beständig eine andere Art von Wirklichkeit,<br />
diejenige des Rituals, der kollektiven Vorstellungen, der Symbole und Bedeutungen, der<br />
Sprache.
Wirksamkeit und Wirklichkeit 221<br />
Bildern« gehorcht aber eigenen Gesetzen, das geistige Leben genießt »eine so große<br />
Unabhängigkeit, daß es sich manchmal ohne Ziel, ohne Nutzen offenbart, einfach aus<br />
Freude am Dasein.« (Ibid.: 567). 374 Mit anderen Worten: Kulturen sind aus sich<br />
heraus schöpferisch und keine reine Widerspiegelung der materialen Realität, sie erschaffen<br />
ihre eigene Welt. Diese gesellschaftlich erzeugte Wirklichkeit kann so wirkmächtig<br />
sein wie die äußere, "natürliche", und sie ist ebenso objektiv — aber eben<br />
nicht universell. Auch diese Einsicht ist in Durkheims Werk angelegt. Mag sein, daß<br />
seine Argumentation zum Teil widersprüchlich, sein empirisches Material unzuverlässig,<br />
seine Begriffe unzureichend sind — die Formes élémentaires de la vie religieuse<br />
markieren dennoch eine wissenschaftliche Revolution, sie sind nach wie vor eine tiefe<br />
Quelle der Inspiration, ein Heilmittel gegen jegliche Ausprägung eines allzu naiven<br />
Naturalismus, Idealismus oder auch Evolutionismus.<br />
Das alles hat tiefgreifende Konsequenzen <strong>für</strong> die Möglichkeit, kausale oder<br />
funktionale Erklärungen <strong>für</strong> kulturelle Muster bzw. <strong>Institut</strong>ionen in fremden Gesellschaften<br />
abzuliefern: "Relativität" ist nicht allein ein erkenntnistheoretisches Problem,<br />
sondern auch ein durchaus gegenständliches Phänomen. 375 Wenn die Natur die<br />
jeweilige gesellschaftliche Praxis (resp. Wirklichkeit) nicht determiniert, ist letztere<br />
zum Teil kontingent und selbstreferentiell, und wir können sie nicht unter Bezugnahme<br />
auf universelle Gegebenheiten erklären; die Möglichkeit, objektiv "wahre"<br />
Aussagen über Naturphänomene zu treffen, ist in dieser Hinsicht gänzlich irrelevant.<br />
376 Durkheims Bearbeitung des "Erkenntnisproblems" mag vielleicht <strong>für</strong> den<br />
Erkenntnistheoretiker unbefriedigend sein, <strong>für</strong> die <strong>Soziologie</strong> ist sie indessen immens<br />
fruchtbar, da sie das Relativismusproblem auf eine andere Ebene, nämlich diejenige<br />
der Gesellschaft und der Geschichte, verschiebt.<br />
WIE WIRKLICH IST DIE WELT?<br />
»Die Welt ist die Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge« schreibt Ludwig<br />
Wittgenstein zu Beginn des Tractatus logico-philosophicus. Ich will mich hier keinesfalls<br />
der Wittgensteinschen Philosophie widmen, dieser Satz verdient allerdings eine<br />
374 Die kognitive Ordnung, die diesem entspringt, ist auch eine affektive; <strong>für</strong> Durkheim und Mauss sind<br />
die Begriffe »das Werk von Gefühlen« (1903: 253), was <strong>für</strong> die Autoren auch die Unterschiede der<br />
jeweiligen begrifflichen (symbolischen) Ordnungen erklärt: »Weil die Dinge die Empfindungen der<br />
Gruppen in unterschiedlicher Weise affizieren, tragen sie in verschiedenen Gesellschaften unterschiedliche<br />
Züge.« (Ibid.: 254). Durkheim verweist hier m.E. auf die gefühlsmäßige Bedeutung, welche der<br />
klassifikatorischen Ordnung zukommen kann. Mary Douglas (1966) befaßt sich ausführlich mit diesem<br />
Thema.<br />
375 Durkheims Vorbehalt gegenüber dem "historischen Materialismus" (sprich: Marxismus) dürfte sich<br />
auf dessen Determinismus wie Reduktionismus beziehen: "Praxis" erschöpft sich nicht in Arbeit (d.h.<br />
tätiger Auseinandersetzung mit der Natur zum Zwecke der Aneignung und mit anderen Menschen), der<br />
Begriff umfaßt ein wesentlich weiteres Feld sollte auf die gesamte menschliche Existenz bezogen werden.<br />
376 Durkheims Auffassung, wonach Wirklichkeitsauffassungen als kollektive Vorstellungen die sozialen<br />
Beziehungen durchwalten, findet sich auch beim späten Wittgenstein (vgl. Lukes 1973: 473).
222 Wirksamkeit und Wirklichkeit<br />
kurze Reflexion. Denn was sind Tatsachen? Ganz offensichtlich keine "objektiven<br />
Dinge". Die Wirklichkeit des Stuhls, an dem ich mein Schienenbein stoße, weil ich<br />
mir seiner nicht bewußt bin, ist eine andere als diejenige des Stuhls, auf welchem ich<br />
sitze, von dem ich gerade spreche. 377 Dieses elementare Faktum, auf das sowohl<br />
Wissenssoziologie als auch analytische Philosophie reflektieren, mithin der je unterschiedliche<br />
Status von "Wirklichkeit", wird allzu oft von einem kruden "Objektivismus"<br />
ignoriert, welcher die universalistische Position fundieren soll. 378 Aber wir<br />
sprechen nicht über die Welt oder Dinge und Ereignisse an sich, sondern über die<br />
Vorstellungen, die wir von ihnen haben. Wirklichkeit und Welt als Konzepte haben<br />
keine Existenz außerhalb der Sprache; aber der Regen der fällt, der Baum vor meinem<br />
Fenster, das Blatt, das sich verfärbt und auch das fahle Licht des Mondes existieren<br />
unabhängig von mir — wie auch immer ich sie denke. Wenn ich sie denke, kann<br />
ich sie aber nicht isoliert denken, alle Konzepte von Lebewesen, Gegenständen und<br />
Ereignissen stehen notwendig in Beziehung zueinander, und diese Beziehung ist<br />
sprachlicher Natur, weil sie in der Regel innerhalb der Sprachgemeinschaft definiert<br />
und nicht unmittelbar einsichtig oder notwendig gegeben ist. 379<br />
Der Sachverhalt, auf den Winch rekurriert, ist also im Grunde ein denkbar<br />
einfacher: »Im Gegensatz zu den Tieren leben die Menschen nicht nur, sondern sie<br />
haben auch eine Vorstellung vom Leben. Diese ist nicht einfach etwas, das zu ihrem<br />
Leben hinzukommt; damit verändert sich vielmehr der Sinn des Wortes "Leben".«<br />
(1964: 114) Für Tiere existieren weder "empirische" noch "spirituelle" Qualitäten<br />
und Quantitäten, und auch keine Korrespondenz von gesellschaftlichen Beziehungen<br />
und Realitätsvorstellungen. Das ist wohl ebensowenig bestreitbar wie die Tatsache,<br />
daß wir die "Welt" (was immer das ist) denken müssen, um in ihr leben zu können.<br />
Und selbstverständlich ist auch "Natur" etwas, das erst über "Kultur" konstituiert<br />
wird: in kulturellen Termini, in Differenz zur Kultur... Damit ist der Krähenschwarm<br />
am Himmel aber ebensowenig Produkt meiner Imagination wie die Wolken,<br />
vor denen er dahinzieht: Daß ich ihn sehe, liegt daran, daß ich unter dem gleichen<br />
Himmel lebe, wie ich ihn sehe (und ob ich ihn überhaupt wahrnehme), hängt<br />
davon, wie ich mir diesen Himmel vorstelle. Mit dem Entstehen der Sprache verdoppelt<br />
sich folglich die Wirklichkeit: sie existiert außerhalb und unabhängig von<br />
uns, zugleich ist sie in uns und existiert nur durch uns, als Ergebnis einer kollektiven<br />
Ausarbeitung.<br />
377 Das Unverständnis wird vielleicht am besten illustriert durch die in Ray Monks ausgezeichneter<br />
Wittgenstein-Biographie wiedergegebene Auseinandersetzung zwischen Russell und Wittgenstein.<br />
Russell notierte 1911: Wittgenstein »meint, nichts Empirisches sei erkennbar — ich bedrängte ihn zuzugeben,<br />
daß kein Rhinozerus im Zimmer sei, aber er blieb stur.« (nach Monk 1990: 55)<br />
378 Auch die logische Kohärenz eines Glaubens– oder Regelsystems kann nach Winch kein Kriterium <strong>für</strong><br />
dessen Rationalität sein, denn es gibt einen Punkt, »an dem wir nicht mehr bestimmen können, was in<br />
einem solchen Regelkontext widerspruchsfrei ist und was nicht, ohne vorher die Frage zu erörtern,<br />
welchen Sinn das Befolgen solcher Regeln in jener Gesellschaft hat.« (Ibid.: 94)<br />
»Ohne Worte ist unsere Einbildungskraft nicht imstande, bestimmte Gegenstände und ihre Beziehungen<br />
festzuhalten, in diesem Fall heißt aus den Augen wirklich aus dem Sinn.« (Langer 1942: 129f.)
Wirksamkeit und Wirklichkeit 223<br />
Kennzeichen der Wissenschaft ist das Bestreben, einen möglichst hohen Grad der<br />
Übereinstimmung ihrer Theorien und Modelle mit der objektiven Realität zu erzielen.<br />
Will man beurteilen, inwieweit eine Aussage mit der Wirklichkeit übereinstimmt,<br />
ist es allerdings zwingend erforderlich, vorab zu klären, worauf sich die<br />
Aussage eigentlich bezieht (diese Frage wird sich in diesem Text an späterer Stelle<br />
mehrfach stellen). Zu diesem Zweck ist es notwendig, die Gegenstände des Erkenntnisinteresses<br />
hinreichend zu differenzieren. Die Trennlinie entspricht derjenigen<br />
zwischen "Natur" und "Kultur". Die uns umgebende "äußere" Natur ist<br />
durch die Universalität der Naturgesetze bestimmt, in der Sphäre der "Kultur" hingegen<br />
gelten partikulare Regeln. D.h., während die Naturgesetze (zuvorderst im Bereich<br />
der Physik und Chemie) unwandelbar sind und zu allen Orten und zu allen Zeiten<br />
gelten, unterscheiden sich die gesellschaftlichen Normen von Kultur zu Kultur.<br />
In der unbelebten Natur gibt es kein absichtsvolles Handeln; im Bereich der belebten<br />
Natur verhalten sich die individuellen Tiere und Pflanzen zwar auf Grundlage eines<br />
weitgehend genetisch determinierten Schematismus (eine Vielzahl der Verhaltensmuster<br />
höherer Tiere sind zudem erlernt und werden von Generation zu Generation<br />
weitergegeben), aber auch hier ist das zentrale Merkmal der Kultur abwesend: Bedeutung.<br />
Die Kultur ist nicht nur eine normative Ordnung, sie ist eine bedeutungsvolle<br />
normative Ordnung. Während hinsichtlich der Natur lediglich deskriptive Aussagen<br />
möglich sind, können gesellschaftliche <strong>Institut</strong>ionen und soziale Prozesse sowohl beschrieben<br />
als auch beurteilt werden. D.h., unsere Anschauungen, Praktiken, kulturellen<br />
Einrichtungen und Hervorbringungen sind kritisierbar, 380 sie können in Bezug<br />
auf jeweilige Ziele und Werte als gut oder schlecht (im Bereich der Moral) oder als<br />
schön oder häßlich (im Bereich der Ästhetik) gelten. Dabei stellt sich allerdings die<br />
Frage, wie ein objektiver und universell gültiger Standpunkt zu gewinnen ist, von<br />
dem aus das Werturteil objektiv getroffen werden kann. Mit dieser Frage befassen<br />
sich Moralphilosophie (was kann begründet als "gut" gelten) und ästhetische Theorie<br />
(was darf als "schön" gelten). Auch die moderne Wissenschaft als methodischer und<br />
normativer Korpus ist selbstverständlich kritisierbar. Hier allerdings ist es möglich,<br />
ein universelles Kriterium anzugeben, welches als Meßlatte hinsichtlich der Beurteilung<br />
von Aussagen und Vorgehensweisen dient; so lange wie es sich lediglich darum<br />
handelt, Strukturen und Vorgänge zu beschreiben und zu erklären. Der Maßstab sind<br />
die Dinge, d.h. die Naturphänomene selbst.<br />
Die vorstehenden Prämissen mögen aus erkenntnistheoretischer oder wissenssoziologischer<br />
Perspektive als allzu pauschal und undifferenziert erscheinen. Im Zweifelsfall<br />
ist selbstverständlich sehr genau zu prüfen, wo die Grenze zwischen Gegebenem<br />
380 Nach Émile Durkheim ist diese Bewertung integraler Bestandteil jeder vollständigen soziologischen<br />
Erklärung von <strong>Institut</strong>ionen, welche nach den "Regeln der soziologischen Methode" eine historische<br />
Entstehungs-, eine funktionale Bestands– sowie eine Beurteilungshypothese zur Einschätzung<br />
der normalen und "pathologischen" Wirkungen des untersuchten Sachverhalts beinhalten muß.
224 Wirksamkeit und Wirklichkeit<br />
und Konstruiertem verläuft. 381 Das bisher Gesagte soll aber dennoch <strong>für</strong> die hier<br />
geführte Diskussion hinreichend sein, da es mir nicht um die Validität naturwissenschaftlicher<br />
Aussagen, sondern lediglich um das "Reich der Bedeutung", um die<br />
Weltauffassungen unterschiedlicher Kulturen geht.<br />
NATUR KULTUR<br />
Universelle Gesetze<br />
"das Gegebene"<br />
Abbildung 8: Natur und Kultur<br />
Partikulare Regeln<br />
"das von Menschen Geschaffene"<br />
Normativität<br />
Intentionalität<br />
Bedeutung<br />
Ein großes Problem der Debatte über die Rationalität magischer Handlungen und<br />
Vorstellungen ist, daß die gerade skizzierte Differenz, d.h. diejenige zwischen (intersubjektiver)<br />
"Wirklichkeitsauffassung" und (objektiver) Wirklichkeit sowie der<br />
außerordentlich vielschichtige Status unserer Erfahrungen und Vorstellungen nicht<br />
hinreichend thematisiert wird. Das mag daran liegen, daß magische Akte ein so ausgesprochen<br />
hybrides Wesen haben: sie beziehen offenbar stets "Natur" und "Kultur/Gesellschaft"<br />
aufeinander. Ihnen liegen bestimmte kollektive Vorstellungen zugrunde,<br />
und sie selbst sind als <strong>Institut</strong>ionen, also mithin soziale Tatsachen, wiederum<br />
Teil dieser kollektiven Vorstellungswelt (das ist allerdings Durkheims Terminologie<br />
und nicht diejenige Winchs). Winch schreibt: »In meiner bisherigen Erörterung der<br />
magischen Riten der Zande habe ich ... diese Riten als Ausdruck einer bestimmten<br />
Auffassung vom Sinn des menschlichen Lebens zu verstehen gesucht.« (Winch 1964:<br />
110) Deshalb sind die "Sprachspiele", auf die Winch rekurriert, keine Brettspiele: 382<br />
»Sprachspiele werden von Menschen gespielt, die ein Leben zu leben haben — ein Leben das<br />
eine große Vielfalt unterschiedlicher Interessen einschließt, die sich auf alle möglichen Arten<br />
gegenseitig beeinflussen. Deshalb wird das, was ein Mensch sagt oder tut, wahrscheinlich nicht<br />
nur <strong>für</strong> den Vollzug seiner jeweiligen Tätigkeit von Bedeutung sein, sondern auch <strong>für</strong> sein Leben<br />
und <strong>für</strong> das anderer Menschen. Ob ein Mensch in dem, was er tut, einen Sinn sieht, wird deshalb<br />
davon abhängen, ob er in seinen vielfältigen Tätigkeiten, Interessen und Beziehungen zu<br />
anderen Menschen irgendeine Einheit zu erkennen vermag. Welche Art von Sinn er in seinem<br />
Leben sieht, wird vom Wesen dieser Einheit abhängen. Das Vermögen, einen solchen Sinn im<br />
Leben zu erkennen, hängt nicht allein von dem betreffenden Individuum ab — was nicht hei-<br />
381 Vgl. diesbezüglich z.B. Ian Hackings anregende und instruktive Kritik des Sozialkonstruktivismus<br />
(1999). Einen sehr guten Überblick über die derzeitige wissenschaftstheoretische Debatte bietet<br />
Bernd Schofer (1999, 2000).<br />
382 Der Begriff "Sprachspiel" wurde von Ludwig Wittgenstein geprägt. Er bezieht sich auf den Verwendungszusammenhang<br />
eines Wortes, durch den dessen Bedeutung bestimmt wird. Diese ergibt sich ähnlich<br />
dem Spiel aus einer mehr oder weniger bestimmten Menge von Verwendungsregeln. In einem<br />
erweiterten Sinne bezeichnet der Begriff bei Wittgenstein auch die sog. "Lebensform", den Zusammenhang<br />
zwischen Bedeutungsregeln und der gesellschaftlichen Praxis, deren Bestandteil sie sind.
Wirksamkeit und Wirklichkeit 225<br />
ßen soll, daß es davon überhaupt nicht abhängt —, sondern auch von den Möglichkeiten, welche<br />
die Kultur, in der er lebt, <strong>für</strong> die Herstellung eines solchen Sinns zur Verfügung stellt. Was<br />
wir aus der Erforschung anderer Kulturen lernen können, sind nicht nur andere Handlungsmöglichkeiten<br />
und andere Techniken. Wichtiger ist vielmehr, daß wir andere Möglichkeiten<br />
kennenlernen können, dem menschlichen Leben einen Sinn zu geben, andere Vorstellungen<br />
über die mögliche Bedeutung, welche die Ausführung bestimmter Tätigkeiten <strong>für</strong> Menschen<br />
annehmen kann, die den Sinn ihres Lebens als Ganzheit zu fassen versuchen.« (Ibid.: 111)<br />
Ihre Wirklichkeitsauffassung ist <strong>für</strong> jedes Verstehen »des Sinns einer Lebensform«<br />
unentbehrlich (Ibid.: 94). — Damit ist Winchs Position nicht so weit von derjenigen<br />
Hortons oder Beatties entfernt, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Winch<br />
stellt allerdings die Möglichkeit, "symbolisches" von "instrumentellem" Handeln zu<br />
trennen, grundlegend in Frage: »Die Früchte und andere Dinge, die ein Zande erntet<br />
oder erbeutet, sind ... nicht nur mögliche Konsumgegenstände: des Leben, das er<br />
lebt, seine Beziehungen zu seinen Mitmenschen, seine Möglichkeiten, gut oder<br />
schlecht zu handeln — all das kann von seinen Beziehungen zu dem, was er erntet<br />
oder erbeutet, geprägt sein.« (Ibid.)<br />
Der Sinn ist nichts, was der "empirischen" Realität sozusagen aufgepfropft<br />
wird, er ist immer schon in sie eingewoben. 383 Allein aus diesem Grund kann <strong>für</strong><br />
Winch keine einheitliche überzeitliche "unabhängige Realität" existieren, auf deren<br />
Grundlage wir die Verständigung mit dem Anderen herbeiführen könnten. 384 Die<br />
Phasen des Mondes sind ebensowenig eine Illusion wie die Schwerkraft oder die<br />
Zweigeschlechtlichkeit der Gattung Mensch. Kein Angehöriger einer mir bekannten<br />
Kultur würde leugnen, daß der Sack Reis gerade umgefallen ist, oder daß es zur Zeit<br />
regnet. Die Welt ist voll von "objektiven" Tatsachen und eindeutig verifizierbaren<br />
kausalen Beziehungen. Aber darum geht es nicht. Wie Hegel zu Heine sagte »Die<br />
383 Insofern ähnelt Winchs Position der strukturalistischen. »Für den Strukturalismus ist die Bedeutung<br />
die wesentliche Eigenschaft des kulturellen Gegenstands, so wie das Symbolisieren die besondere<br />
Fähigkeit des Menschen ist. Die wirklichen und materiellen Kräfte werden selbstverständlich nicht von<br />
der Bedeutung hervorgebracht; in dem Maß jedoch, in dem sie vom Menschen in Anspruch genommen<br />
werden, umfaßt die Bedeutung sie und regelt ihren kulturellen Einfluß. Die Kräfte sind auch nicht ohne<br />
reale Wirkung; nur ist es so, daß sie unabhängig von ihrer Integration in ein gegebenes historisches und<br />
soziales Schema keine besondere Wirkung und auch keine wirksame kulturelle Existenz haben. Die<br />
Veränderung setzt mit der Kultur ein, nicht die Kultur mit der Veränderung.« (Sahlins 1976: 41)<br />
384 Das Verstehen kann nach Winch nur erfolgen über einige grundlegende, bei allen Völkern zu allen<br />
Zeiten vorhandene Vorstellungen, die untrennbar an invariable, die menschliche Existenz beschränkende<br />
Realitäten gekoppelt sind. Winch schränkt in einer berühmten Passage den bei ihm anklingenden Relativismus<br />
ein: »Ich möchte hervorheben, daß der Begriff des menschlichen Lebens gewisse grundlegende<br />
Vorstellungen einschließt — ich werde sie "Limitationsvorstellungen" nennen –, die eine eindeutig<br />
ethische Dimension haben und die in der Tat in bestimmter Weise den "ethischen Raum" festlegen, in<br />
dem die Möglichkeiten von Gut und Böse im menschlichen Leben realisiert werden können. Diese Vorstellungen<br />
... entsprechen genau jenen, die Vico zur Grundlage seiner Idee des Naturrechts gemacht hat<br />
und auf denen ihm zufolge die Möglichkeit beruht, die menschliche Geschichte zu verstehen: nämlich<br />
Geburt, Tod und Sexualität. Ihre Bedeutung liegt darin, daß sie unabdingbar in das Leben aller<br />
bekannten menschlichen Gesellschaften verwoben sind, und zwar in einer Weise, die uns einen Anhaltspunkt<br />
da<strong>für</strong> gibt, in welcher Richtung wir zu suchen haben, wenn wir über den Sinn eines fremdem<br />
<strong>Institut</strong>ionensystems im Zweifel sind.« (Ibid.: 113) Ich würde allerdings den Begriff limiting notions durch<br />
limiting facts ersetzen. Die natürlichen Gegebenheiten sind tatsächlich <strong>für</strong> alle Gesellschaften,<br />
unhintergehbare Limitationen. Diese determinieren den kulturellen Prozeß aber nicht.
226 Wirksamkeit und Wirklichkeit<br />
Sterne sind's nicht, aber was der Mensch in sie hineinlegt, das eben ist's«. "Natur" ist<br />
niemals allein das vorgefundene, sie ist immer verdoppelt, kulturell neu erschaffen<br />
(um in ihr leben zu können), in vielen Gesellschaften zudem vom Menschen tiefgreifend<br />
beeinflußt. 385 In gewichtiger Hinsicht ist "Natur" tatsächlich ganz und gar ein<br />
gesellschaftliches Konstrukt, wir sprechen niemals von den Dingen an sich, sondern<br />
von den Vorstellungen, die wir von ihnen haben.<br />
Diese kollektiven Vorstellungen sind nicht allein Gedankengebilde, sondern verschaffen<br />
sich als Basis von Handlungsimperativen wiederum materiale Geltung. "Objektive"<br />
Erkenntnis ist ebenso neutral wie bedeutungslos, wenn sie nicht in den gesellschaftlichen<br />
Diskurs eingeht bzw. auf diesen bezogen ist. Sobald wir unsere Erfahrung<br />
aber thematisieren, ist sie Teil des Sinnzusammenhangs unserer Kultur, ein<br />
Kontext, zu dem nicht allein Deutungen, sondern auch Intentionen zählen. Jedes<br />
Wissen ist intentional, interessegebunden. Es gibt zwar einerseits keinen Grund, warum<br />
sich die Naturwissenschaft nicht mit der "objektiven" Natur, die unzweifelhaft<br />
existiert, befassen und Aussagen über diese treffen sollte. Die Sozialwissenschaften<br />
müssen allerdings andererseits die Intentionen und Motive der Forschung, der ihnen<br />
zugrundeliegenden bzw. aus ihnen resultierenden Weltauffassungen kritisch hinterfragen.<br />
Auch die moderne Naturwissenschaft ist ein gesellschaftliches Unterfangen<br />
und mündet allzu oft in einen normativen Diskurs. Nicht zuletzt darum geht es im<br />
vorliegenden Text. Während die Natur überzeitlich und universell gültigen Gesetzen<br />
gehorcht, die wir durchaus zu erfassen, aber nicht zu verändern vermögen, unterscheiden<br />
sich die Regeln, denen unser Leben folgt, von Gesellschaft zu Gesellschaft;<br />
ebenso wie Bedeutungszusammenhänge und Intentionen. 386<br />
MAGIE UND WISSENSCHAFT REVISITED<br />
Was ist überhaupt Wissenschaft? Eine Methode, eine Geisteshaltung, eine Weltauffassung?<br />
Kann man überhaupt von "der Wissenschaft" sprechen? Unser Verständnis<br />
von Wissenschaft bezieht sich auch auf eine spezifische historische Situation, die neuzeitliche<br />
"Entmystifizierung" war ein gesellschaftliches (politisches, emanzipatives)<br />
Projekt. Als pragmatisches Handeln das gesellschaftlichen Imperativen folgt unterscheidet<br />
sich unsere wissenschaftlich-technische Praxis in gewissen zentralen Aspekten<br />
aber nicht substantiell von derjenigen anderer Kulturen. Immer dann, wenn sie<br />
mit neuen Herausforderungen konfrontiert wurden, waren die Menschen zu enor-<br />
385 So waren die leuchtendgrünen Wiesen des Yosemite-Nationalpark, »die ihre ersten Bewunderer an<br />
ein urtümliches Eden gemahnten, ... in Wirklichkeit das Ergebnis regelmäßiger Brandrodungen durch<br />
die Ahwahneechee-Indianer« (Schama 1995: 18).<br />
386 Hierauf scheint mir auch Winch abzuzielen, wenn er schreibt: »Rational erscheinen kann jemandem<br />
etwas nur im Sinn seines Verständnisses davon, was rational ist und was nicht. Unterscheidet sich unser<br />
Rationalitätsbegriff von seinem, dann ist es sinnlos zu sagen, etwas erscheine ihm in unserem Sinn rational<br />
oder nicht.« (1964: 99)
Wirksamkeit und Wirklichkeit 227<br />
men technischen Leistungen imstande. Diese konnten sie wohl kaum vollbringen,<br />
ohne zuvor experimentiert, ohne Annahmen formuliert und verifiziert zu haben.<br />
Dies gilt <strong>für</strong> die Domestikation von Tieren und Pflanzen ebenso wie <strong>für</strong> die Anlage<br />
komplexer Bewässerungssysteme, die Metallurgie, den Bau von Pyramiden und<br />
Schiffen. Die "wissenschaftliche" Haltung war den Menschen (besser: einigen Menschen)<br />
wohl niemals fremd. Malinowski hatte in mindestens einem Punkt recht: keine<br />
Gesellschaft kann existieren ohne einen Bestand an verläßlichem und überprüfbarem<br />
empirischen Wissen. "Wissenschaftliches", d.h. methodisches Denken und<br />
Handeln auf Grundlage konkreter empirischer Erfahrung hat die menschliche Praxis<br />
seit jeher bestimmt. Schon die Bearbeitung eines Steins mit dem Zweck, eine Speerspitze<br />
herzustellen, bedarf erstens einer Abstraktion von den konkreten Eigenschaften<br />
des jeweiligen Steins, zweitens einer Vorstellung vom Endprodukt und drittens<br />
einer ausgefeilten Technik der Steinbearbeitung. Gleiches gilt <strong>für</strong> alle anderen<br />
Bereiche der archaischen Praxis, nicht zuletzt den Bereich der Landwirtschaft und<br />
Viehzucht, jene großen Errungenschaften der "neolithischen Revolution". So<br />
schreibt François Jacob:<br />
»Wenige Phänomene der belebten Natur sind so unmittelbar einsichtig wie die Hervorbringung<br />
von Gleichem durch Gleiches. Ein Kind wird bald erkennen, daß ein Hund von einen<br />
Hund geboren wird und daß Getreide aus Getreide entsteht. Die Menschheit hat früh gelernt,<br />
die Permanenz der Gestalt über sukzessive Generationen zu interpretieren und zu nutzen. Die<br />
Kultivierung von Pflanzen, die Zucht von Tieren, ihre Veredelung und Domestizierung erfordern<br />
lange Erfahrung. Dies impliziert bereits eine gewisse Vorstellung der Gesetze der Vererbung<br />
und ihrer Nutzbarmachung. Um eine gute Ernte zu erzielen, genügt es nicht, auf den<br />
Vollmond zu warten und den Göttern vor der Aussaat Opfer darzubringen, es ist auch notwendig<br />
zu wissen, wie das richtige Saatgut ausgewählt wird.« (1970: 1)<br />
Der "wissenschaftliche Prozeß" wird üblicherweise als Phasenabfolge charakterisiert;<br />
er beginnt (erstens) mit der systematischen Beobachtung resp. experimentellen Untersuchung<br />
eines (identifizierten) Phänomens, das anschließend (zweitens) erklärt<br />
(resp. "verstanden") wird, was wiederum (drittens) Vorhersage und (viertens) Beeinflussung<br />
ermöglicht — aber unsere Kultur ist kaum die erste, die so verfährt.<br />
Wie Lévi-Strauss bemerkt, setzt jede der im Neolithikum entwickelten Techniken<br />
(Töpferei, Weberei, Landwirtschaft und Viehzucht)<br />
»Jahrhunderte aktiver und methodischer Beobachtungen voraus, kühne und kontrollierte Hypothesen,<br />
die entweder verworfen oder mittels unermüdlich wiederholter Experimente verifiziert<br />
werden. [...] Für all dies bedurfte es zweifellos einer wirklich wissenschaftlichen Geisteshaltung,<br />
einer unentwegten und stets wachen Neugier, eines Hungers nach Erkenntnis aus<br />
Freude an der Erkenntnis, denn nur ein kleiner Bruchteil der Beobachtungen und Experimente<br />
(bei denen man voraussetzen muß, daß sie zunächst und vor allem durch die Freude am Wissen<br />
inspiriert waren) konnten zu praktischen und unmittelbar verwendbaren Ergebnissen führen.«<br />
(1962b: 26f.) 387<br />
387 Der »Drang nach objektiver Kenntnis« ist, wie Lévi-Strauss in "Das Wilde Denken" schreibt, »einer<br />
der am meisten vernachlässigten Aspekte des Denkens derer, die wir "Primitive" nennen. Wenn er sich<br />
auch selten auf Wirklichkeiten jener Bereiche richtet, mit denen sich die moderne Wissenschaft befaßt,
228 Wirksamkeit und Wirklichkeit<br />
Ich muß in diesem Zusammenhang kurz auf das irrige Vorurteil eingehen, die "Naturvölker"<br />
seien der konkreten Anschauung, der sinnlichen Qualität der Natur verhaftet<br />
und des abstrakten Denkens unfähig, da es sich hartnäckig hält. »In Wahrheit<br />
wechselt der begriffliche Zuschnitt mit jeder Sprache, und der Gebrauch mehr oder<br />
weniger abstrakter Ausdrücke hängt ... nicht von intellektuellen Fähigkeiten ab,<br />
sondern von den Interessen, die von jeder besonderen Gruppe innerhalb einer Gesellschaft<br />
unterschiedlich bezeichnet und spezifiziert werden.« (Lévi-Strauss 1962b:<br />
12) Die Dichotomisierung von "Konkret" und "Abstrakt" tut sowohl uns als auch<br />
ihnen unrecht. Die Opposition verweist lediglich auf die Art und Weise, wie die jeweilige<br />
Gesellschaft/Sprache klassifiziert. Mag sein, daß diese oder jene Eingeborenensprache<br />
zwar über tausend einzelne Gattungsbegriffe <strong>für</strong> unterschiedliche Arten<br />
von Bäumen verfügt, aber kein "abstraktes" Wort <strong>für</strong> Baum. 388<br />
Ein solches Beispiel sagt nichts über das Denken der "Wilden" aus, aber viel über ihre<br />
Umwelt — wozu brauche ich den Oberbegriff "Baum", wenn ich tagtäglich von<br />
nichts anderem umgeben bin? Was ich benötige, ist die Differenzierung. Jeder Begriff<br />
ist eine Abstraktion und tut in gewisser Hinsicht z.B. jenem Baum, der gerade<br />
als "Sequoiadendron giganteum" bezeichnet wird, "unrecht", da er seine Besonderheit,<br />
Einzigartigkeit nicht berücksichtigt. Allein der Stammesname (der allzu oft<br />
"Mensch" bedeutet) wie auch die Bezeichnungen <strong>für</strong> die Segmente (Hälften, Clans,<br />
Lineages) sind abstrakte Verallgemeinerungen. Das "wilde Denken" ist also weder<br />
abstrakter noch konkreter als unseres, die Ebenen der Abstraktion und Konkretion<br />
sind allerdings andere. 389 Zudem ist das gesamte magische Denken von abstrakten<br />
Kategorien (Kontiguität und Similarität) beherrscht (die allerdings nicht explizit thematisiert<br />
werden). Für Lévi-Strauss folgt daraus:<br />
»Anstatt ... Magie und Wissenschaft als Gegensätze zu behandeln, wäre es besser, sie parallel<br />
zu setzen, als zwei Arten der Erkenntnis, die zwar hinsichtlich ihrer theoretischen und praktischen<br />
Ergebnisse ungleich sind ..., nicht aber bezüglich der Art der geistigen Prozesse, die die<br />
Voraussetzung beider sind und sich weniger der Natur nach unterscheiden als aufgrund der Erscheinungstypen,<br />
auf die sie sich beziehen.« (1962b: 25) 390<br />
schließt er doch vergleichbare intellektuelle Verfahren und Methoden der Beobachtung ein. In beiden<br />
Fällen ist das Universum mindesten ebensosehr Gegenstand des Denkens wie Mittel zur Befriedigung<br />
von Bedürfnissen.« (1962b: 13)<br />
388 Das Beispiel der Eskimo, die über dutzende "konkreter" Begriffe <strong>für</strong> Schnee verfügen, ist legendär.<br />
389 Der Idee der sprachlichen Evolution, d.h. der Vorstellung, daß historisch eine immer bessere<br />
Übereinstimmung von Begriff und Realität zu verorten wäre, liegt nicht nur ein naiver "Realismus"<br />
zugrunde, sondern auch ein systematisch verzerrtes Verständnis von Geschichte.<br />
390 Weiterhin ist zu konstatieren, daß das "magische" Denken allzu oft gar nicht die Funktion hat,<br />
Naturvorgänge in der Art einer Wissenschaft zu erklären. Häufig soll es den Wechselfällen des Schicksals<br />
Sinn verleihen — als sei der Tod eines Menschen leichter zu ertragen wenn man jemanden da<strong>für</strong> verantwortlich<br />
machen kann: Es ist gerade dieser vordergründig "neurotische" oder "paranoide" Zug<br />
("Beziehungswahn"), der seine hervorstechendste Eigenart ist. Weder bei den Zande noch den Trobriandern<br />
stirbt ein Mensch aufgrund "natürlicher" Verursachung, immer ist Hexerei im Spiel. So verfolgt<br />
das "traditionale" Denken u.U. ganz andere explanative Ziele als das "wissenschaftliche".
Wirksamkeit und Wirklichkeit 229<br />
Die Fähigkeit zur Abstraktion ist kein distinktes Merkmal moderner Wissenschaft,<br />
die "Wilden" sind ebenso wie die Angehörigen der frühen Hochkulturen durchaus<br />
auch zur Modellbildung fähig — allerdings ist dieser Bereich bei ihnen nicht ausgearbeitet,<br />
sie verfahren eher "unbewußt" und verfügen über keinen diesbezüglichen<br />
Metadiskurs. Aber das heißt wie gesagt nicht, daß sie über keine Methoden verfügen<br />
und ihre Experimente nicht überprüfen. Es besteht auch auf dieser Ebene keine absolute<br />
Differenz zwischen "traditionalem" und "wissenschaftlichem Denken". Besser<br />
als undifferenziert von "Denken" [thought] sollte man aber von einem Korpus von<br />
"Anschauungen" [beliefs] sprechen, der mit bestimmten "Einstellungen" korrespondiert<br />
und durchaus auch präskriptiver Natur ist. So entspricht die prinzipiell kritische<br />
Einstellung des Wissenschaftlers seinen Theorien gegenüber der utilitaristischen<br />
Ausrichtung seiner Kultur, und der dieser Einstellung zugrunde liegende Imperativ<br />
der Eigendynamik seiner Gesellschaft. In den modernen Wissenschaften ist das<br />
Wahrheitskriterium letztlich dasjenige instrumenteller Effizienz. 391<br />
Die "traditionale" Kultur erscheint uns nicht zuletzt deshalb "geschlossen", weil ihr<br />
die expansive Dynamik unserer Gesellschaft fremd ist. Aus Sicht der Eingeborenen<br />
ist ihre Welt perfekt, ihr "theoretischer Korpus", der seine Bestimmung und Rechtfertigung<br />
in sich selbst findet, ruht — und muß ruhen. 392 Auch wenn diese Gesellschaften<br />
eine lange und bewegte Geschichte haben, wird diese Geschichte ignoriert,<br />
in bestimmten Reinigungs– und Erneuerungsritualen sogar geleugnet. Und da<br />
ihr praktisches Wissen aus ihrer Perspektive nicht zu verbessern ist, haben sie auch<br />
keinen theoretischen Korpus entwickelt, keine Metatheorie, keine Epistemologie,<br />
keine Verfahrensvorschrift, die derjenigen der Wissenschaft entspräche. In den<br />
fremden und vergangenen Kulturen ist ein institutionalisierter Wissenschaftsbetrieb<br />
weitgehend abwesend. 393 Keine Fachpublikationen, keine wissenschaftlichen Gesellschaften,<br />
keine Vorstellung eines organisierten und systematisierten kumulativen<br />
Wissenserwerbs. Das ist tatsächlich eine bedeutende Differenz. Aber man sollte sie<br />
391 Technische Erfindungen wurden allerdings in der frühen Neuzeit nur selten auf Grundlage wissenschaftlicher<br />
Erkenntnisse gemacht — bis in unser Jahrhundert hinein war dies die Ausnahme. Der<br />
Techniker war ein pragmatischer Tüftler, an der Umsetzung seiner Erfindung und letztlich am Geld<br />
interessiert. Was beide, Technik und Wissenschaft, verbindet, ist ein gemeinsamer Geist, eine "revolutionäre"<br />
Einstellung: das Bessere ist stets Feind des Guten.<br />
392 »Die Gesellschaften, die wir "primitiv" nennen, sind es in gar keiner Weise, möchten es jedoch sein;<br />
sie träumen davon primitiv zu sein, denn ihr Ideal wäre es, in dem Zustand zu verharren, in den die<br />
Götter oder die Ahnen sie zu Anbeginn der Zeiten geschaffen haben. Wohlgemerkt, sie betrügen sich<br />
selbst und entrinnen der Geschichte genauso wenig wie die anderen. Doch diese Geschichte, der sie<br />
mißtrauen, die sie nicht gutheißen, lassen sie über sich ergehen, während die heißen Gesellschaften —<br />
zum Beispiel die unsere — auf die Geschichte mit einer radikal anderen Einstellung antworten.« (Lévi-<br />
Strauss 1988: 181; "primitiv" meint hier "ursprünglich")<br />
393 Man muß allerdings fragen, ob dies uneingeschränkt auch (um nur ein Beispiel willkürlich<br />
herauszugreifen) <strong>für</strong> die Baumeister des Pharao Snofu (bzw. Snefru, ca. 2.600 v.u.Z.) galt, die innerhalb<br />
weniger Jahre im Rahmen einer wohlorganisierten Anstrengung die Grundlagen des Pyramidenbaus<br />
erarbeiteten. (Vgl. Edwards 1961. Eine gute neuere Darstellung liefern Davies/ Friedman 1998, Kap.<br />
2.) Interessanterweise ging dieses Wissen in späteren Jahren verloren.
230 Wirksamkeit und Wirklichkeit<br />
nicht überbewerten. Was uns von den anderen Kulturen unterscheidet, ist die Tatsache,<br />
daß wir über einen umfangreichen institutionalisierten Wissenschaftsbetrieb<br />
verfügen und eine ausgeprägte Vorstellung vom wissenschaftlichen Fortschritt haben.<br />
"Wissenschaft" ist auch ein sehr spezifisches gesellschaftliches Projekt, dem vor<br />
allem der institutionalisierte Wille zur Verbesserung der Erkenntnis und der technischen<br />
Möglichkeiten zugrunde liegt. Sie ist nicht durch ein besonders Vermögen gekennzeichnet,<br />
sondern durch ein sehr spezielles Interesse. 394 Ich vermag die "Primitiven"<br />
schwerlich der Dummheit oder Ignoranz zeihen, nur weil sie unsere Interessen<br />
nicht teilen und auf anderen Gebieten nach Vervollkommnung suchten. Denn<br />
hier liegt letztlich die Wurzel aller Inkommensurabilität 395 — nicht nur Wissenschaft<br />
und Magie sind hinsichtlich ihrer Ausrichtung nicht vergleichbar, dies gilt unter<br />
Umständen auch <strong>für</strong> "primitive" und moderne Technologie. 396 Letztere ist ein<br />
Projekt unserer Gesellschaft, ebenso wie "Magie" (um die pauschale Gegenüberstellung<br />
erneut aufzunehmen) ein Projekt der "primitiven" Kultur ist. Ein allerdings jeweils<br />
höchst heterogenes Projekt! Man sollte, anstelle von einem hochabstrakten<br />
Konstrukt von "Wissenschaftlichkeit" auszugehen (was die meisten der diesbezüglichen<br />
Arbeiten unglücklicherweise tun), besser die jeweils konkrete Bedeutung des<br />
Begriffs und der mit ihm korrespondierenden Praxis untersuchen. 397 "Wissenschaftlich"<br />
ist zudem kein Attribut, welches geeignet ist, unsere Weltauffassung in<br />
toto zu charakterisieren, die Existenz eines hocheffizienten wissenschaftlichtechnologischen<br />
Komplexes ist durchaus mit einem zutiefst irrationalen und gewalttätigen<br />
ethnischen oder religiösen Fundamentalismus kompatibel. 398<br />
Wie auf den vorigen Seiten deutlich geworden sein sollte, kann ein primär auf epistemologische<br />
Fragen zielender Diskurs die Spezifika des Gegenstand "Magie" und die<br />
Differenz zwischen unterschiedlichen Weltauffassungen nur sehr unzureichend er-<br />
394<br />
Der Naturwissenschaftler sucht nicht länger über ein teleologisches und einfühlendes Verstehen der<br />
Natur seinen Weg zu Gott. Die Natur ist nicht mehr das, was sie noch <strong>für</strong> Brahe, Galilei und Kepler<br />
war: Träger einer göttlichen Botschaft, die es zu deuten galt. Die moderne Naturwissenschaft kann keine<br />
Fragen nach Sinn oder Bedeutung mehr beantworten; sie erklärt die Naturvorgänge, indem sie die<br />
einzelnen Phänomene auf eine endliche Anzahl bekannter und unveränderlicher Gesetze zurückführt.<br />
395<br />
Das Konzept der Inkommensurabilität geht auf Kuhn ("Kein gemeinsames Maß") und Feyerabend<br />
zurück.<br />
396<br />
Vgl. hierzu Ian Hackings Aufsatz Language, Truth and Reason. Demnach kann der Wahrheitsgehalt von<br />
Aussagen zwar von den Daten abhängen; der Umstand aber, daß diese Aussagen in Betracht gezogen<br />
werden, ist das Ergebnis eines historischen Ereignisses (1982: 56).<br />
397<br />
Marcel Mauss paraphrasierend könnte man <strong>für</strong> den Bereich der Wissenschaftssoziologie behaupten:<br />
Das Gegebene ist die jeweils konkrete wissenschaftliche Praxis, die ihr zugrunde liegenden Imperative<br />
und Intentionen; Paradigmen und "Denkstile", nicht aber die Wissenschaft als solche. »Nachdem die<br />
Soziologen gezwungenermaßen etwas zuviel analysiert und abstrahiert haben, sollten sie sich nun<br />
bemühen, das Ganze wieder zusammenzusetzen.« (Mauss 1925: 178) Die Wissenschaftssoziologie ist<br />
m.E. immer dort besonders stark, wo sie an der konkreten Fallstudie festhält anstatt zu vorschnellen<br />
Generalisierungen und Abstraktionen zu gelangen.<br />
398<br />
Nationalsozialisten erzielten ebenso wie Stalinisten große wissenschaftlich/technische Leistungen,<br />
und der christliche Fundamentalismus dürfte kaum das Ende der Wissenschaft in toto markieren.
Wirksamkeit und Wirklichkeit 231<br />
hellen. Hier gilt ebenfalls das, was ich weiter oben bereits bei der Diskussion des<br />
Gabentauschs hervorhob: eine formale Analyse hat dort ihre Grenzen, wo die Unterschiede<br />
"inhaltlicher" Natur sind. Diese inhaltlichen Komponenten betreffen wiederum<br />
die von den Akteuren verfolgten Ziele. Um den intentionalen Aspekt des Relativismusproblems<br />
in aller Deutlichkeit hervorzuheben, werde ich im folgenden Kapitel<br />
zunächst seine ethisch-moralischen Facetten darstellen.
10. Kapitel<br />
DIE SITTEN FREMDER VÖLKER<br />
»Wenn man die Menschen erforschen will, muß man sich in seiner<br />
eigenen Umgebung umsehen; will man jedoch den Menschen<br />
erforschen, so muß man lernen, seinen Blick in die Ferne zu lenken,<br />
muß man zuerst die Unterschiede beobachten, um die allgemeinen<br />
Eigenschaften zu entdecken.« (Jean-Jacques Rousseau)<br />
Mag sein, daß alle Menschen zu allen Zeiten glaubten, ihre Art und Weise Natur,<br />
Gesellschaft und Geschichte zu denken sei die einzig richtige, aber erst in der Neuzeit<br />
wurde der Ethnozentrismus zu einem globalen (theoretischen wie praktischen)<br />
Problem in Gestalt des Kolonialismus und des okzidentalen Anspruchs auf universelle<br />
Gültigkeit einer bestimmten Weltauffassung (zunächst der christlichen, später der<br />
"wissenschaftlichen"). Daß der relativistische Diskurs, der diesen Anspruch problematisiert,<br />
auf der Ebene der Epistemologie unbefriedigend und merkwürdig "unentschieden"<br />
bleibt hat vor allem damit zu tun, daß Gegenstand der Wissenssoziologie<br />
keine unveränderlichen physikalischen, chemischen oder biologischen Objekte und<br />
Tatsachen sind; sondern jene sinnhaften (sprachlichen) Konstrukte, welche wir meinen,<br />
wenn wir von "Wirklichkeit" sprechen — mithin die "gesellschaftliche Konstruktion<br />
der Wirklichkeit" (so der Titel eines immens einflußreichen Buches von<br />
Peter L. Berger und Thomas Luckmann). Natur, Gesellschaft und Individuum sind<br />
ebenso Teil dieser "Wirklichkeit", wie diese sich auf deskriptive und normative Fragen<br />
bezieht. Eine Weltauffassung ist dergestalt ein (mehr oder weniger) geschlossener<br />
Set von kollektiven Vorstellungen bezüglich der Ordnung der Dinge, d.h. der<br />
Beschaffenheit der umgebenden Natur, der Gesellschaft, der Individuen; wobei diese<br />
Gegenstandsbereiche stets (allerdings in unterschiedlichem Grad) aufeinander bezogen<br />
werden. Eine solche Ordnung des Symbolischen beschreibt, deutet und schreibt<br />
vor; sie ist wirkmächtig, weil wir uns außerhalb ihrer weder denken, noch handeln<br />
können. Innerhalb dieser Wirklichkeit verschwimmen (vielleicht notwendig) logische<br />
und normative Aussagen. Absolute Bezugspunkte oder Differenzierungen jedenfalls<br />
nehmen in einer Welt aus Bedeutungszusammenhängen keine privilegierte<br />
Stellung ein; weder der Bezug auf die objektive Realität noch derjenige auf eine universelle<br />
Moral erschließt uns jenes Gemenge aus Vorschriften und Handlungsorientierungen,<br />
Deutungen und Klassifikationen, empirischen Wahrheiten, spirituellen<br />
Qualitäten, sozialen Beziehungen und psychischen Dispositionen. Dies gilt <strong>für</strong> unsere<br />
wie <strong>für</strong> alle anderen Kulturen.<br />
Die relativistische bzw. partikularistische Position unterscheidet sich von der<br />
universalistischen primär dadurch, daß sie selbstreflexiv ist. Während der Universalist<br />
selbstgewiß die Wertmaßstäbe seiner eigenen Kultur auf andere Gesellschaften<br />
bezieht, die dann notwendig als defizitär erscheinen, ist <strong>für</strong> den Partikularisten der<br />
Kulturvergleich Mittel zur Reflexion und ggf. Kritik der eigenen Vorstellungen.<br />
Dies heißt <strong>für</strong> den Bereich der <strong>Soziologie</strong> bzw. Sozialanthropologie, die gängigen<br />
Auffassungen bezüglich der "Natur" der Gesellschaft zu hinterfragen. In diesem Zu-
Die Sitten fremder Völker 233<br />
sammenhang ist insbesondere die Rede von universellen Bewegungsgesetzen, denen<br />
der kulturelle Prozeß bzw. die gesellschaftliche Entwicklung angeblich folgt, zurückzuweisen.<br />
Diese Kritik betrifft nicht nur den soziologischen "Evolutionismus" im<br />
überkommenen Sinn, sondern jeglichen Ansatz, der (explizit oder implizit) unterstellt,<br />
menschliches Streben und Handeln sei seit Entstehen der Gattung an invariablen,<br />
auf die Maximierung des materiellen Nutzens gerichteten Parametern orientiert<br />
(ich hatte mich im ersten Teil dieser Arbeit bereits ausführlich damit befaßt). So<br />
bedarf das Konzept der "sozialen Evolution" im Minimum eines einheitlichen Bewertungsmaßstabs.<br />
Dieser ist in der Regel der Grad der Naturbeherrschung, das Volumen<br />
und die Effizienz der Güterproduktion, die Emanzipation von mythischen und<br />
religiösen Glaubensvorstellungen oder der Abbau gesellschaftlicher Machtstrukturen.<br />
Der universalistische Ansatz begnügt sich allerdings nicht damit, die geschichtliche<br />
Entwicklung aus unserer Perspektive zu beschreiben, er will diesen Prozeß<br />
kausal zu erklären, indem er ein der Geschichte innewohnendes transzendentales<br />
Moment unterstellt, welches die Entwicklung notwendig antreibt. Die Ideologie der<br />
Neuzeit ist dergestalt jenes Konstrukt einer unwandelbaren menschlichen Natur, die<br />
sowohl Technik als auch Gesellschaft als unabdingbare Notwendigkeiten sieht, welche<br />
aus den Mängeln der conditio humana resultieren. Folgt man dieser Auffassung,<br />
wäre unsere Gesellschaftsordnung das natürliche Ergebnis natürlicher Gegebenheiten,<br />
und die Kultur wenig mehr als ein Epiphänomen. Nicht Technik und<br />
Wissenschaft sind dergestalt als "Ideologien" an Stelle der Religion getreten, sondern<br />
der Mensch (bzw. die menschliche Natur) hat im Zuge der Säkularisierung die<br />
Rolle Gottes als letzte Begründung gesellschaftlicher Verhältnisse eingenommen.<br />
MORAL UND KLASSIFIKATION<br />
Das Relativismusproblem stellt sich auch auf der Ebene der moralischen Wirklichkeit.<br />
Die Sitten anderer Völker sind uns zum Teil ebenso fremd wie ihre Glaubensanschauungen.<br />
Einige moralische Normen scheinen allerdings universell zu sein. Ich<br />
hatte weiter oben behauptet, daß eine Kultur bei der Erschaffung ihrer "Wirklichkeit"<br />
nicht vollkommen von den natürlichen Gegebenheiten absehen kann. Was <strong>für</strong><br />
die Klassifikationen gilt, trifft in ähnlicher Weise auch auf die moralische Ordnung<br />
zu: ohne bestimmte fundamentale und minimale Regeln, welche aus den elementaren<br />
Anforderungen des gesellschaftlichen Lebens hervorgehen, kann eine Gesellschaft<br />
nicht existieren. Auch wenn die meisten Normen kulturspezifisch sind, existiert<br />
also eine Reihe von universellen Geboten und Verboten. Solch universelle Normen<br />
sind die Norm der Reziprozität (als soziales Kausalitätsprinzip, Bedingung der<br />
Möglichkeit sozialen Handelns), das Inzesttabu (als Bedingung der Möglichkeit von<br />
Verwandtschaft, d.h. segmentärer Vergesellschaftung), schließlich die Gebote "Du<br />
sollst nicht töten", "Du sollst nicht stehlen" usw.. Auch wenn diese Sätze im Minimum<br />
nur <strong>für</strong> die Angehörigen eines eng begrenzten Gemeinwesens gelten und nicht<br />
<strong>für</strong> den Umgang mit Fremden, so müssen sie doch vorhanden sein, um das geordne-
234 Die Sitten fremder Völker<br />
te und dauerhafte Zusammenleben zu ermöglichen. 399 Es ist zudem nicht so, daß<br />
diese Vorschriften lediglich restriktiver Art sind, sie befähigen soziales Handeln<br />
ebenso, wie sie es beschränken. In dieser Hinsicht hat die Moral (wie die "Logik")<br />
eine irreduzible gesellschaftliche Funktion und wurzelt im Minimum in einer Reihe<br />
von Universalien (die vielleicht deshalb allzu oft übersehen werden, weil sie derart<br />
selbstverständlich sind).<br />
Die meisten Gebote und Verbote unterscheiden sich allerdings von Gesellschaft<br />
zu Gesellschaft, sie sind nicht universell sondern kulturspezifisch und <strong>für</strong> Angehörige<br />
anderer Kulturen häufig inakzeptabel. 400 Diese partikularen Normen reflektieren<br />
zum Teil die jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnisse, sie können aber<br />
auch vollkommen kontingent sein. Ich will an dieser Stelle nicht die Frage diskutieren,<br />
ob eine objektive Erkenntnis in moralischen Fragen möglich, was also das<br />
"wahrhaft Gute" ist, sondern lediglich auf einige Unschärfen bei der Begriffsbestimmung<br />
verweisen, welche den Gegenstand verdunkeln. So ist "Moral" nicht gleich<br />
"Moral" (und "Ethik" nicht gleich "Ethik"). Bestimmte Normen sind, wie gerade<br />
hervorgehoben, unhintergehbar und humanspezifisch, andere konventionell und kulturspezifisch,<br />
teils mit großem Gewicht ausgestattet und Teil des kulturellen Selbstverständnisses,<br />
teils wenig mehr als "Gewohnheiten", denen kein rekonstruierbarer<br />
Sinn und Zweck zugrunde liegt. 401<br />
Schließlich gibt es noch diejenigen Regeln, denen ein Individuum innerhalb<br />
seines Ermessensspielraums folgt. Diese Bereiche werden m.E. allzu oft verwechselt.<br />
So stellt z.B. Rhush Rhees fest, daß die Entscheidungskriterien einer Person<br />
nicht <strong>für</strong> andere Personen gelten (müssen). Rhees erläutert dies mit dem folgenden<br />
Beispiel: Wenn ich aus bestimmten Gründen meine Arbeitsstelle aufgebe,<br />
399 Auf die "Relativität", d.h. auf die Angehörigen der eigenen sozialen Gruppe beschränkte Gültigkeit<br />
der universellen Normen hatte ich bereits im 4. Kapitel hingewiesen.<br />
400 Herodot z.B. vertritt einen "klassischen" ethisch-moralischen Relativismus: man muß die Sitten<br />
fremder Völker achten, sie sind nicht besser oder schlechter als die eigenen. Der Perserkönig Kambyses<br />
muß demnach wahnsinnig gewesen sein, sonst hätte er »die fremden Gottheiten und Gebräuche nicht<br />
verhöhnt. Denn wenn man an alle Völker der Erde die Aufforderung ergehen ließe, sich unter all den<br />
verschiedenen Sitten die vorzüglichsten auszuwählen, so würde jedes, nachdem es alle geprüft, die<br />
seinigen den anderen vorziehen. So sehr ist jedes Volk überzeugt, daß seine Lebensformen die besten<br />
sind. [...] So steht es mit den Sitten der Völker, und Pindaros hat meiner Meinung nach ganz recht,<br />
wenn er sagt, die Sitte sei aller Wesen König. [...] Daß alle Völker wirklich ihre Lebensart <strong>für</strong> die beste<br />
halten, da<strong>für</strong> gibt es viele Beweise. Als z.B. Dareios König war, ließ er die Hellenen an seinem Hofe<br />
rufen und fragte, um welchen Preis sie sich bereit erklären würden, ihre toten Väter zu verspeisen. Sie<br />
erwiderten, um keinen Preis. Darauf ließ er die Kallatier rufen, einen indischen Volksstamm, bei dem<br />
die Leichen der Eltern gegessen werden, und fragte in Gegenwart der Hellenen mit Hilfe eines Dolmetschers,<br />
um welchen Preis sie zugeben würden, daß man die Leichen ihrer Väter verbrenne. Sie<br />
schrien laut und sagten, er solle solche gottlosen Worte lassen.« (Historien III.: 38)<br />
401 Warum schneiden wir Kartoffeln und Eier nicht mit dem Messer? Weil damit unbewußte (verdrängte)<br />
männliche Kastrationsängste wachgerufen werden? Dem letzten Satz überzeitliche Gültigkeit<br />
beimessen zu wollen, wäre lächerlich. Vielleicht rief die Verbindung von Messer und Kartoffel<br />
irgendwann einmal, wegen einer zu deutlichen Betonung der Symbolik dieses Akts, Ängste bei<br />
jemandem hervor, der die Macht hatte, die Sittlichkeit zu prägen; und andere folgten ihm, weil das, was<br />
er vorgab, stets en vogue war. Man sollte aber nicht allzuviel in Gebräuche interpretieren, die in anderer<br />
Hinsicht völlig bedeutungslos, weil willkürlich und zufällig, sind.
Die Sitten fremder Völker 235<br />
»könnte ein anderer Mann, der dieselben Gründe abwägt, zu einem anderen Schluß<br />
kommen. Vielleicht denke ich, daß seine Entscheidung falsch war. Aber ich sollte das<br />
nicht denken. Es war seine Entscheidung und es war — in einem gewichtigen Sinne<br />
— sein Problem. Wenn ich entscheide, daß dies <strong>für</strong> mich der einzig richtige Weg<br />
ist, sage ich nicht, daß er unter jenen Umständen der einzig mögliche <strong>für</strong> jeden Menschen<br />
ist.« (nach Gaita 1989: 124) Aus dem Beispiel folgt aber keineswegs, wie Raimond<br />
Gaita meint, daß moralische Urteile persönliche seien, sondern vielmehr<br />
(wenn man Rhees wörtlich nimmt) daß bestimmte Entscheidungen keine moralischen,<br />
sondern eben persönliche sind (und nicht mit moralischen verwechselt werden<br />
sollten). Das Moralische ist (ebenso wie die Sprache) das Gesellschaftliche per<br />
se, es ist an seiner Basis überindividuell. Das elementare "Du sollst (nicht)" ist keinen<br />
individuellen Launen unterworfen, und darf es auch nicht sein. Wenn andererseits<br />
bestimmte Entscheidungen aber im Ermessen der Menschen liegen, und nur<br />
<strong>für</strong> sie selbst tiefgreifende Konsequenzen haben, geht es nicht um Moral, sondern<br />
um individuelle Lebensführung. Dies nur als klärende Anmerkung.<br />
Moral und Klassifikation haben <strong>für</strong> Durkheim eine gemeinsame Wurzel, die Gesellschaft:<br />
»Statt daß es zwischen der Wissenschaft einerseits und der Moral und der Religion<br />
andererseits jene Antinomie gibt, wie man so oft angenommen hat, kommen<br />
diese verschiedenen Arten der menschlichen Aktivität in Wirklichkeit aus einer einzigen<br />
Quelle.« (1912: 595) Wie Durkheim betont, bedarf jede Gesellschaft sowohl<br />
des logischen als auch des moralischen Konformismus; manche "primitive" oder "archaische"<br />
Denksysteme, wie der Totemismus, liefern bzw. fordern offenbar beides<br />
zugleich. Nach Mary Douglas korrespondieren die Speisetabus, wie sie z.B. im 3.<br />
Buch Mose aufgestellt werden, direkt mit den Prinzipien der Klassifikation. In<br />
"Reinheit und Gefährdung" schreibt sie: »Unreinheit ist nie etwas Isoliertes. Sie<br />
kann nur dort auftreten, wo Vorstellungen systematisch geordnet sind.« (1966: 60)<br />
Die Tabus, welche den Verzehr bestimmter Tiere untersagen, sind demnach keine<br />
willkürlichen oder (in hygienischer Hinsicht) nützlichen Vorschriften, sondern die<br />
Konsequenz bestimmter Ordnungsprinzipien: 402 Unrein ist dasjenige, was sich der<br />
idealen, d.h. der "heiligen" Ordnung der Dinge widersetzt. Das grundlegende Prinzip,<br />
nach dem sich die Reinheit von Tieren bestimmt, lautet folglich, »daß sie ihrer<br />
Gruppe vollständig entsprechen sollen. All jene Arten, die dies nur auf unvollkommene<br />
Weise tun ... sind unrein.« (Ibid.: 76) So begegnet man in der jüdischen<br />
Schöpfungsgeschichte<br />
»einer dreiteiligen Anordnung, bestehend aus Erde, Wasser und Firmament. Das 3. Buch Mose<br />
übernimmt diesen Aufbau und weist jedem Element die ihm angemessene Art von Tieren<br />
zu. Unter dem Firmament fliegen Tiere mit zwei Füßen und Flügeln. Im Wasser schwimmen<br />
Fische mit Schuppen und Flossen. Auf der Erde hüpfen, springen oder gehen vierfüßige Tiere.<br />
402 Ob Douglas Ansatz die fraglichen Phänomene tatsächlich erschöpfend erklärt, sei dahingestellt.<br />
Ihre Argumentation schließt aber im Grunde gar nicht aus, daß die fraglichen Regeln auch einen materiellen<br />
Nutzen haben können.
236 Die Sitten fremder Völker<br />
Jede Gruppe von Tieren, denen die Ausstattung <strong>für</strong> die richtige Fortbewegung fehlt, verstößt<br />
gegen das Heiligkeitsgebot... So ist alles im Wasser, was keine Flossen und Schuppen hat, unrein.«<br />
(Ibid.)<br />
Das Verbot beispielsweise, Schweinefleisch zu essen, gründet demnach in der Tatsache,<br />
daß Schweine Paarzeher (Ordnung Artiodactyla), aber keine Wiederkäuer (wie<br />
Rinder oder Antilopen) sind, womit sie außerhalb der klassifikatorischen Ordnung<br />
stehen. »Gäbe es im Nahen Osten Pinguine, würde man sie als flügellose Vögel sicherlich<br />
zu den unreinen Tieren gerechnet haben.« (Ibid.: 77f.) 403 Auch wenn es<br />
noch andere, alternative Klassifikationsprinzipien geben sollte, ist doch nicht zu<br />
leugnen, daß die jüdischen Speiseverbote, indem sie eine deutliche Aussage bezüglich<br />
der Reinheit und Unreinheit bestimmter Arten treffen, praxisrelevant sind.<br />
Die klare Ausdifferenzierung zwischen den Sphären des Deskriptiven und des<br />
Normativen scheint tatsächlich ein historisch neues Phänomen zu sein. Die Scheidung<br />
zwischen "empirischen" Dingen und instrumentellen Handlungen einerseits,<br />
und "symbolischen" Dingen und expressiven Handlungen andererseits ist <strong>für</strong> die in<br />
unserer Gesellschaft dominante Weltauffassung nicht nur von zentraler Bedeutung,<br />
sie ist <strong>für</strong> diese sogar konstitutiv. Es ist genau diese Trennlinie, an der sich die "Entzauberung<br />
der Welt" realisierte. So hebt Habermas bei seiner Skizzierung der Defizite<br />
des "mythischen Weltverständnisses" vor allem dessen mangelnde »Differenzierung<br />
zwischen den fundamentalen Einstellungen zur objektiven, zur sozialen<br />
und zur subjektiven Welt« hervor (1987, I: 85), was <strong>für</strong> ihn Kennzeichen "fehlender<br />
Reflexivität" ist.<br />
Die Ansicht, daß erstens eine derartige Differenzierung vorgenommen werden<br />
muß, und daß zweitens die Fähigkeit, zwischen diesen vermeintlich klar unterscheidbaren<br />
Gegenstandsbereichen zu differenzieren, den Fortschritt des Denkens<br />
markiert, ist zentrales Element unserer native theory, die Dezentrierung, Reflexivität<br />
und Ausdifferenzierung von Wertsphären (als verbindliche Rationalitätsstandards)<br />
exklusiv <strong>für</strong> sich in Anspruch nimmt. Die konzeptionelle Abgrenzung von Wissenschaft,<br />
Moral bzw. Recht und Kunst ist dergestalt ein zentrales Merkmal des Weltverständnisses<br />
der "Moderne". Normative Fragen sind demnach nicht direkt empirisch<br />
zu beantworten, ästhetische nicht normativ usw., und bestimmte Fragen nach<br />
dem "Warum" werden aus dem wissenschaftlichen Horizont ausgeschieden; der<br />
Wissenschaftler sucht nicht länger seinen Weg zu Gott. Dem ist in den "primitiven"<br />
oder "vormodernen" Gesellschaften nicht so. Hier scheint die klare Unterscheidung<br />
403 Mary Douglas beschreibt an anderer Stelle die »Naturalisierung sozialer Klassifikationen« als ein die<br />
soziale Ordnung stabilisierendes Prinzip: »Es bedarf einer Analogie, dank deren die formale Struktur<br />
eines wichtigen Komplexes sozialer Beziehungen in der natürlichen Welt, in der übernatürlichen Welt,<br />
im Himmel oder sonstwo wiederzufinden ist, wobei es allein darauf ankommt, daß dieses "sonstwo"<br />
nicht als gesellschaftlich erzeugtes Konstrukt erkennbar ist. Wenn die Analogie von der Natur auf einen<br />
Komplex sozialer Beziehungen und von dort auf einen anderen Komplex und von dort wiederum auf die<br />
Natur übertragen wird, dann gräbt sich diese wiederholt auftauchende Struktur ins Bewußtsein ein, und<br />
das Hin und Her dieser Übertragungen stattet sie mit einer Wahrheit aus, die <strong>für</strong> sich selbst spricht.«<br />
(1986: 84f.)
Die Sitten fremder Völker 237<br />
zwischen dem Deskriptiven und dem Normativen ebenso abwesend zu sein wie diejenige<br />
zwischen Natur und Kultur.<br />
Dieser vermeintlichen "Konfusion" entspringt nach landläufiger Auffassung<br />
jene rituelle Praxis, die dazu dienen soll, den Naturverlauf zu beeinflussen: Magie<br />
(und nach Frazers Auffassung auch Religion). Wenn die Tsimshian den Lachs mit äußerstem<br />
Respekt behandeln, seine Gräten sorgsam aufsammeln und dem Wasser zurückgeben<br />
(vgl. Lévi-Strauss 1958b), damit der Fisch auferstehen kann, so ist dies<br />
auf den ersten Blick ein Musterbeispiel <strong>für</strong> ein animistisches Denken, welches die<br />
Tiere behandelt, als wären sie Menschen, als könnten sie Rache üben an der Gesellschaft,<br />
die von ihrem Fleisch lebt.<br />
Die Herstellung solcher Bezüge ist <strong>für</strong> das magische Denken nicht nur kennzeichnend,<br />
sie ist offenbar Bedingung seiner Möglichkeit: Die Elemente der belebten<br />
wie der unbelebten Natur werden nicht nur nicht systematisch von der Kultur geschieden,<br />
sie werden zudem behandelt, als hätten sie einen Willen, den man beeinflussen<br />
kann (später tauchen dann Götter auf, die über die Natur gebieten). Während<br />
moralische Verpflichtungen bei uns innerhalb der Gesellschaft bestehen, überschreiten<br />
sie im magischen Universum deren Grenzen: die Reziprozitätsnorm gilt<br />
auch <strong>für</strong> den Umgang mit der Natur, zwischen Inzesttabu (Heirat bzw. Geschlechtsverkehr<br />
innerhalb des eigenen "Totems") und Nahrungstabu (Verspeisen des eigenen<br />
Totemtiers) besteht offenbar keine grundsätzliche Differenz, zum Teil werden beide<br />
Akte sogar mit dem gleichen Begriff bezeichnet. Eine derartige gesellschaftliche Praxis<br />
erscheint uns als höchst irrational; uns unterlaufen keine derartigen "Verwechslungen",<br />
Menschen in modernen Industriegesellschaften sprechen in der Regel nicht<br />
mit den Bäumen, bevor sie sie fällen, und auch auf dem Schlachthof halten sie keine<br />
Dialoge mit dem Vieh. Unser Naturverhältnis ist vor allem zweckmäßig und auf<br />
Nutzenmaximierung ausgerichtet. Die Heiligung der Klassifikationssysteme ist aus<br />
diesem Blickwinkel nicht nur Indiz sondern auch Ursache der Rückständigkeit primitiver<br />
Kulturen. Sie sind vermeintlich in ihrer Weltsicht gefangen, die Sphären des<br />
Instrumentellen und Kommunikativen können sich nicht entfalten, sind gehemmt.<br />
Sieht man die Dinge so, vereinfacht sich das Relativismusproblem ganz erheblich:<br />
man befaßt sich nicht länger mit einzelnen Anschauungen, sondern nur noch mit deren<br />
Gesamtheit, d.h. dem Grad der richtigen bzw. "wirklichen" Differenzierung der<br />
einzelnen Geltungsbereiche.<br />
GESCHICHTE ALS REIFUNGSPROZESS?<br />
Eine solche Position wird z.B. von Jürgen Habermas vertreten; sie läßt sich auf folgende<br />
zentrale These reduzieren: Erst die korrekte Differenzierung zwischen objektiver,<br />
gesellschaftlicher und subjektiver Realität ermöglicht rationales Denken und<br />
Handeln, wobei die Rationalisierung von Weltbildern sich über (kumulative) Lernprozesse<br />
vollzieht (1987, I: 103). Die »Dezentrierung eines egozentrisch geprägten<br />
Weltverständnisses« (Ibid.: 106), von der Habermas im Anschluß an Piaget spricht,
238 Die Sitten fremder Völker<br />
scheint tatsächlich Vorbedingung <strong>für</strong> den Siegeszug des okzidentalen Weltverständnisses<br />
zu sein: die Erde steht im neuzeitlichen Weltbild ebensowenig im Mittelpunkt<br />
des Universums wie die Schöpfung allein auf den Menschen zielt. 404 Der realistische<br />
Blick auf die Natur, die Gesellschaft und auf uns selbst beschert uns demnach<br />
die Segnungen von Industrie, Demokratie und Psychotherapie.<br />
Fragt sich, inwieweit diese Auffassung zutrifft. Zweifellos bedeutet "Handlungsrationalität",<br />
so wie wir sie verstehen, vor allem Effizienz. Auch wenn Habermas<br />
kritisch anmerkt, daß »die modernen Gesellschaften des Westens ein verzerrtes,<br />
ein an kognitiv-instrumentellen Aspekten haftendes und insofern nur partikulares<br />
Verständnis von Rationalität fördern« (Ibid.: 102), liefert seine Konzeption der<br />
kommunikativen Rationalität lediglich eine Ergänzung der gängigen Sichtweise vom<br />
Siegeszug der instrumentellen Vernunft; er zementiert diese eher, als daß er sie in<br />
Frage stellt. Die Rationalisierung sowohl des (erfolgsorientierten) instrumentellen<br />
und strategischen Handelns wie auch des (verständigungsorientierten) kommunikativen<br />
Handelns resultiert offenbar aus einer einzigen Bewegung. Zwar weist<br />
Habermas darauf hin, daß der von ihm beschriebene Rationalisierungsprozeß nur<br />
»notwendige Bedingung <strong>für</strong> eine emanzipierte Gesellschaft« (Ibid.: 113), also keinesfalls<br />
hinreichend ist, aber es bleibt unverständlich, wie in einer Gesellschaft mit einem<br />
derart hohen Grad der kognitiven Differenzierung und Naturbeherrschung (als<br />
Rationalitätsmaßstab) noch Residuen des Irrationalen existieren können. Gerade das<br />
vermeintlich zu Erklärende, die spezifische Spannung zwischen den Sphären "System"<br />
und "Lebenswelt" (oder Arbeit und Interaktion resp. Zwecktätigkeit und<br />
Kommunikation) 405 , die fehlende Synchronisierung der jeweiligen Rationalisierungsprozesse,<br />
läßt sich nicht befriedigend erklären, da die eine Sphäre scheinbar notwendig<br />
über den Transmissionsriemen "Differenzierung" auf die andere bezogen ist.<br />
Zwar wohnt offenbar jedem der beiden Bereiche ein eigenes Rationalisierungspotential<br />
inne 406 , die Bewegungen müßten aber interdependent sein, da Rationalisierung<br />
und Differenzierung einander bedingen.<br />
Mir erscheint bereits dieses Klassifikationsschema den Gegenstand zu verfehlen.<br />
Habermas konzipiert die menschliche Zwecktätigkeit als die Geschichte trans-<br />
404 »Nur vor dem Hintergrund einer objektiven Welt, und gemessen an kritisierbaren Wahrheits– und<br />
Erfolgsansprüchen, können Meinungen als systematisch falsch, Handlungsabsichten als systematisch<br />
aussichtslos, können Gedanken als Phantasien, als bloße Einbildung erscheinen; nur vor dem<br />
Hintergrund einer gegenständlich gewordenen normativen Realität, und gemessen an dem kritisierbaren<br />
Anspruch auf normative Richtigkeit, können Absichten, Wünsche, Einstellungen, Gefühle als illegitim<br />
oder auch nur idiosynkratisch, als nicht verallgemeinerbar und bloß subjektiv erscheinen. In dem Maße<br />
wie mythische Weltbilder Kognitionen und Handlungsorientierungen beherrschen, scheint die klare<br />
Abgrenzung eines Bereichs der Subjektivität nicht möglich zu sein.« (Ibid.: 83)<br />
405 Habermas bezeichnet laut Axel Honneth als "Lebenswelt" einen »Horizont intersubjektiv geteilter<br />
Hintergrundannahmen, in die jeder Kommunikationsprozeß vorgängig eingebettet ist [...]; er begreift<br />
sie als ein zu stabilen Überzeugungen geronnenes Resultat des kommunikativen Handelns, nämlich als<br />
das historische Produkt der Interpretationsanstrengungen vergangener Generationen.« (1999: 243)<br />
406 »Die Rationalisierung der Lebenswelt läßt sich als sukzessive Freisetzung des im kommunikativen<br />
Handeln angelegten Rationalitätspotentials verstehen.« (Habermas 1987, II: 232)
Die Sitten fremder Völker 239<br />
zendierendes Moment, als immanente Bewegung. Axel Honneth schreibt hierzu in<br />
einer aktuellen Skizze des Habermas'schen Denkens:<br />
»Die zweckrationale Einstellung [wird] nicht länger als typischer Ausdruck einer spezifischen<br />
Kultur, sondern als interner Bestandteil einer Form des Handelns begriffen ..., die im Unterschied<br />
zur Interaktion primär das Ziel der technischen Verfügung über unbelebte Gegenstände<br />
verfolgt. [...] Mit der Behauptung, daß instrumentelle Einstellungen intern mit einer<br />
menschlichen Handlungspraxis verknüpft seien, die eine universell notwendige Voraussetzung<br />
der Reproduktion von Gesellschaften darstelle, geht ... die Chance verloren, eine<br />
solche Form der Rationalität auf überzeugende Weise mit irgendwelchen Machtinteressen<br />
oder einer besonderen Kultur zusammenzubringen.« (1999: 237f.)<br />
Honneth merkt das lediglich en passant an. Daß dieses Vorgehen, die Entkopplung<br />
von "Kultur" und instrumentellem Handeln (d.h. die "Naturalisierung" des letzteren),<br />
das gesamte Projekt in Frage stellt, kommt ihm offenbar nicht in den Sinn. Habermas,<br />
der teilweise wie Frazer argumentiert, kultiviert eine kollektive Vorstellung,<br />
die gerade zu kritisieren wäre. In dem Maße, wie er das Konventionelle fälschlich<br />
universalisiert und sich auf überkommene Denkfiguren — insbesondere die Vorstellung<br />
der Wechselbeziehung von Ontogenese und Phylogenese (der Geschichte<br />
bzw. Entwicklung des Individuums und der Gattung) 407 — stützt, ist die "Theorie<br />
des kommunikativen Handelns" letztlich vor allem ein Beitrag zur Selbstmystifizierung<br />
unserer Gesellschaft. Rational ist, was wir da<strong>für</strong> halten, und uns zuschreiben —<br />
die anderen sind unvernünftig: »Den modernen Beobachter beeindruckt die rituelle<br />
Praxis durch einen äußerst irrationalen Charakter. Diejenigen Aspekte des Handelns,<br />
die wir heute bei wachem Bewußtsein auseinanderzuhalten nicht umhin können, sind<br />
in ein und demselben Akt verschmolzen.« (1987, II: 287). Man muß durchaus bezweifeln,<br />
daß dem bei uns prinzipiell nicht (und bei den "Primitiven" durchgängig)<br />
so ist. 408 Auch das praktische Handeln, die Zwecktätigkeit ist notwendig gesellschaftlich<br />
vermittelt, bedeutungsvoll. So scheitert Habermas bei seinem (durchaus<br />
407 Antje Linkenbach merkt hierzu an: »Habermas sorgt <strong>für</strong> die subtile Wiederkehr längst überwunden<br />
geglaubter Vorstellungen: der "Wilde" entspricht dem Kinde und erst der "Zivilisierte" hat den<br />
Erwachsenenstatus erreicht.« (1986: 83) Sie merkt weiterhin an: »Die Schwierigkeiten im Konzept von<br />
Habermas basieren ... auf zwei fragwürdigen Prämissen: einerseits der Homologie mythischer<br />
Denkstrukturen mit dem natürlichen, unbewußten Erfahrungshorizont des Kleinkindes, andererseits der<br />
These universaler Naturbeherrschung und instrumentellen Handelns als einziger kognitiv relevanter Art<br />
der Auseinandersetzung mit der Natur. [...] Gerade in primitiven Gesellschaften wird [die Natur] vor<br />
allem als ein den Menschen gegenüberstehendes Anderes gedacht, zu dem man in Beziehung treten<br />
kann, mit dem man respektvoll umgehen sollte. Dies hieße aber, daß ein anderer kognitiver Zugang zur<br />
Natur nicht apriori auszuschließen bzw. als irrelevant abzuklassifizieren wäre.« Es ist demnach höchst<br />
fraglich, ob man die "Mehrdimensionalität der Argumentation" in sog. "primitiven" Gesellschaften als<br />
"Vermengung von Geltungsansprüchen" bezeichnen darf (wie Habermas dies tut), »oder ob man nicht<br />
besser versucht, sie auf ein komplexes Weltverständnis zurückzuführen, eines, das Zusammenhänge auf<br />
mehreren Ebenen erkennt, ein Verständnis "globaler Kausalität", wie es Lévi-Strauss in Anlehnung an<br />
Marcel Mauss nennt.« (Ibid.: 96f., <strong>für</strong> den Hinweis auf Linkenbachs Buch danke ich W. Stender).<br />
408 Die Scheidung von "System" und "Lebenswelt" z.B. ist eine konventionelle, und die Tatsache, daß<br />
beide Bereiche in unserer Kultur als ausdifferenzierte und teilweise konfligierende wahrgenommen und<br />
beschrieben werden können, rechtfertigt nicht, diese Differenzierung zur Grundlage einer universalgeschichtlichen<br />
Deutung zu machen. Habermas' These von der drohenden "Kolonisierung" der Lebenswelt<br />
durch Systemimperative erscheint folglich als prinzipiell fragwürdig.
240 Die Sitten fremder Völker<br />
verdienstvollen) Versuch der Klärung der normativen Grundlagen von Kritik. Derartige<br />
Probleme sind kaum mittels ebenso fragwürdiger wie überflüssiger Konstruktionen<br />
zur Universalgeschichte der Kognition lösen; die "Wilden" sind keine Kinder.<br />
Man muß auch Habermas (einen Ausspruch von Lévi-Strauss aufgreifend) vorhalten,<br />
daß er an die Stelle der wirklichen und konkreten Geschichte "Entwicklungsgesetze"<br />
treten läßt, die nur in seinem Denken, in der abendländischen Eingeborenen-<br />
Mythologie (die letztlich Ideologie ist) existieren. Die Differenzen und Dichotomien,<br />
mit denen Habermas operiert, sind nicht "objektiv" gegeben und überzeitlich<br />
gültig, sondern kontingent, konventionell und kulturspezifisch, in jedem Fall aber<br />
derart gesellschaftlich und kulturell überdeterminiert (Pulver und Blei der imperialistischen<br />
technisch-instrumentellen Moderne), daß sie zu allererst zu dekonstruieren<br />
wären, um den "aufklärerischen" d.h. kritischen und selbstreflexiven Gehalt des<br />
"Projekts der Moderne" zu retten. 409 Habermas' ist nur dann produktiv zu wenden,<br />
wenn man erkennt, daß es lediglich unsere Ansprüche sind, die bei ihm zur Geltung<br />
kommen; er läßt sich durchaus in kritischer Absicht nutzen, um die eigenen Auffassungen<br />
einer Prüfung zu unterziehen. 410 So hat zum Beispiel die Feststellung der<br />
zentralen Rolle, welche die Zweigeschlechtlichkeit in der Geschichte des Lebens<br />
spielt, absolut nichts in einem normativen Diskurs über Sexualität verloren. Die Behauptung<br />
Homosexualität sei "widernatürlich" reduziert körperliche Liebe allein auf<br />
die Fortpflanzungsfunktion, was absurd ist. Sexualität ist nicht per se eine Zwecktätigkeit.<br />
Andererseits ist es ebenso unsinnig, angesichts derartiger Argumente (und<br />
der Tatsache, daß auch subjektive Befindlichkeiten zumindest partiell gesellschaftlich<br />
erzeugt sind) zu behaupten, die biologische Zweigeschlechtlichkeit der Gattung<br />
Mensch sei ein soziales Konstrukt. Man muß die objektiven Gegebenheiten nicht<br />
leugnen, um gesellschaftliche Verhältnisse zu kritisieren — genauso wenig wie man<br />
sich zu ihrer Rechtfertigung auf die äußere Natur stützen kann.<br />
KINDER, WILDE, ZIVILISIERTE<br />
Um diese Aussage zu qualifizieren, komme ich erneut zurück auf den Evolutionismus.<br />
Soziologische und biologische Evolutionstheorie entwickelten sich in enger<br />
Wechselbeziehung. Von Anfang an wurde die Entwicklung der Arten nach dem Bild<br />
des Aufstiegs der okzidentalen Zivilisation konzipiert, Herbert Spencers Werk war<br />
<strong>für</strong> Darwin eine der wichtigsten Inspirationen. Sind gesellschaftliche Entwicklungsprozesse<br />
somit analog der Theorie der natürlichen Auslese zu begreifen? Für Jaques<br />
Monod arbeitet die natürliche Auslese nach dem Prinzip von Zufall und Notwendig-<br />
409 Vgl. auch Habermas' Legitimation des evolutionistischen Diskurses in "Zur Rekonstruktion des<br />
Historischen Materialismus" (1976: insbes. 133ff. und 194).<br />
410 Wolfram Stender weist in einer hervorragenden Studie, die Habermas' Denken in den Kontext der<br />
sog. "kritischen Theorie" stellt, darauf hin, daß Habermas bestimmte Einsichten einiger der von ihm<br />
rezipierten Autoren systematisch ignoriert (1995: 371). Dies gilt meines Erachtens insbesondere <strong>für</strong> die<br />
<strong>Soziologie</strong> Durkheims.
Die Sitten fremder Völker 241<br />
keit. Während Mutationen fortwährend und zufällig (im Sinne von ungerichtet) geschehen,<br />
werden diese Mutationen nach bestimmten Kriterien entweder übernommen<br />
oder aber zurückgewiesen (vgl. Elster 1979: 35). Begreift man diesen Selektionsprozeß<br />
als unilineare und irreversible Bewegung, sind diese Kriterien invariabel<br />
und transzendieren die Evolution. 411<br />
Jede soziologische Position, die sich analog auf ein die Geschichte transzendierendes<br />
Moment beruft, welches diese in Gestalt einer naturgesetzlichen Teleologie<br />
antreibt, bedarf, wie ich bereits an anderer Stelle darlegte, »eines Gattungssubjekts,<br />
welches (in) sich über die Geschichte gleich bleibt; sich an unwandelbaren, ewigen<br />
Handlungsimperativen (abstrakt menschlichen Interessen und Bedürfnissen) orientiert.«<br />
(1999: 168) So war die historische Entwicklung <strong>für</strong> Adam Ferguson durch<br />
den immanenten Wunsch des Menschen nach Vervollkommnung bestimmt — eine<br />
Vorstellung, die bis zu Aristoteles zurückzuverfolgen ist, der »in seiner Konzeption<br />
des Werdens als eines Übergangs von der "Potentialität" in die "Aktualität" eine ontologische<br />
Auffassung des Prozesses der ... menschlichen Entwicklung antizipiert.«<br />
(Klaus Hesse in Streck 1987: 47) Nach Aristoteles trägt die gesamte Natur einen vitalen<br />
Impuls zu höheren Manifestationen in sich, und das menschliche Leben durchläuft<br />
eine »Skala fortschreitender Komplexität, die bestimmt ist durch ihr letztendliches<br />
Ziel — den Menschen als Stadtbürger, als zoon politikon.« (Ibid.) 412 Alternativ<br />
kann man ein dem Menschen eigenes Bemühen unterstellen, seine materielle Lage zu<br />
verbessern, 413 oder ein Streben des menschliches Geistes nach Erkenntnis, schließlich<br />
auch einen ewigen und überzeitlichen "Kampf ums Dasein", der den Menschen<br />
411 Wie François Jacob wiederholt betont, operiert die Selektion nicht mit dem Möglichen, sondern mit<br />
dem Vorhandenen (1970, 1982). An anderer Stelle schreibt er: »Für Jacques [Monod] hatte letzten<br />
Endes die natürliche Auslese jeden Organismus gebildet, jede Zelle, jedes Molekül, bis in die kleinste<br />
Einzelheit. Bis es eine Vollkommenheit erreicht hatte, die sich schließlich nicht mehr von jener<br />
unterschied, in der andere ein Zeichen göttlichen Willens sahen. Jaques wollte die Natur kartesianisch<br />
und schrieb ihr Eleganz zu. Ich dagegen sah in der Welt keine solche Striktheit und Rationalität. Was<br />
mich staunen machte, war weniger ihre Eleganz oder ihre Vollkommenheit als ihre Beschaffenheit. Daß<br />
sie so und nicht anders war. In meinen Augen glich die Natur eher einem großherzigen Mädchen.<br />
Großzügig, aber ein bißchen schmutzig. Ein wenig wirr. Das sich so durchrackert, von Gelegenheit zu<br />
Gelegenheit. Welches tat, was es konnte, mit dem was es fand.« (Jacob 1987: 397)<br />
412 Um es vorwegzunehmen: Eine solche Konstruktion ist notwendig idealistisch (und wohl auch<br />
ideologisch), und dürfte sowohl der konkreten Geschichte als auch den Unterschieden zwischen den<br />
Gesellschaften gegenüber blind sein.<br />
413 Wie V. Gordon Childe hervorhebt, ist allerdings »ein menschliches Bedürfnis keine feststehende<br />
Größe. Ohne Zweifel kann man die Leistungskraft eines Autos bei der Befriedigung des Bedürfnisses<br />
nach Beförderung unter bestimmten Bedingungen mit mathematischer Genauigkeit bezeichnen. Doch ist<br />
das Bedürfnis des Menschen nach Beförderung in irgendeinem konkreten Sinn eine feste Größe? Bestand<br />
<strong>für</strong> einen Rentierjäger 30.000 v. Chr., einen Einwohner des alten Ägyptens 3.000 v. Chr. oder einen<br />
Briten 30 v. Chr. wirklich das Bedürfnis oder der Wunsch, mit 100 Stundenkilometern Geschwindigkeit<br />
ein paar hundert Meilen weit zu reisen? Die Bedürfnisse des Menschen haben sich in dreißig<br />
Jahrtausenden ebenso sehr gewandelt wie die "Leistungskraft" der Instrumente zu ihrer Befriedigung.<br />
Für eine Magdaléniengesellschaft der jüngsten Eiszeit besaß eine Harpune aus Rentiergeweih ebensoviel<br />
Leistungskraft wie <strong>für</strong> uns heute ein Fischdampfer. [...] Die Bedürfnisse des Menschen sind seit seinem<br />
Hervortreten aus den vormenschlichen Wesen nicht mehr starr und angeboren; sie haben sich ...<br />
entwickelt.« (Childe 1951: 20f.)
242 Die Sitten fremder Völker<br />
die Evolution quasi gesetzmäßig aufnötigt. Was auch immer man als Motor des Fortschritts<br />
verortet: Dasjenige, was vermeintlich die Geschichte transzendiert, kann<br />
nicht einfach beim Fortschreiten zu höheren Formen abgeschüttelt werden. Oder,<br />
anders formuliert: das, was Geschichte ursprünglich antrieb, ist quasi dialektisch in<br />
jeder höheren Form "aufgehoben" — subtrahiert man es, bricht die Eigenlogik der<br />
Entwicklung zusammen. Diese Denkfigur hat in einer bestimmten Ausprägung<br />
durchaus unangenehme Konsequenzen.<br />
Die Vorstellung, die noch beobachtbaren "primitiven" Völker und deren <strong>Institut</strong>ionen<br />
öffneten sozusagen den Blick in die Kindheit des Menschengeschlechts paart<br />
sich bei Sigmund Freud mit der Überzeugung, jedes Individuum wiederhole in seiner<br />
Persönlichkeitsentwicklung (Ontogenese) die Geschichte der Gattung (Phylogenese).<br />
Das grandiose "Totem und Tabu", eines der unvergänglichen Monumente des<br />
Evolutionismus, trägt zudem den Untertitel: "Einige Übereinstimmungen im Seelenleben<br />
der Wilden und der Neurotiker", was darauf verweisen soll, daß beim<br />
Neurotiker in gewisser Hinsicht der Reifungsprozeß fehlgeschlagen ist und er sich<br />
aufführt wie ein Wilder — oder eben ein Kind. 414<br />
»Die Motive, welche zur Ausübung der Magie drängen, sind leicht zu erkennen, es sind die<br />
Wünsche des Menschen. Wir brauchen nun bloß anzunehmen, daß der primitive Mensch ein<br />
großartiges Zutrauen zur Macht seiner Wünsche hat. Im Grunde muß all das, was er auf magischem<br />
Wege herstellen will, doch nur darum geschehen, weil er es will. [...] Für das Kind,<br />
welches sich unter analogen psychischen Bedingungen befindet, aber motorisch noch nicht<br />
leistungsfähig ist, haben wir an anderer Stelle die Annahme vertreten, daß es seine Wünsche<br />
zunächst halluzinatorisch befriedigt.« (Ibid.: 372) 415<br />
Für den erwachsenen "Primitiven" gibt es zwar einen anderen, konkreten Weg zur<br />
Bedürfnisbefriedigung, aber seine Darstellung des befriedigten Wunsches im magischen<br />
Ritual »ist dem Spiele der Kinder völlig vergleichbar.« (Ibid.) Für Freud reprä-<br />
414 Ich muß darauf hinweisen, daß ich hier nur eine stilisierte und vulgarisierte Fassung der Freudschen<br />
Theorie wiedergebe. Es geht mir nicht um deren Vielschichtigkeit und Widersprüchlichkeit, sondern<br />
nur um eine grundlegende Denkfigur. Richard Webster (1995) beschreibt in einem sehr lehrreichen<br />
(und Freud durchaus freundlich gesonnenen) Buch die Etablierung der psychoanalytischen Lehre. Leider<br />
sind Websters Vorschläge zur Begründung einer "wissenschaftlichen" Psychologie äußerst vage und<br />
verweisen lediglich auf einen anderen, höchst problematischen Korpus von Glaubensanschauungen, den<br />
Neo-Darwinistischen (vgl. Ibid.: 493, 501).<br />
415 Freud reflektiert in dieser Parallelisierung auch die Neurosentherapie: »Der Fortbestand der Allmacht<br />
der Gedanken tritt uns bei der Zwangsneurose am deutlichsten entgegen, die Ergebnisse dieser<br />
primitiven Denkweise sind hier dem Bewußtsein am nächsten. Wir müssen uns aber davor hüten, darin<br />
einen auszeichnenden Charakter dieser Neurose zu erblicken, denn die analytische Untersuchung deckt<br />
das nämliche bei den anderen Neurosen auf. Bei ihnen allen ist nicht die Realität des Erlebens, sondern<br />
die des Denkens <strong>für</strong> die Symptombildung maßgebend. Die Neurotiker leben in einer besonderen Welt,<br />
in welcher, wie ich es an anderer Stelle ausgedrückt habe, nur die "neurotische Währung" gilt, das<br />
heißt, nur das intensiv Gedachte, mit Affekt Vorgestellte, ist bei ihnen wirksam, dessen Übereinstimmungen<br />
mit der äußeren Realität aber nebensächlich. [...] So erweist sich die Allmacht der Gedanken,<br />
die Überschätzung der seelischen Vorgänge gegen die Realität, als unbeschränkt wirksam im Affektleben<br />
des Neurotikers und in allen von diesem ausgehenden Folgen.« (Ibid.: 374f.) Dadurch, wie auch durch<br />
seinen starken und "tätigen" Aberglauben zeigt uns der Neurotiker »wie nahe er dem Wilden steht, der<br />
durch seine bloßen Gedanken die Außenwelt zu verändern vermeint.« (Ibid.: 375)
Die Sitten fremder Völker 243<br />
sentieren die "Wilden" also in reinstem Wortsinn die "Kindheit des Menschengeschlechts",<br />
die "animistische Stufe" ist ein wichtiger Schritt im Reifungsprozeß der<br />
Menschheit. Den Neurotiker und den "Primitiven" verbindet somit eine gewisse<br />
"Unreife", beide sind fixiert auf die nicht aufgelöste (kulturalisierte) ödipale Triangularität.<br />
416 Freud diagnostiziert die Rituale fremder Kulturen recht unbekümmert<br />
als Zwangshandlungen, und kann damit auch umstandslos über die (vermeintliche)<br />
Ätiologie dieser "Kollektivneurosen" aufklären: ein fortdauernder Konflikt zwischen<br />
Verbot und Trieb (1912/13: 321), 417 der noch nicht "kulturalisiert" ist und sich<br />
folglich in Riten äußern muß, welche den Symptomen des Zwangsneurotikers entsprechen,<br />
der sich umgekehrt »ganz wie die Wilden« benimmt (Ibid.: 347). 418<br />
"WHERE UNKNOWN, THERE PLACE MONSTERS"<br />
Ich will diese unterstellten Parallelen hier nicht weiter vertiefen, da es mir primär<br />
um etwas anderes geht, um die Vorstellung Freuds nämlich, Kultur gründe auf Natur,<br />
die historisch zu bezwingen war — wenngleich sie niemals völlig überwunden<br />
werden konnte. Was Freud mit Thomas Hobbes verbindet, ist die Vorstellung vom<br />
Wilden, vom Tier in uns. »Homo homini lupus — wer hat nach allen Erfahrungen<br />
des Lebens und der Geschichte den Mut, diesen Satz zu bestreiten?« (Freud 1930:<br />
102) Unter einer (scheinbar ruhigen) Oberfläche liegt eine Realität ganz anderer<br />
Art, lauert die wölfische Natur des Menschen; Aufgabe von Kultur ist, diese Natur<br />
in Schach zu halten. Vernunft ist Verzicht, bei Freud durch das Über-Ich erzwunge-<br />
416 Es ist einfach, sich heutzutage über Totem und Tabu lustig zu machen. Man sollte das Buch eher als<br />
Zeitdokument nehmen, als Ausfluß eines ernsthaften Bemühens, zu verstehen, Kohärenz zu erzeugen.<br />
Freud selbst erscheinen seine Hypothesen als beinahe subversiv: »Wir täuschen uns wohl nicht darüber,<br />
daß wir uns durch solche Erklärungsversuche dem Vorwurfe aussetzen, daß wir den heutigen Wilden<br />
eine Feinheit der seelischen Tätigkeiten zumuten, die weit über die Wahrscheinlichkeit hinausgeht.<br />
Allein ich meine, es könnte uns mit der Psychologie dieser Völker, die auf der animistischen Stufe<br />
stehengeblieben sind, leicht so ergehen wie mit dem Seelenleben des Kindes, das wir Erwachsene nicht<br />
mehr verstehen und dessen Reichhaltigkeit und Feinfühligkeit wir darum so sehr unterschätzt haben.«<br />
(Ibid.: 386)<br />
417 Primärer Gegenstand von "Totem und Tabu" ist die Aufrichtung des Inzesttabus. Dieses nimmt eine<br />
Schlüsselposition im psychoanalytischen Diskurs ein. Seine Durchsetzung markiert <strong>für</strong> Sigmund Freud<br />
sowohl den Übergang von der Natur zur Kultur (phylo– und ontogenetisch und systematisch), als auch den<br />
Schnittpunkt von <strong>Soziologie</strong> und Psychologie: der Ödipuskomplex und sein historisches Substrat, die<br />
Urvatertötung bezeichnen nicht nur den Ort und den Zeitpunkt, an dem das Naturwesen Mensch zum<br />
gesellschaftlichen Wesen (gemacht) wird, er bezeichnet ebenso die Binnenstruktur dieses Wesens (Es,<br />
Ich, Über-Ich); die psychische (affektive) Struktur ist <strong>für</strong> Freud zugleich eine soziale (symbolische), die<br />
psychologische Formulierung eine soziologische.<br />
418 Freud »war an mehr interessiert als an der Übereinstimmung zwischen der, wie er sie nannte,<br />
"primitiven" und der neurotischen Denkweise; er wollte herausfinden, welches Licht die primitive<br />
Geistesverfassung auf alles Denken — auch das "normale" — und auf die Geschichte werfen konnte. Er<br />
kam zu dem Schluß, daß der Denkstil der "Wilden" in den reinsten Konturen enthüllte, was der Psychoanalytiker<br />
bei seinen Patienten und, wenn man die Welt betrachtet, bei jedermann zu erkennen genötigt<br />
ist: den Druck der Wünsche auf die Gedanken, die höchst praktischen Ursprünge jeder geistigen<br />
Tätigkeit.« (Gay 1987: 371)
244 Die Sitten fremder Völker<br />
ner Triebverzicht, bei Hobbes durch das staatliche Gewaltmonopol erzwungener (oder<br />
diesem freiwillig abgetretener) Verzicht auf das Recht auf individuelle Gewaltausübung.<br />
419 Für Freud verschwindet die "menschliche Natur" mitnichten im Prozeß<br />
der Phylo– und Ontogenese: Gerade der Widerstreit der Universen von Natur<br />
und Kultur ist es, den er dramatisiert. So schreibt er bereits in der Traumdeutung:<br />
»Wie Ödipus leben wir in Unwissenheit der die Moral beleidigenden Wünsche,<br />
welche die Natur uns aufgenötigt hat, und nach deren Enthüllung möchten wir wohl<br />
alle den Blick abwenden von den Szenen unserer Kindheit.« (1900: 223) 420 — einer<br />
"Kindheit", welche der Mythos uns enthüllt.<br />
In einem Vortrag, der eher versuchsweise die Tragfähigkeit einiger Denkfiguren auslotet<br />
als den Anspruch zu erheben, einen kohärenten Ansatz zu präsentierten, nähert<br />
sich der französische Psychoanalytiker André Green dem Mythos aus psychoanalytischer<br />
Perspektive. Für Freud und seinen Kreis waren die Mythen so etwas wie kollektive<br />
Träume; beide verweisen auf infantile Phantasien. Wie Karl Abraham meinte,<br />
»ist der Mythos ein erhalten gebliebenes Stück aus dem infantilen Seelenleben des<br />
Volkes und der Traum der Mythos des Individuums.« (nach Oppitz 1975: 191) 421<br />
Das Interesse der frühen Psychoanalytiker am Mythos beruht demnach auf »einem<br />
heute sehr umstrittenen Anspruch« (Green 1980: 84), einer Begegnung mit den Tiefen<br />
des Urtümlichen, Ursprünglichen. »Der Mythos wäre ... Zeuge einer Vorgeschichte,<br />
eine nachträglich imaginäre Konstruktion der Ursprünge eines Volkes. Anzieu<br />
entlehnt Freud die treffende Formulierung: die Mythen sind die Decker-<br />
419 »Wenn nun auch "Kultur" ganz allgemein — und im ganzen recht wirkungsvoll — auf der Unterdrückung<br />
von "Trieben", von Lust, von Sexualität (und Aggression) aufgebaut ist, bleibt sich "Natur"<br />
doch in historischen Zeiträumen gleich, Trieb, Sexualität als Natur verändern sich wenig. Sie werden<br />
mit jedem Kind neu geboren: als anarchisch, als kulturfern, ja letztlich als kulturfeindlich. "Natur" muß<br />
daher immer wieder, in jeder neuen Generation, einer Triebkontrolle erst unterworfen werden. Die<br />
Kultur ruht auf den Verdrängungsleistungen früherer Generationen, und jede neue Generation wird<br />
dazu aufgefordert, diese Kultur durch das Vollziehen derselben Verdrängungsleistungen zu erhalten.«<br />
(Brückner 1982: 54)<br />
420 Trieb– und Kulturtheorie sind bei Freud untrennbar miteinander verknüpft, letztere nicht ohne<br />
erstere zu begreifen. Das betrifft sowohl den Dualismus von Unbewußt/Bewußt, als auch die<br />
komplexere Topologie von Es/Ich/Über-Ich, die in den zwanziger Jahren an dessen Stelle trat. In dieser<br />
Konstruktion steckt eine ganze Menge Sozialpsychologie; wie Thomas Geyer schreibt, hatte Freud »die<br />
Analyse des Ichs anhand von ausgesprochen sozialpsychologischen Phänomenen in den Mittelpunkt<br />
psychoanalytischer Forschung gerückt... Die Frage, auf welche psychische Binnenstruktur <strong>Institut</strong>ionen<br />
zurückgreifen können müssen, um ihren eigenen Bestand zu sichern, wies ihm 1921 in "Massenpsychologie<br />
und Ich-Analyse" den Weg zum zweiten topischen Modell des psychischen Apparats.« (1998: 131) Das Ich<br />
erscheint eingezwängt zwischen kulturellen Forderungen des Über-Ich und den kulturfernen des Es.<br />
421 Traum und Mythos, 1909. Oppitz kommentiert derartige Auffassungen folgendermaßen: »Man begriff<br />
die einen als die vergesellschaftete Form der anderen oder umgekehrt die anderen als die individuellen<br />
Ausprägungen der einen. Beide, Traum und Mythos, beinhalteten Kindheitsphantasien: Die Träume<br />
seien die infantilen Phantasieprodukte der einzelnen Personen, die Mythen diejenigen der Kindheit eines<br />
Volkes.« (Ibid.: 190f.) Diese Denkfigur fand sich nicht allein in psychoanalytischen Kreisen. So schreibt<br />
Eric R. Dodds, man habe zu Recht gesagt, daß der Mythos »das Traumdenken des Volkes sei, so wie der<br />
Traum als Mythos des Einzelmenschen gelten kann« (1951: 104), und bezieht sich dabei auf Jane<br />
Harrison.
Die Sitten fremder Völker 245<br />
innerungen der Völker« (Ibid.)<br />
Das Interesse des Psychoanalytikers am Mythos beruht folglich auf einem<br />
Wiedererkennen. »Der Psychoanalytiker findet im kulturellen Diskurs, den der Mythos<br />
darstellt, den diskursiven Stil der Bildungen des individuellen Unbewußten<br />
wieder, die er mit dem Anhören seiner Patienten Sitzung <strong>für</strong> Sitzung, Patient <strong>für</strong> Patient<br />
sammelt.« (Ibid.: 85) Traum wie Mythos sind demnach hochgradig deutungsbedürftig,<br />
die Interpretation enthüllt einen Sinn, »der nicht der des manifesten Mythen–<br />
oder Trauminhaltes ist.« (Ibid.) Für Otto Rank und Hans Sachs war der Mythos<br />
auf »halbem Wege zwischen Verdrängung und Wunscherfüllung« angesiedelt<br />
(Oppitz 1975: 193) Wie Rank und Sachs schreiben, rekonstruiert die Psychoanalyse<br />
»die ehemals bewußte, dann verbotene und nur in Gestalt des Mythos wieder entstellt<br />
zum Bewußtsein zugelassene Wunschdurchsetzung, deren Aufgeben den Anstoß<br />
zur Mythenbildung bot.« (nach Ibid.) 422 Während der Traum auf die Vergangenheit<br />
des Individuums verweist, wurzelt der Mythos in der Geschichte einer Gesellschaft;<br />
als »Wiederkehr des Verdrängten in verhüllter Form« (Ibid.: 88). Er wäre<br />
somit der ideale Gegenstand, so etwas wie das kollektive Unbewußte oder Verdrängte<br />
zu enthüllen. Freuds Umgang mit dem Mythos ist allerdings höchst fragwürdig.<br />
Er unterzieht den "Gründungsmythos" der Psychoanalyse, die Ödipusgeschichte<br />
keiner Deutung, sondern nimmt ihn wörtlich. Die Erzählung ist bei Freud kein Mythos<br />
mehr, sondern illustriert lediglich einen Komplex, eine »Struktur, die die<br />
Strukturen des Individuums und die der Gesellschaft miteinander in Beziehung setzt«<br />
(Ibid.: 93); die die Triebe "organisiert" und von ihnen organisiert wird.<br />
»Wenn sich die Psychoanalytiker auf den Ödipuskomplex berufen, haben sie weder den Ödipus-Mythos<br />
... noch die Tragödie von Sophokles im Sinn, ja nicht einmal den Komplex, wie<br />
sie ihn als gleichsam beobachtbares Faktum beschreiben. Vielmehr denken sie an den durch<br />
unbewußte Vorgänge umgeformten Triebkomplex, den es durch die Deutung in der Form<br />
wiederherzustellen gilt, die er besessen hätte, wenn er nicht bei seinem Auftreten im Bewußtsein<br />
durch die Abwehrmechanismen gegen die Angst zur Verdrängung, Verstellung und Umformung<br />
gezwungen worden war, so daß nur Spuren seiner Struktur zurückbleiben. Der Entschlüsselungsvorgang<br />
mußte über die Entdeckung des unbewußten Denkens verlaufen.« (Ibid.:<br />
102)<br />
Ein Rückbezug zu den Mythen läßt sich nur über den unterstellten Zusammenhang<br />
von Ontogenese und Phylogenese herstellen. Das gemeinsame Erbe der Menschheit<br />
strukturiert nicht nur das individuelle, sondern auch das kollektive Seelenleben, der<br />
Ödipuskomplex ist <strong>für</strong> Freud auch eine gesellschaftliche Realität. Als Bildung des<br />
kollektiven Unbewußten wäre der Mythos so etwas wie ein »Grenzgänger zwischen<br />
den beiden Codes des Individuellen und des Kollektiven.« (Ibid.: 112) Die von<br />
Freud entdeckte "Semantik" des Unbewußten könnte nach Green den Schlüssel zum<br />
Verständnis der Universalien mythischen Denkens liefern. Green hält es <strong>für</strong> wahrscheinlich,<br />
daß die »durch die unveränderlichsten Mytheme ausgedrückten allgemeinsten<br />
Inhalte« der Mythen sich »aus der Gesamtheit der unbewußten Vor-<br />
422 Die Bedeutung der Psychoanalyse <strong>für</strong> die Geisteswissenschaften, 1913.
246 Die Sitten fremder Völker<br />
stellungen und Affekte zusammensetzen, die mit den Trieben in Verbindung stehen,<br />
die den gemeinsamen und durch den jeweiligen Kontext der Kultur nur oberflächlich<br />
modifizierten Fundus der Menschheit bilden.« (Ibid.: 111f.) — Ich fasse Greens<br />
Argumentation kurz zusammen: Er stellt erstens fest, daß Traum und Mythos bestimmte<br />
Gemeinsamkeiten aufweisen; sie wirken einerseits wie eine normale Erzählung,<br />
sind aber gleichzeitig inkohärent und geheimnisvoll. Daraus schließt er (zweitens),<br />
daß in beiden gleichermaßen der manifeste Gehalt eine tiefer liegende, unbewußte<br />
Realität verhüllt, als (drittens) notwendige Wiederkehr des Verdrängten.<br />
»Man verbirgt das, an dessen Verborgenheit einem gelegen ist. Ist der Mythos aber<br />
einmal gedeutet, enthüllt er gar kein Geheimnis, das, wie im Falle des vom Psychoanalytiker<br />
gedeuteten Traumes, um jeden Preis hätte verborgen werden müssen.«<br />
(Green 1980: 86) Mit anderen Worten: die Mythen verhüllen offenbar weder ein<br />
ursprüngliches Drama, noch verweisen sie auf einen ewigen Konflikt (zumindest<br />
keinen im Sinne Freuds).<br />
Green ist mit diesem Resultat vieler Mytheninterpretationen nicht einverstanden.<br />
Was aber, wenn sie zutreffen? Dann würde die Abwesenheit einer universellen affektiven<br />
Tiefenstruktur vor allem auf die konkrete gesellschaftliche Bedingtheit der<br />
psychoanalytischen Grundannahmen verweisen. Die Mythen ruhen keineswegs<br />
zwangsläufig auf notwendig kollektiv Verdrängtem (als gemeinsames phylogenetisches<br />
Erbe), sind nicht dessen Wiederkehr in verhüllter Form, sondern tatsächlich<br />
nur Erzählungen, spannend, lehrreich, ermahnend, lustig, bewegend, tröstlich; häufig<br />
alles zugleich und kaum auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. »Fortan, sagte<br />
Coyote zu Mond, wirst du keine Menschen mehr töten. Der Mond wird an den<br />
Himmel versetzt und soll sein Licht verbreiten, damit man auch nachts unterwegs<br />
sein kann.« (aus einem Mythos der Nez Percé, nach Lévi-Strauss 1991: 157) Oder:<br />
»Früher konnten die Verstorbenen auferstehen. Aber heutzutage kehren die Toten<br />
nicht mehr zurück und man muß sie begraben. Wenn man stirbt, dann <strong>für</strong> immer.«<br />
(aus einem Mythos der Sinkaietk, nach Ibid.: 184) Ein anderer Mythos (der Cœur<br />
d'Alêne) erzählt,<br />
»daß eine Frau ihre Zwillinge dabei überraschte, wie sie insgeheim diskutierten. Der eine sagte:<br />
"Lebendig sein ist besser", und der andere: "Tot sein ist besser". Als sie ihre Mutter bemerkten,<br />
schwiegen sie still, und seither sterben von Zeit zu Zeit manche Leute. Natürlich gibt<br />
es stets auch welche, die geboren werden, und andere, die zum gleichen Zeitpunkt dahinscheiden.<br />
Wenn die Frau, ohne sich bemerkbar zu machen, die Kinder ihre Diskussion hätte beenden<br />
lassen, hätte einer der Zwillinge die Oberhand über den anderen behalten, und es hätte<br />
kein Leben oder keinen Tod gegeben.« (Ibid.: 248f.)<br />
Wollte man Freuds Kulturtheorie Glauben schenken, könnte man in dieser Erzählung<br />
eine indigene Darstellung des ewigen Kampfs von Eros und Thanatos, Leben<br />
und Tod sehen. Doch nichts legt eine solche Deutung nahe; der Tod ist immer<br />
schmerzlich, aber die Dinge sind so wie sie sind — und der Mythos enthält nicht<br />
mehr als diese Feststellung; keine Geheimnisse, keine verborgenen oder verhüllten<br />
Bedeutungen. Die Mythen begründen dergestalt ein anthropozentrisches Weltver-
Die Sitten fremder Völker 247<br />
ständnis, eine Weltordnung — nicht mehr und nicht weniger. Das kritische Potential<br />
der Psychoanalyse enthüllt sich erst in der Reflexion über die Zeitgebundenheit<br />
ihrer Einsichten. Es wurde von Freud zugunsten einer großartigen, die Geschichte<br />
transzendierenden Konstruktion aufgegeben. 423 Die psychoanalytische Kulturtheorie<br />
ist somit ein Unding, ihre Generalisierungen überflüssig und kontraproduktiv — sie<br />
ist ein typisches, und (im Unterschied zu dem, was Freud glaubte) 424 durchaus konventionelles<br />
Beispiel <strong>für</strong> unsere Auffassung von Natur, Kultur und Geschichte.<br />
Was das Ausfüllen von Leerstellen angeht, unterscheiden sich auch einige der<br />
avancierteren und (vermeintlich) kritischen Theoretiker nur wenig von jenen mittelalterlichen<br />
Kartographen, die dort, wo das Unbekannte begann, Ungeheuer zeichneten:<br />
wir plazieren Monstrositäten an die Grenzen unseres Horizonts. 425 Der leidlich<br />
zivilisierte Mensch wandelt in jener Tradition, in welche Freud sich einreihte, auf<br />
einer dünnen Kruste gerade eben erstarrter Lava, unter der seine viehische Natur<br />
brodelt und zum Ausbruch drängt. Das ist schwerlich eine wissenschaftlich begründete<br />
Auffassung, aber sie bestimmt offenbar unser Selbstverständnis. So fragt Marshall<br />
Sahlins, warum wir uns die Gesellschaft als einen notwendigen Zwangsapparat<br />
423 Bei der Diskussion der Psychoanalyse muß man m.E. dreierlei unterscheiden: erstens eine Methode,<br />
d.h. die analytische Therapie; zweitens die Beschreibung der psychischen Persönlichkeit und Prozesse<br />
(Psychodynamik); und drittens die Trieb- und Kulturtheorie. Heilen und Forschen waren <strong>für</strong> Freud zwei<br />
Teile eines irreduziblen Ganzen (Junktim). D.h. seine Postulate entsprangen vermeintlich dem<br />
analytischen Setting. Das ist zwar nicht pauschal von der Hand zu weisen; aber Freud dürfte hier<br />
zumindest partiell einem Selbstmißverständnis unterlegen haben. Indem er nämlich die Deutungen,<br />
welche die Analyse hervorbringt, als "wahr" statt als "effizient" klassifizierte, baute er hinsichtlich der<br />
Ursachen der Störungen ein szientistisches Trugbild auf, welches dann die Trieb- und Kulturtheorie<br />
hervorbrachte. Diese Kritik bezieht sich nun ausdrücklich nicht auf Freuds Beschreibung der psychischen<br />
Persönlichkeit (erste und zweite Topik) und der Dynamik psychischer Prozesse. Es bleibt auch Freuds<br />
unbestrittener Verdienst, die Rolle unbewußter Inhalte bzw. Anteile am Seelenleben herausgestellt zu<br />
haben. Seine Trieb- und Kulturtheorie dürfte sich aber wohl kaum zwangsläufig aus der analytischen<br />
Arbeit ergeben haben. Interessanterweise wird nun gerade dieser Teil von Freuds Theoriegebäude von<br />
sich als kritisch verstehenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern als besonders produktiv<br />
begriffen, und jede diesbezügliche vehement zurückgewiesen. Es scheint so, als müßten Trieb und<br />
Begehren der menschlichen Natur zugeschrieben werden, um deren Recht behaupten zu können. Diese<br />
Autorinnen und Autoren verkennen völlig, daß Freuds weitgehende Ontologisierung des Begehrens<br />
erstens verschleiert, daß dieses Begehren (wie auch Unbewußtes insgesamt) gesellschaftlich erzeugt ist,<br />
und zweitens Freuds Behauptung des asozialen (zumindest der Kultur gegenüber ambivalenten)<br />
Charakters der Triebe jede Kritik an konkreten gesellschaftlichen Verhältnissen unterminiert, da<br />
"Kultur" als per se repressiv angesehen wird. Für die Psychoanalyse gilt folglich im Prinzip das gleiche,<br />
was ich weiter oben (FN 236) in Bezug auf den Marxismus ausführte, daß es nämlich unmöglich ist,<br />
dieses Dilemma aufzulösen und den Ansatz produktiv zu wenden, ohne sich von einigen der<br />
Grundannahmen zu verabschieden.<br />
424 Üblicherweise wird Kritikern der Psychoanalyse in unzulässig "psychologisierender" Manier<br />
vorgeworfen, sie wehrten deren Einsichten ab. »Ich erinnere mich« schreibt Freud im Unbehagen in der<br />
Kultur, »an meine eigene Abwehr, als die Idee des Destruktionstriebs zuerst in der psychoanalytischen<br />
Literatur auftauchte, und wie lange es dauerte, bis ich <strong>für</strong> sie empfänglich wurde. Daß andere dieselbe<br />
Ablehnung zeigten und noch zeigen, verwundert mich weniger. Denn die Kindlein, sie hören es nicht<br />
gerne, wenn die angeborene Neigung zum "Bösen", zur Aggression, Destruktion und damit auch zur<br />
Grausamkeit erwähnt wird.« (1930: 247f.) Umgekehrt könnte man demjenigen, der so argumentiert,<br />
vorwerfen, er müsse dies glauben, damit sein Handeln wirksam ist.<br />
425 Dieses Bild stammt aus Pat Barkers Roman "The Eye in the Door" und wird dort W.H.R. Rivers,<br />
einem der "Väter" der ethnographischen Feldforschung, zugeschrieben.
248 Die Sitten fremder Völker<br />
vorstellen, den wir unserem Verlangen entgegenstellen müssen? Geht man davon<br />
aus, daß wir biologisch gesehen menschliche Wesen nur in potentia sind deren Neigungen<br />
kulturell geformt und festgeschrieben werden müssen, dann sollte Kultur<br />
besser als Mittel gedacht werden, welches Menschen befähigt, und nicht als Apparat,<br />
der sie unterwirft. 426 Dennoch ist das Bild von der Gesellschaft als machtvoller Kontrollinstanz<br />
ein Kernpunkt unserer indigenen Kosmologie und Anthropologie —<br />
weil sie ein vermeintlich notwendiges Übel ist. Die mit offener Gewalt drohende<br />
Gesellschaft als Disziplinaranstalt wurde somit zum Komplement des Bildes vom<br />
selbstsüchtigen, "wölfischen" Menschen. (1996: 405) Diese spezielle Voreingenommenheit<br />
liegt nach Sahlins auch der Konzeption des "zivilisatorischen Prozesses"<br />
zugrunde, in welchem eine "tierische" und antisoziale menschliche Natur Schritt <strong>für</strong><br />
Schritt unter gesellschaftliche Kontrolle gebracht, gebändigt, domestiziert wird. 427<br />
»Den ungeschliffenen Armen, der aufkommenden Bourgeoisie oder kolonisierten<br />
Völkern aufgezwungen — all denen, die wie die mittelalterlichen Leibeigenen vor<br />
ihnen die "gefallene", "viehische" Seite der Menschheit in Relation zu den bons-gens<br />
repräsentierten — war diese "Zivilisation" eine Herrschaft über den ungezähmten<br />
Körper, Kontrolle einer elementaren Wildheit.« (Ibid.: 406)<br />
Man sollte dieser Gründungsmythologie mißtrauen, die im wesentlichen von<br />
den Fortschrittsdoktrinen des Zeitalters der Aufklärung geprägt ist — die wiederum,<br />
wie Niall Ferguson hervorhebt, säkularisierte Adaptionen christlicher Doktrinen<br />
sind; wiewohl sie vermeintlich auf einem wissenschaftlichen Fundament ruhten.<br />
Die im 17. und 18. Jahrhundert einsetzende "Entzauberung" war somit zum Teil nur<br />
eine scheinbare, allzu oft nahmen lediglich nebulöse Konzepte wie "Natur" (Kant),<br />
"unsichtbare Hand" und "Bedürfnisse" (Smith) oder "Vernunft" (Hegel) lediglich die<br />
Rolle Gottes bzw. der göttlichen Vorsehung ein, wurden bestimmte Prinzipien zum<br />
die Geschichte transzendierenden Moment erhoben (vgl. Ferguson 1997: 26).<br />
Ich will hier nicht die Argumentation des 5. und 6. Kapitels wiederholen. Der erneute<br />
Rückgriff auf das in den westlichen Industriegesellschaften vorherrschende Bild<br />
von Mensch und Gesellschaft diente lediglich dazu, nochmals auf zwei zentrale Sachverhalte<br />
hinzuweisen: Erstens ist die Behandlung der Glaubensvorstellungen und<br />
Praktiken fremder Kulturen "infiziert" von einer Anthropologie der Defizienz, des<br />
Mangels. Diese Sichtweise ist aber unangemessen, da die jeweiligen magischen oder<br />
religiösen Vorstellungen und rituellen Praktiken im Zweifelsfall nicht mit wissenschaftlich-technischen<br />
verglichen werden können, weil die Handelnden andere Ziele<br />
verfolgen — was aber nicht heißen soll, daß "Magie" oder "Religion" einen einheitlichen<br />
Korpus bildeten, ich hatte bereits darauf verwiesen, daß deren gemeinsamer<br />
Nenner im Minimum nur darin besteht, daß sie uns fremd sind. Zweitens hat unsere<br />
426 Obwohl sie im Zweifel auch das letztere sein kann, und allzuoft auch ist.<br />
427 Und obwohl <strong>für</strong> Sahlins die Annahme "ethnographisch absurd" ist, haben okzidentale Philosophen<br />
allzu oft den Ursprung der Gesellschaft mit dem Ursprung des Staates identifiziert — ausgehend von der<br />
Vorstellung der Gesellschaft als Kontrollinstanz (Ibid.).
Die Sitten fremder Völker 249<br />
ebenso deterministische wie universalistisch– evolutionistische Ideologie genau das<br />
preisgegeben, was Horton als zentrales Merkmal der "wissenschaftlichen" Weltauffassung<br />
ansah: das Bewußtsein um mögliche Alternativen. 428 Genau wie jeder<br />
"durchschnittliche Wilde" können sich die meisten Menschen in den westlichen Gesellschaften<br />
gar kein anderes Leben vorstellen als dasjenige, welches sie leben. In<br />
"primitiven" Kulturen bestimmen und beschränken magische und religiöse Vorstellungen<br />
das Denken und Wollen, in den westlichen Industriegesellschaften sind es die<br />
Regeln unseres Wirtschaftens, die, zum Fetisch erhoben, die Grenzen unseres Vorstellungsvermögens<br />
markieren und die Menschen in selbstverschuldeter Unmündigkeit<br />
verharren lassen — weil sie glauben, die Dinge müßten so eingerichtet sein,<br />
wie sie sind.<br />
SUBLIME TORHEIT DER HOFFNUNG?<br />
Inwieweit sind nun magische Anschauungen rationalisierungsfähig? Dies ist, wie die<br />
vorstehenden Ausführungen deutlich gemacht haben sollten, keine einfache, sondern<br />
eine sehr schwierige, in erster Linie ethische Frage. Es ging mir ohnehin weniger darum,<br />
diese Frage zu beantworten (die sich erstens im Zweifelsfall <strong>für</strong> die Betroffenen<br />
gar nicht stellt und auf die es zweitens keine einheitliche Antwort gibt), sondern die<br />
gesellschaftliche Bedingtheit und Partikularität von Weltauffassungen herauszustellen.<br />
Sicherlich würden nur wenige Angehörige unserer Kultur ernsthaft behaupten<br />
wollen, Regenmagie erzeuge tatsächlich Regen — jedenfalls nicht, solange der Magier<br />
nicht über empirisch überprüfbare Verfahrensweisen verfügt, die ihn befähigen,<br />
Rauch zu erzeugen, der tatsächlich die Luftfeuchtigkeit kondensieren läßt. Ebensowenig<br />
dürfte Gartenmagie das Pflanzenwachstum beschleunigen — es sei denn,<br />
Yamswurzeln reagieren auf geheimnisvolle Weise auf menschliche Gedanken. Trotz<br />
allem bis hierhin Gesagten kann man nicht ignorieren, daß die "Primitiven", was den<br />
Grad ihrer Naturbeherrschung und ihren materiellen Besitz betrifft, uns ganz offensichtlich<br />
weit unterlegen sind. Aber "unterlegen" ist im Grunde der falsche Begriff,<br />
denn es ist eine Frage des Maßstabs, des Wollens. Jene zentrale evolutionistische<br />
428 Niall Ferguson zeichnet in einem außerordentlich klugen und lesenswerten Text die Spielarten des<br />
Determinismus nach, die letztlich alle auf die elementare Denkfigur von Geschichte als Summe kausaler<br />
Zwangsläufigkeit zurückgeführt werden können. Ferguson plädiert <strong>für</strong> eine neue Art von "Chaostory",<br />
die Nutzbarmachung einiger zentraler Einsichten der Chaostheorie <strong>für</strong> die Geschichtswissenschaft. »Wie<br />
er heutzutage von Mathematikern, Meterologen und anderen gebraucht wird, meint der Begriff "Chaos"<br />
nicht Anarchie. Er bedeutet nicht, daß keine Naturgesetze existieren.« Er verweist lediglich darauf, daß<br />
diese Gesetzmäßigkeiten innerhalb derart komplexer Arrangements wirken, daß es uns praktisch<br />
unmöglich ist, genaue Vorhersagen zu machen, »so daß das, was um uns herum geschieht, willkürlich<br />
und chaotisch zu sein scheint.« (Ibid.: 77) Genau dieses Modell will Ferguson <strong>für</strong> die Geschichtswissenschaft<br />
nutzbar machen. »Die philosophische Bedeutung der Chaostheorie besteht darin, daß sie die<br />
Vorstellungen von (kausaler) Verursachung und (zufälliger) Kontingenz versöhnt.« (Ibid.: 79) Wenn<br />
also die Geschichte als Abfolge scheinbar kausal verbundener aufeinander folgender Ereignisse (Bewegungen)<br />
beschrieben werden kann, die zu einem bestimmten Ergebnis führen, so war doch diese<br />
Bewegung eine keinesfalls zwangsläufige.
250 Die Sitten fremder Völker<br />
Annahme, die immer wieder ins Feld geführt wird und wonach die Grunderfahrung<br />
archaischer Gesellschaften diejenige des »schutzlosen Ausgeliefertseins an die Kontingenzen<br />
einer nicht beherrschten Umwelt« (Habermas 1987, I: 77) ist, trifft<br />
schwerlich zu.<br />
Wie die Arbeiten von Karl Polanyi, Marshall Sahlins und vielen anderen belegen,<br />
ist Kultur nicht aus dem Mangel geboren, und die "primitiven" Gesellschaften<br />
sind keineswegs zwangsläufig von der materiellen Not geprägt, sondern können sich<br />
durchaus als Kulturen der Fülle begreifen — weshalb die Segnungen der Zivilisation<br />
diesen Menschen häufig nicht unbedingt erstrebenswert erscheinen. Wie man einen<br />
vermeintlich psychisch Kranken nur dann therapieren kann, wenn er leidet, kann<br />
man eine Gesellschaft also nur dann "rationalisieren", wenn sie einen Mangel empfindet.<br />
Magie ist somit wahrscheinlich weniger ein aus Angst und Mangel geborener<br />
Aberglaube als ein Luxus, den bestimmte Kulturen sich leisten. Wenn in einer Gesellschaft<br />
die getöteten Tiere im Rahmen einer aufwendigen Zeremonie der Natur<br />
"zurückgegeben" werden, damit sie auferstehen können, ist dies keineswegs notwendig<br />
Manifestation einer Konfusion von "Natur" und "Kultur" (oder "Wissenschaft"<br />
und "Moral"), sondern möglicherweise Ausdruck von Respekt und Aufmerksamkeit.<br />
429 — Aber derart pauschale Zuschreibungen sind letztlich wenig produktiv<br />
und müßten im Einzelfall überprüft werden. Es ging mir lediglich darum, eine<br />
mögliche Gegenposition gegen die gängigen Auffassungen zu formulieren, und<br />
nicht darum, das "magische Universum" zu idealisieren. 430<br />
Nichtsdestotrotz übt dieses Universum auf den westlichen Menschen einigen<br />
Reiz aus. Mit der spezifischen (kognitiven) Differenzierung, die <strong>für</strong> die sog. "Moderne"<br />
kennzeichnend ist, geht eine Partikularisierung einher, ein Verlust umfassender<br />
und verbindlicher Sinn– und Bedeutungszusammenhänge in unserer Gesellschaft, ein<br />
Auseinanderfallen der "entzauberten" Welt. Und so suchen wir uns nicht allein in<br />
der anderen Lebensform zu spiegeln, Ethnologie kann auch die (sehnsüchtige) Suche<br />
nach der verlorenen Zeit (oder der verlorenen Unschuld) sein. Ich zitiere erneut<br />
Robin Horton:<br />
»Als Wissenschaftler ist es <strong>für</strong> mich vielleicht unvermeidbar, an bestimmten Punkten den<br />
Eindruck zu erwecken, daß das traditionale afrikanische Denken verglichen mit dem wissenschaftlichen<br />
Denken eine armselige, gehemmte Sache ist. Aber als Mensch lebe ich aus freier<br />
Entscheidung hier in einem immer noch sehr traditionalen Afrika — lieber als in der wissenschaftlich<br />
orientierten Subkultur, in der ich aufwuchs. Warum? Nun, es mögen viele merkwürdige,<br />
dunkle, uneingestandene Gründe sein. Aber ein Grund ist sicherlich die Entdeckung<br />
von Dingen, die zu Hause verloren sind. Eine intensive poetische Qualität des alltägli-<br />
429 Mag sein, daß uns der Fremde, seine Vorstellungen, die <strong>Institut</strong>ionen seiner Gesellschaft, die Beweggründe<br />
seines Handelns letztlich fremd bleiben; aber vielleicht erfahren wir, indem wir über sie<br />
nachdenken, mehr über unsere eigenen.<br />
430 Ich wollte mit diesem Sätzen lediglich darauf hinweisen, daß die "primitive Kultur" ein Existenzrecht,<br />
ein Recht auf ihre eigene Lebensweise und Weltsicht hat. Selbstverständlich ist nicht zu leugnen,<br />
daß andererseits viele Angehörige indigener Gesellschaften ihre Kultur angesichts der "Segnungen"<br />
der westlichen Zivilisation nur allzu bereitwillig preisgeben. Die Gründe hier<strong>für</strong> sind aber im<br />
Einzelfall genau zu hinterfragen.
Die Sitten fremder Völker 251<br />
chen Lebens und Denkens, ein lebhaftes Auskosten des vorüberziehenden Augenblicks.«<br />
(1967: 170)<br />
Dieser Sinn <strong>für</strong> die Poesie des Augenblicks (oder welche Bezeichnung man auch immer<br />
wählen will) kommt den Menschen in den "entwickelten" Industriegesellschaften<br />
ganz offensichtlich in ihrer rastlosen Jagd nach Nutzenmaximierung allzu oft abhanden.<br />
Magie ist wahrscheinlich tatsächlich Ausdruck der Hoffnung (weder sublim<br />
noch töricht), daß ein Vorhaben gelingen und ein gutes Ende nehmen mag, eine poetische<br />
Qualität der Arbeit, ein Element, das der Wirklichkeit Einheit verleiht und<br />
Bedeutung. Und vielleicht ist, wie Peter Winch schreibt, »unsere Blindheit gegenüber<br />
dem Sinn primitiver Lebensformen ... eine Folge der Sinnlosigkeit eines großen<br />
Teils unseres eigenen Lebens.« (1964: 111f.)<br />
Ich will das nicht entscheiden, denn die vorstehenden Auslassungen betreffen vor allem<br />
ethische Fragen, die ich hier nicht beantworten kann. Dennoch sollte man sie<br />
stellen; man muß dabei nicht zwangsläufig die Errungenschaften der modernen<br />
Technik und Wissenschaft zurückweisen, aber man sollte der Tatsache einsichtig<br />
werden, daß sie unsere Errungenschaften sind, gesellschaftlich rückgebunden und kulturell<br />
(d.h. symbolisch) überdeterminiert. Es besteht also kein Anlaß, die Existenz<br />
z.B. des Planeten Mars anzuzweifeln; unsere Motive zu seiner Erforschung sind hingegen<br />
kritisch zu hinterfragen — aber nicht unbedingt pauschal abzulehnen. Wenn<br />
wir unsere <strong>Institut</strong>ionen "entmystifizieren" müssen wir uns keineswegs von denjenigen<br />
ihrer Errungenschaften verabschieden, die uns am teuersten sind. Wir sollten<br />
uns allerdings über die Determinanten und Konsequenzen unserer gesellschaftlichen<br />
Praxis, unseres Handelns und Fühlens im klaren sein. Darüber kann die <strong>Soziologie</strong><br />
bzw. Sozialanthropologie aufklären. Eines aber vermag die Wissenschaft auf keinen<br />
Fall: uns in den Besitz jenes einen magischen Wortes setzen, welches, wenn wir es<br />
nur am richtigen Ort und zur rechten Zeit aussprechen, uns jenes Leben der Fülle<br />
beschert, das einzig lohnt, gelebt zu werden.
SCHLUSS<br />
»Der Mensch findet, ohne daß er sie anderweitig zu rechtfertigen<br />
braucht, sinnliche Befriedigungen am und zum Leben, so als ob dieses<br />
Leben einen Sinn hätte, obwohl die intellektuelle Aufrichtigkeit<br />
bestätigt, daß es keinen gibt.« (Claude Lévi-Strauss)<br />
Das evolutionäre Schema, welches der landläufigen Fortschrittsideologie zugrunde<br />
liegt bzw. in ihr enthalten ist, sieht in etwa folgendermaßen aus: Kultur bzw. Gesellschaft<br />
beginnt mit einer notwendigen und restriktiven Regelung der menschlichen<br />
Beziehungen. Inzesttabu, Gewaltverzicht, wechselseitige Obligationen der einzelnen<br />
Personen und Gruppen garantieren eine friedliche Koexistenz. Ist diese gesichert<br />
kann der Mensch seinen langen Marsch beginnen, der ihn aus den dämmrigen Niederungen<br />
des mythischen Denkens bzw. Aberglaubens (Magie, Ritual, Tabu) in das<br />
klare Licht der (instrumentellen) Vernunft führt. In dem Maße, wie die arbeitsteilige<br />
Differenzierung voranschreitet, Austauschbeziehungen und Märkte sich entwickeln<br />
und schließlich das Geld als universelles Wertäquivalent zur Verfügung steht, treten<br />
eigennützige Bestrebungen, die zuvor sozial desintegrativ wirkten, in den Dienst der<br />
sozialen Integration. Endpunkt dieser Entwicklung wäre eine friedfertige und harmonisierte<br />
Tauschgesellschaft, in der das wechselseitige (ökonomische) Interesse der<br />
Menschen aneinander (bzw. an dem, was sie zu Markte zu tragen haben) den Kitt<br />
bildet, welcher die Gesellschaft in ihrem innersten zusammenhält. Aber erstens sind<br />
wir von der friedfertigen Tauschgesellschaft weit entfernt, und zweitens fand diese<br />
Entwicklung wohl kaum derart zwangsläufig statt, wie obenstehende Sätze nahelegen.<br />
Man muß vielmehr davon ausgehen, daß die Entwicklung hin zur bürgerlichkapitalistischen<br />
Warengesellschaft die historische Spezifität eines begrenzten Kulturraums<br />
darstellt.<br />
Die Unterschiede zwischen den Kulturen können zwar typologisch erfaßt,<br />
aber nicht im Rahmen eines universalistischen Ansatzes, der einheitliche, überzeitlich<br />
gültige Dispositionen und Handlungsorientierungen der Menschen unterstellt,<br />
erklärt werden. Diesen Sachverhalt sollten die vorstehenden Ausführungen hinreichend<br />
deutlich gemacht haben. 431 "Rationalität" ist ein relationaler Begriff. Er bezieht<br />
sich auf die Effizienz von Handlungen, Vorstellungen und Organisationsformen<br />
bezüglich eines jeweiligen Zwecks. Eine Handlung oder Vorstellung wäre somit als<br />
rational zu bezeichnen, wenn sie den jeweils verfolgten Zielen (die keine instrumentellen<br />
sein müssen!) angemessen ist. Der Terminus verweist zudem auf die Reflexion<br />
dieses Sachverhalts, d.h. einen gesellschaftlichen Diskurs über Ziele und Mittel. Von<br />
Irrationalität resp. Rationalitätsdefiziten wäre nur dann zu sprechen, wenn be-<br />
431 Wenn ich davon sprach, daß zwischen den unterschiedlichen Kulturen ein Verhältnis der Inkommensurabilität<br />
besteht, wollte ich damit nicht behaupten, daß eine unüberbrückbare Kluft die Menschen<br />
voneinander trennt. Wesentliches Kennzeichen der menschlichen Natur ist die Unbestimmtheit<br />
und Flexibilität, deshalb auch können Individuen, und damit Gesellschaften (auch wenn sie über ein<br />
gewisses Beharrungsvermögen verfügen), Werthaltungen und Handlungsorientierungen von anderen<br />
(als überlegen empfundenen) Kulturen übernehmen. Da dies eine sehr komplexe Thematik ist, will<br />
ich auf diesen Punkt nicht weiter eingehen sondern es lediglich bei dieser klärenden Bemerkung belassen.
Schluss 253<br />
stimmte Handlungen oder Vorstellungen systematisch den Zielen der Handelnden<br />
zuwiderlaufen. Um den Grad der Rationalität von Handlungsmustern und Vorstellungskomplexen<br />
beurteilen zu können, müssen die expliziten und impliziten Ziele<br />
der Akteure bekannt sein. Die Gesellschaften unterscheiden sich vor allem hinsichtlich<br />
der Ziele, welche die Akteure verfolgen. Ethiken, Wertsysteme und Handlungsorientierungen<br />
sind das Resultat historischer Kontingenzen und nicht das Resultat<br />
zwangsläufiger, von einer Art "Naturgesetz" vorangetriebenen Entwicklung. Dieser<br />
Sachverhalt wird nicht nur allzuoft übersehen, es wird vielmehr auch heute noch<br />
(die Soziobiologie ist der beste Beleg hier<strong>für</strong>) der Versuch unternommen, die Verfaßtheit<br />
unserer Ökonomie und Gesellschaft als "natürliches" Ergebnis "natürlicher"<br />
Bedingungen zu deklarieren. 432<br />
Die Kritik an derartigen "naturalistischen" Ansätzen, die das Hauptziel der<br />
vorliegenden Arbeit war, ist wahrscheinlich so alt wie diese Ansätze selbst, dennoch<br />
erscheint sie mir alles andere als obsolet zu sein. Warum halten sich derartige Denkfiguren<br />
so hartnäckig? Zum einen sicherlich deshalb, weil sie die gesellschaftliche<br />
Wirklichkeit so darstellen, wie sie von wahrscheinlich den meisten Menschen in den<br />
"entwickelten" Gesellschaften erfahren wird. Aber ein solcher Satz sagt wenig aus.<br />
Wichtiger erscheint mir, daß der Evolutionismus (in welcher Spielart auch immer)<br />
diese Gesellschaftsform legitimiert und eine beruhigende (Selbst–) Gewißheit spen-<br />
432 Es ist durchaus möglich, daß man Geschichte tatsächlich innerhalb eines "evolutionären" Schemas<br />
erklären kann, aber nur in einer sehr spezifischen Lesart von "Evolution" und auch nur auf derart<br />
unspezifische Weise, daß die Beschreibung des Prozesses aus soziologischer Perspektive weitgehend<br />
irrelevant ist. Für die frühen Evolutionisten (z.B. Lamarck) war "Evolution" die quasi-gesetzmäßige<br />
Entwicklung von einfachen zu komplexen Formen (die Existenz der Dinosaurier diente lange Zeit als<br />
Argument der Gegner derartiger Vorstellungen, da diese ausgestorbenen Lebewesen offensichtlich<br />
hochentwickelte Organismen waren). Diese Vorstellung wurde dann zusammen mit Malthus'schem<br />
Gedankengut von Herbert Spencer aufgegriffen und auf Geschichte und Gesellschaft bezogen. Malthus<br />
ist hier deshalb von Bedeutung, weil damit der Wettstreit um knappe Ressourcen ins Spiel kommt. Bei<br />
Darwin, der sich auf Spencer bezieht, ist der evolutionäre Prozeß dann gar nicht mehr durch ein stetiges<br />
Voranschreiten auf Grundlage irgendwelcher Gesetzmäßigkeiten gekennzeichnet, sondern durch die<br />
Anpassung an veränderte Umweltbedingungen. Das "survival of the fittest" markiert nicht nur einen<br />
ewigen Kampf um knappe Ressourcen, bei dem jeweils die stärksten bzw. am besten angepaßten<br />
Individuen bzw. Arten dominieren, sondern ist auch eine notwendige Funktion eines auch aufgrund sich<br />
verändernder Umweltbedingungen ebenso notwendigen Anpassungsprozesses. Dieses Modell kann man<br />
natürlich auf die historische Entwicklung übertragen (was Durkheim z.B. in der "Arbeitsteilung" tut).<br />
Bevölkerungswachstum und wechselnde Umweltbedingungen führen zwangsläufig zu<br />
Anpassungsleistungen der Populationen (dies ist z.B. <strong>für</strong> den Übergang von der Alt- zur Jungsteinzeit gut<br />
dokumentiert). Da der Mensch erfinderisch ist, und eine ganze Reihe von Lösungen hervorbringt, kann<br />
man angesichts der Tatsache, daß Kulturkontakt die Norm ist und nicht Isolation, auch durchaus<br />
erwarten, daß dieser Prozeß historisch über die beständige Diffusion von Kulturelementen zu<br />
kumulativem "Fortschritt" führt, d.h. neuen Produktionsweisen und damit einhergehenden veränderten<br />
Anforderungen an die gesellschaftliche Organisation der Produktion. Damit hätte man sicherlich eine<br />
Triebkraft der Geschichte identifiziert, ohne auf Angst, Mangel oder Gier als fortdauernde wirkende<br />
Ursachen zurückgreifen zu müssen. Nur: was ist mit einen solchen allgemeinen Erklärung gewonnen,<br />
was kann sie uns hinsichtlich einer konkreten historischen Situation sagen? So gut wie nichts. Vor allem<br />
ist auf diese Weise die Dynamik des Kapitalismus nicht zu erklären. Diese hat inhärente Ursachen, die<br />
nicht unter Bezug auf das universelle Allgemeine identifiziert werden können — wiewohl sie<br />
selbstverständlich eines "natürlichen" Substrats, einer Bedingung der Möglichkeit bedürfen, aber dieses<br />
ermöglicht die Entwicklung tatsächlich nur und determiniert sie nicht.
254 Schluss<br />
det. Regeln, denen Menschen folgen, bedürfen stets einer Begründung, und offenbar<br />
müssen auch wir unsere <strong>Institut</strong>ionen und unser Verhalten in einem "interpretativen"<br />
Diskurs, der gleichzeitig ein normativer ist, fundieren. Wiewohl der Rekurs auf<br />
die menschliche Natur ein Spezifikum unserer Gesellschaft sein dürfte, unterscheidet<br />
uns die Vorgehensweise prinzipiell nicht vom "durchschnittlichen Wilden". 433 Die<br />
Begründung von Regeln erfolgt in allen Kulturen über die sog. "Naturalisierung"<br />
mittels mehr oder weniger komplexer, in der Kosmologie verankerter fiktiver Kausalbeziehungen.<br />
Das heißt, daß »<strong>Institut</strong>ionen in der Lage sind, ihren Legitimitätsanspruch<br />
nötigenfalls durch ihre Übereinstimmung mit der Natur der Welt zu begründen.«<br />
(Douglas 1986: 81). Durch ihre Naturalisierung werden sie Bestandteil<br />
der natürlichen Weltordnung und stehen dann als Argumentationsgrundlage zur<br />
Verfügung.« (Ibid.: 91) Angehörige vermeintlich "zivilisierter" und "fortgeschrittener"<br />
Gesellschaften, die meinen, wenn schon nicht in der besten aller möglichen<br />
Welten, so doch im Reich des Notwendigen und Zwangsläufigen zu leben, sehen<br />
diese Zusammenhänge nicht oder können bzw. wollen sie nicht sehen. Es bereitet<br />
offenbar Schwierigkeiten, den kontingenten, historischen Charakter des Gewordenen,<br />
dessen, was wir <strong>für</strong> notwendig und geboten halten, anzuerkennen. Jene »Konfusion<br />
von Natur und Kultur« und mangelnde »Differenzierung zwischen den fundamentalen<br />
Einstellungen zur objektiven, zur sozialen und zur subjektiven Welt«,<br />
die nach Jürgen Habermas (1981: 85) zentrales Merkmal des in "primitiven" Gesellschaften<br />
vorherrschenden mythischen Weltverständnisses sein soll, ist in einer sehr<br />
spezifischen Form also auch in unserem Denken anzutreffen.<br />
Zum dem gerade genannten inhaltlichen gesellt sich noch ein formales Kriterium.<br />
Dieses betrifft die Art und Weise, wie die doppelte Dichotomie Interesse–<br />
Norm und Individuum–Gesellschaft üblicherweise konzipiert ist. Während der Bereich<br />
des Normativen bzw. der "Struktur" der Gesellschaft zugeschlagen wird, wird<br />
die Sphäre des Intentionalen bzw. der Interessen dem Individuum zugeordnet. Dies<br />
gilt selbst dann, wenn die <strong>Institut</strong>ionen lediglich als Reflex auf die menschliche Natur<br />
und die vermeintliche "Lebensnot" begriffen werden. Es ist tatsächlich erstaunlich,<br />
daß der wissenschaftliche Diskurs einhundert Jahre nach Durkheim immer noch zumindest<br />
unterschwellig von dieser starren Entgegensetzung durchdrungen ist (auch<br />
wenn vielen Autorinnen und Autoren dies vielleicht gar nicht bewußt sein mag).<br />
Diese Dichotomisierung gilt es zu überwinden. Anstatt <strong>Institut</strong>ionen als Ergebnis eines<br />
von unwandelbaren Bedürfnissen geleiteten individuellen Handelns zu begreifen<br />
(oder als Reflex darauf), muß man im Gegenteil davon ausgehen, daß <strong>Institut</strong>ionen<br />
(faßt man den Begriff in Durkheims Sinn weit genug) Interessen institutionalisieren,<br />
d.h. aus einem großen humanspezifischen Potential einzelne Züge herausheben und<br />
verfestigen. Intentionen sind wie <strong>Institut</strong>ionen soziale Tatsachen, sie schließen den<br />
Handelnden ebenso ein wie die Bedingungen und Möglichkeiten seines Handelns.<br />
433 »Immer dann, wenn wir das Konventionelle als etwas Nützliches deuten, wird es <strong>für</strong> uns im doppelten<br />
Sinne "natürlich" — einmal als der Natur inhärent und zum anderen als kulturell normal.«<br />
(Sahlins 1976: 109)
Schluss 255<br />
Die Interessen, welche Menschen verfolgen, können (wie auch Vorstellungen von<br />
Handlungsalternativen und deren Folgen) ihren Ort nur innerhalb der Gesellschaft<br />
haben. Die vermeintliche menschliche (erste) "Natur", auf welche die universalistischen<br />
Ansätze rekurrieren, ist mithin einerseits gesellschaftlich erzeugt, andererseits<br />
aber eine Faktizität, der Rechnung zu tragen ist. Oder, um es anders zu formulieren:<br />
die jeweilige Gesellschaft (d.h. das konkrete Ganze, der Funktionszusammenhang<br />
aus Praxis, Praktiken, kollektiven Vorstellungen) ist die materiale<br />
Basis, von der jede soziologische Erklärung ausgehen muß. Kultur gründet also weder<br />
in der "Lebensnot" noch in Angst, Aggression oder Regression bzw. dem Reflex<br />
hierauf; die strukturelle Bedürftigkeit der Menschen in der bürgerlich-kapitalistischen<br />
Gesellschaft ist nicht naturgegeben, sondern gesellschaftlich erzeugt. 434<br />
Tauschakte und magische Rituale sind "totale" Phänomene, Aktualisierungen klassifikatorischer<br />
Ordnungen, d.h. kollektiver Vorstellungen, die niemals nur die kognitive,<br />
sondern immer auch die affektive Ebene betreffen. Zwischen einerseits den<br />
elementarsten Grundbedürfnissen (Nahrung, Behausung, soziale Anerkennung), die<br />
tatsächlich universeller, d.h. humanspezifischer Natur sein dürften, und andererseits<br />
denjenigen Affekten, die sich nur unter Rückgriff auf die individuelle Lebensgeschichte<br />
erklären lassen und kein Strukturmerkmal einer Gesellschaft sind, ist jenes<br />
weite Feld der Bedeutung, des Sollens und Wollens, der Normativität und des<br />
menschlichen Strebens angesiedelt das ich in dieser Arbeit beleuchtet habe. Mit der<br />
Weiterentwicklung der Ansätze von Durkheim, Mauss, Lévi-Strauss, Polanyi und<br />
Sahlins (um nur die wichtigsten Autoren nochmals zu nennen) habe ich zumindest<br />
die Umrisse und Grundlagen eines Instrumentariums skizziert, welches ich in der<br />
Einleitung, wenngleich vielleicht wenig elegant aber dennoch zutreffend, als <strong>Soziologie</strong><br />
des institutionalisierten Interesses bezeichnete, und das geeignet sein sollte,<br />
den Blick auf kulturelle Unterschiede und historischen Wandel zu schärfen.<br />
Die vergleichende Untersuchung des Komplexes "Wirtschaft und Gesellschaft"<br />
— ob sie nun diesem Paradigma folgt oder nicht — wird sich zukünftig allerdings<br />
zwangsläufig wesentlich stärker auf die Evidenzen der Wirtschaftsgeschichtsschreibung<br />
stützen müssen als auf diejenigen der Ethnographie; die Gaben<br />
tauschenden, auf die Kraft der Magie vertrauenden Kulturen sind heute weitgehend<br />
vom Antlitz dieses Planeten verschwunden. Was bleibt, sind Erinnerungen an eine<br />
überaus reichhaltige Vielfalt von Kulturen und menschlicher Ausdrucksformen, die<br />
angesichts der scheinbar unentrinnbaren Dynamik der weltumspannenden Marktökonomie<br />
das Feld des uns Möglichen aufzeigen. 435 Hervorragendste Aufgabe der<br />
434 Selbstverständlich kann es auch in fremden Kulturen Knappheitsprobleme geben, dieser sind aber<br />
das Spezifikum der jeweiligen Gesellschaft und nicht mit der gesellschaftlich erzeugten Bedürftigkeit<br />
in unserer Kultur der Fülle vergleichbar.<br />
435 Was nicht heißen soll, daß es einen Ort gibt, an den wir zurückkehren könnten — ebensowenig,<br />
wie sie Naturgesetzen folgt, ist die Geschichte umkehrbar; wir werden niemals wieder als Jäger und<br />
Sammler verzauberte Landschaften durchstreifen. Es kann dennoch nicht verwundern, daß "die"<br />
Stammes– oder "primitive" Gesellschaft (in dieser Stilisierung bereits Produkt unserer Projektion)
256 Schluss<br />
Wissenschaft sollte in diesem Zusammenhang sein, uns zu befähigen, die Beschränktheiten<br />
unserer jeweiligen Perspektive und die Bedingtheiten unseres Denkens,<br />
Fühlens und Wollens zu erkennen.<br />
Ich will schließlich nochmals auf Marcel Mauss zurückkommen, welcher der Ausgangspunkt<br />
dieser Arbeit war. Wie bereits erwähnt, beendete Mauss den Essai sur le<br />
don mit "moralischen" Schlußfolgerungen »bezüglich einiger der Probleme ..., vor<br />
die uns die Krise unseres Rechts und unserer Wirtschaft stellt.« (1925: 19) Diese<br />
Probleme wurden seit der Entstehung des Essai schwerlich gelöst. Mauss sah offenbar<br />
einen Weg zu deren Lösung in der Ethik des Gabentauschs. Unterschiedlichste Formen<br />
der ("freundschaftlichen") Kooperation auf Basis nicht allein der Reziprozitätsnorm<br />
sondern der dauerhaften sozialen Beziehung (wie etwa beim "primitiven<br />
Handel") sind auch in modernen Industriegesellschaften möglich. Persönliche<br />
Bindungen müssen nicht sentimental überladen, affektiv überdeterminiert sein,<br />
Freundschaft und Geschäft schließen einander nicht notwendig aus. 436 Wir müssen<br />
nicht zwischen dem kalten Nutzenkalkül des Marktes und der Tyrannei der Intimität<br />
(oder dem Terror der Gemeinschaftsideologie) wählen. Ökonomisches Handeln ist<br />
also auch jenseits des Kapitalismus möglich, der sich nicht auf das Wesen des Menschen<br />
berufen kann, um sich zu legitimieren.<br />
Die Warenökonomie ist, wenn es denn dieser Hervorhebung noch bedarf,<br />
auch eine psychische Ökonomie. Was Goethe über Karl-Philip Moritz sagte — »ein<br />
seltsames Gefäß, immer leer und inhaltsbedürftig nach Gegenständen lechzend, die<br />
er sich aneignen könnte« — ist durchaus eine treffende Beschreibung des Konsumenten<br />
in der entwickelten Warengesellschaft. Der Zusammenhang zwischen expansiver<br />
Güterproduktion und ebenso expansiver Bedürfnisproduktion markiert eine<br />
Dynamik, die in keiner anderen Gesellschaft existiert. 437 Aber, um es zu wiederholen,<br />
diese Dynamik folgt lediglich einem gesellschaftlich bedingten partikularen Imperativ<br />
und keinem Naturgesetz. Gegenstand der <strong>Soziologie</strong> ist dieser Imperativ und<br />
die mit ihm korrespondierenden Intentionen, nicht die objektive Natur — und diese<br />
Intentionen sind nicht naturgegeben, sondern vielmehr gesellschaftlich institutionalisiert,<br />
sie sind historisch gewordene (und weitgehend kontingente) soziale Tatsachen<br />
und kollektive Vorstellungen.<br />
LITERATUR<br />
nicht erst im 20. Jahrhundert zu einem Phantasma der offenbar an sich selbst krankenden westlichen<br />
Zivilisation wurde: dort, wo jeder Mensch, jede Sache und jeder Affekt seinen unverrückbaren Ort<br />
hat, ist der Zweifel besiegt — mehr noch, er ist nicht denkbar. Die Sehnsucht zielt letztlich auf eine<br />
festgefügte Ordnung, eine ein <strong>für</strong> allemal feststehende Gewißheit, einen sicheren sozialen Ort der<br />
Identität.<br />
436 Wie Hans Leo Krämer bemerkt, könnte der Gabentausch als neues (anti-utilitaristisches)<br />
soziologisches Paradigma eine Alternative zum Kommunitarismus werden (1999: 262).
Literatur 257<br />
Abu-Lughod, J. L. (1989): Before European Hegemony. The World System A.D.<br />
1250-1350. New York (Oxford University Press).<br />
Ackerman, R. (1987): J. G. Frazer. His life and work. Cambridge (Cambridge University<br />
Press).<br />
Altman, J. / Peterson, N. (1988) Rights to game and rights to cash among contemporary<br />
Australian hunter-gatherers. In Ingold/Riches/Woodburn 1988, Vol.2.<br />
Appadurai, A. [Ed.] (1986a): The social life of things. Commodities in cultural perspective.<br />
Cambridge, New York, Melbourne (Cambridge University Press).<br />
— (1986b): Commodities and the politics of value. In ders. 1986a.<br />
Assad, T. (1986): Übersetzen zwischen Kulturen. Ein Konzept der britischen Sozialanthropologie.<br />
In Berg, E. / Fuchs, M. [Hg.] (1993): Kultur, soziale Praxis,<br />
Text. Frankfurt/Main (Suhrkamp).<br />
Bariç, L. (1962): Some Aspects of Credit, Saving and Investment in a 'Non-Monetary'<br />
Economy (Rossel Island). In Firth/Yamey 1964.<br />
Barnes, B. (1973): Glaubenssysteme im Vergleich: Falsche Anschauungen oder<br />
Anomalien? In Kippenberg/Luchesi (1978).<br />
Barker, P. (1995): The Ghost Road. Harmondsworth (Penguin) 1996.<br />
Barthes, R. (1957): Mythen des Alltags. Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1964.<br />
Barnard, A. / Woodburn, J. (1988): Introduction. In Ingold/Riches/Woodburn<br />
1988, Vol.2.<br />
Beattie, J.H.M. (1970): Über das Verstehen von Ritualen. In Kippenberg/Luchesi<br />
(1978).<br />
Benhabib, S. (1986): Kritik, Norm und Utopie. Die normativen Grundlagen der kritischen<br />
Therie. Frankfurt/Main (Fischer) 1992.<br />
Berg, E. und Fuchs, M. [Hg.] (1993): Kultur, soziale Praxis, Text. Zur Krise der<br />
ethnographischen Repräsentation. Frankfurt/Main (Suhrkamp)<br />
Berking, H. (1996): Schenken. Zur Anthropologie des Gebens. Frankfurt/Main<br />
(Campus).<br />
Bitterli, U. (1991): Die "Wilden" und die "Zivilisierten". Grundzüge einer Geistes–<br />
und Kulturgeschichte der europäisch-überseeischen Begegnung. München<br />
(Beck).<br />
Bourdieu, P. (1972): Entwurf einer Theorie der Praxis, auf der ethnologischen<br />
Grundlage der kabylischen Gesellschaft. Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1976.<br />
— (1979): Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft.<br />
Frankfurt/ Main (Suhrkamp) 1982.<br />
Bowker, J. [Ed.] (1997): The Oxford Dictionary of World Religions. Oxford / New<br />
York (Oxford University Press).<br />
Bowra, Cecil (1962): Griechenland. München (dtv) 1978.<br />
Braudel, F. (1985): Die Dynamik des Kapitalismus. Stuttgart (Klett-Cotta) 1997.<br />
Brückner, P. (1982) Psychologie und Geschichte. Berlin (Wagenbach).<br />
Burch, E.S. jr. (1988): Modes of exchange in north-west Alaska. In Ingold/Riches/Woodburn<br />
1988, Vol.2.<br />
Campbell, S. F. (1983a): Kula in Vakuta: the mechanics of keda. In Leach & Leach<br />
1983.<br />
— (1983b): Attaining rank: a classification of kula shell valuables. In Leach & Leach<br />
1983.<br />
Cashdan, E. (1989): Hunters and Gatherers: Economic Behavior in Bands. In Plattner,<br />
S. [Ed.]: Economic Anthropology. Stanford, Cal. (Stanford Univ. Press).<br />
Chagnon, N. (1992): Yanomamö. Leben und Sterben der Indianer am Orinoko. Berlin
258 Literatur<br />
(Byblos) 1994.<br />
Cheal, D. (1988): The Gift Economy. London and New York (Routledge).<br />
Childe, V. Gordon (1951): Soziale Evolution. Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1970.<br />
Clastres, P. (1972): Chronik der Guayaki. München (Trickster) 1984.<br />
— (1974): Staatsfeinde. Studien zur politischen Anthropologie. Frankfurt/Main<br />
(Suhrkamp) 1976.<br />
Clifford, J. (1986): Über ethnographische Allegorie. In Berg/Fuchs 1993.<br />
Corbin, A. (1988): Meereslust. Das Abendland und die Entdeckung der Küste 1750-<br />
1840. Berlin (Wagenbach) 1990.<br />
Dalton, G. (1962): Traditional Production in Primitive African Economies. In Dalton<br />
1967.<br />
— [Ed.] (1967): Tribal and peasant economies. Austin (University of Texas Press)<br />
1981.<br />
Davies, V. und Friedman, R. (1998): Egypt. London (British Museum Press).<br />
Desmond, A. / Moore, J. (1991): Darwin. Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 1994.<br />
Dodds, E. R. (1951): The Greeks and the Irrational. Berkeley and Los Angeles (University<br />
of California Press).<br />
Douglas, M. (1966): Reinheit und Gefährdung. Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1988.<br />
— (1973): Ritual, Tabu und Körpersymbolik. Frankfurt/Main (Fischer) 1986.<br />
— (1986): Wie <strong>Institut</strong>ionen denken, Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1991.<br />
Drucker, P. (1965): The Potlatch. In Dalton 1967.<br />
Duby, G. (1969): Krieger und Bauern. Die Entwicklung der mittelalterlichen Wirtschaft<br />
und Gesellschaft bis um 1200. Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1984.<br />
— (1984): Guillaume le Maréchal oder der beste aller Ritter. Frankfurt/Main<br />
(Suhrkamp) 1986.<br />
Dumont, L. (1966): Gesellschaft in Indien. Die <strong>Soziologie</strong> des Kastenwesens. Wien<br />
(EVA) 1976.<br />
Durkheim, É. (1901 2 ): Regeln der soziologischen Methode. Neuwied und Berlin<br />
(Luchterhand) 1970.<br />
— (1902 2 ). Über soziale Arbeitsteilung. Studie über die Organisation höherer Gesellschaften.<br />
Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1988.<br />
— (1906): Bestimmung der moralischen Tatsache und Entgegnungen auf Einwände.<br />
In ders.: <strong>Soziologie</strong> und Philosophie. Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1967.<br />
— (1912): Die elementaren Formen des religiösen Lebens. Frankfurt/Main (Suhrkamp)<br />
1978.<br />
— (1913/14): Pragmatismus und <strong>Soziologie</strong>. In ders.: Schriften zur <strong>Soziologie</strong> der<br />
Erkenntnis. Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1984.<br />
Durkheim, É. und Mauss, M. (1903): Über einige primitive Formen von Klassifikation.<br />
Ein Beitrag zur Erforschung der kollektiven Vorstellungen. In Durkheim,<br />
É.: Schriften zur <strong>Soziologie</strong> der Erkenntnis. Hg. von Hans Joas. Frankfurt/Main<br />
(Suhrkamp) 1984.<br />
Ebel, I. (1992): Emotionen als bewußtseinsphilosophisches und subjektivitätstheoretisches<br />
Problem. Eine kritische Übersicht. Magisterarbeit am philosophischen<br />
Seminar der Universität Hannover (unveröffentlicht).<br />
Eco, U. (1968): Einführung in die Semiotik. München (Wilhelm Fink) 1975.<br />
Edwards, I.E.S. (1961 2 ): The Pyramids of Egypt. Harmondsworth (Penguin).<br />
Elster, J. (1979) Ulysses and the Sirens. Studies in rationality and irrationality. Cam-
Literatur 259<br />
bridge (Cambridge Univ. Press). Die zitierten Passagen dt. in Elster 1987. Seitenangaben<br />
beziehen sich hierauf.<br />
— [Hg.] (1986): Rational Choice. New York, N.Y. (New York Univ. Press).<br />
— (1987): Subversion der Rationalität. Frankfurt/Main (Campus).<br />
Elwert, G. (1991): Gabe, Reziprozität und Warentausch. Überlegungen zu einigen<br />
Ausdrücken und Begriffen. In Berg/Lauth/Wimmer [Hg.] (1991): Ethnologie<br />
im Widerstreit. München (Trickster).<br />
Endicott, K. (1988): Property, power and conflict among the Batek of Malaysia. In<br />
Ingold/Riches/Woodburn 1988, Vol.2.<br />
Evans-Pritchard, E. E. (1937): Hexerei, Orakel und Magie bei den Zande. Von Eva<br />
Gillies gekürzte und eingeleitete Ausgabe. Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1978.<br />
— (1950): Sozialanthropologie gestern und heute. Marret-Gedächtnis-Vorlesung.<br />
In ders. 1965.<br />
— (1956): Nuer Religion. New York und Oxford (Oxford University Press) 1969.<br />
— (1965): Theorien über primitive Religionen. Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1981.<br />
Fagan, B. M. (1991): Das frühe Nordamerika. Archäologie eines Kontinents. München<br />
(Beck) 1993.<br />
Fages, J. B. (1968): Den Strukturalismus verstehen. Einführung in das strukturale<br />
Denken. Gießen (Achenbach) 1974.<br />
Ferguson, I. [Ed.] (1997): Virtual History. Alternatives and Counterfactuals. London<br />
(Macmillan-Papermac).<br />
Finkeldey, L. [Hg.] (1999): Tausch statt Kaufrausch, Bochum (SWI-Verlag).<br />
Firth, R. und Yamey, B.S. [Eds.] (1964). Capital, Saving and Credit in Peasant Societies.<br />
London (George Allen and Unwin).<br />
Forrester, V. (1996): Der Terror der Ökonomie. Wien (Zsolnay) 1997.<br />
Frank, A. G. (1998): ReOrient. Global Economy in the Asian Age. Berkely and Los<br />
Angeles (University of California Press).<br />
Frankfort, Henri (1948): Kingship an the Gods. A Study of Ancient Near Eastern<br />
Religion as the Integration of Society and Nature. London (University of Chicago<br />
Press) 1978.<br />
Frazer, J. G. (1922): The Golden Bough. A Study in Magic and Religion [abridged<br />
edition]. Ware, Hertfordshire (Wordsworth) 1993.<br />
Freeman, L. (1968): A theoretical framework for interpreting archeological materials.<br />
In Lee/DeVore 1968.<br />
Freud, S. (1899): Die Traumdeutung. Frankfurt/Main (Fischer) 1961.<br />
— (1912/13): Totem und Tabu. Einige Übereinstimmungen im Seelenleben der<br />
Wilden und der Neurotiker. In ders.: Studienausgabe Bd. IX. Frankfurt/Main<br />
(Fischer) 1982.<br />
— (1930): Das Unbehagen in der Kultur. In ders.: Studienausgabe Bd. IX, Frankfurt/Main<br />
(Fischer) 1982.<br />
Gaita, R. (1989): The Personal in Ethics. In Dewi/Winch [Eds.]: Wittgenstein. Attention<br />
to Particulars. London (Macmillan).<br />
Gay, P. (1987): Freud. Eine Biographie <strong>für</strong> unsere Zeit. Frankfurt/Main (Fischer)<br />
1995.<br />
Geertz, C. (1962): Social Change and Economic Modernization in Two Indonesian<br />
Towns. In Dalton 1967.<br />
Gell, A.: Newcomers in the world of goods. Consumption among the Muria Gonds.<br />
In Appadurai 1986a.<br />
Gellner, E. (1970): Concepts an Society. In Wilson 1970.
260 Literatur<br />
Geyer, T. (1998): Angst als psychische und soziale Realität. Frankfurt/Main (Peter<br />
Lang).<br />
Gibson, T. (1988): Meat sharing as a political ritual: forms of transaction versus<br />
modes of subsistence. In Ingold/Riches/Woodburn 1988, Vol.2.<br />
Giddens, A. (1976): Interpretative <strong>Soziologie</strong>. Eine kritische Einführung. Frankfurt/Main<br />
(Campus) 1984.<br />
Godelier, M. (1966): Rationalität und Irrationalität in der Ökonomie. Frankfurt/Main<br />
(EVA) 1972.<br />
— (1982): Die Produktion der großen Männer. Frankfurt/Main (Campus) 1987.<br />
— (1984): Natur, Arbeit, Geschichte. Zu einer unversalgeschichtlichen Theorie der<br />
Wirtschaftsformen. Hamburg (Junius) 1990.<br />
— (1993): L'occident, mirroir brisé. Une évaluation partielle de l'anthropologie sociale<br />
assortie des queleques perspectives. In Annales 48, Nr. 5, September/ Oktober<br />
1993.<br />
— (1996): Das Rätsel der Gabe. München (Beck) 1999.<br />
Goody, J. (1961): Religion and Ritual: The Definitional Problem. In British Journal<br />
of Sociology 12, 1961.<br />
Görlich, J. (1992): Tausch als rationales Handeln. Zeremonieller Gabentausch und<br />
Tauschhandel im Hochland von Papua-Neuguinea. Berlin (Reimer).<br />
Goffman, E. (1971): Das Individuum im öffentlichen Austausch. Frankfurt/Main<br />
(Suhrkamp) 1974.<br />
Gouldner, A. W. (1973): Reziprozität und Autonomie. Ausgewählte Aufsätze.<br />
Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1984.<br />
Green, A. (1980): Der Mythos: Ein kollektives Übergangsobjekt. Kritischer Ansatz<br />
und psychoanalytische Perspektiven. In Levi-Strauss, Claude; Vernant, Jean-<br />
Pierre u.a.: Mythos ohne Illusion. Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1984.<br />
Gregory, C. (1982): Gifts and Commodities. London (Academic Press).<br />
— (1983): Kula gift exchange and capitalist commodity exchange: a comparison. In<br />
Leach & Leach 1983.<br />
Habermas, J. (1976): Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus. Frankfurt/Main<br />
(Suhrkamp) 1981.<br />
— (1981): Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt/Main (Suhrkamp)<br />
1987.<br />
Hacking, I. (1982): Language, Truth and Reason. In Hollis/Lukes 1982.<br />
— (1999): Was heißt "soziale Konstruktion"? Frankfurt/Main (Fischer).<br />
Harding, T.H. (1967): Voyagers of the Vitiaz Strait. A Study of a New Guinea Trade<br />
System. Seattle and London (Univ. of Washington Press).<br />
Hanson, F. A. (1981): Anthropologie und die Rationalitätsdebatte. In Duerr, H.P.:<br />
Der Wissenschaftler und das Irrationale, Bd.I. Frankfurt/ Main (EVA) 1981.<br />
Heinrichs, H.-J. (1983): Sprachkörper. Zu Claude Lévi-Strauss und Jaques Lacan.<br />
Frankfurt/Main (Qumran).<br />
Heit, H. (2003): Der Ursprungsmythos der Vernunft. Zur Genealogie der Griechischen<br />
Philosophie als Abgrenzung vom Mythos. Phil. Dissertation, Universität<br />
Hannover.<br />
Herodot: Historien. Stuttgart (Kröner) 1963.<br />
Hobbes, T.: 1651. Leviathan. Neuwied und Berlin (Luchterhand) 1966.<br />
Hogbin, I. (1951): Transformation Scene. The changing culture of a New Guinea<br />
village. London (Routledge & Kegan Paul).<br />
Hollis, M. and Lukes, S. [Eds.] (1982): Rationality and Relativism. Oxford (Basil
Literatur 261<br />
Blackwell)<br />
Honneth, A. (1999): Jürgen Habermas. In Kaesler, Dirk [Hg.]: Klassiker der <strong>Soziologie</strong>.<br />
München (Beck).<br />
Horton, R. (1967): African Traditional Thought and Western Science. In Wilson<br />
1970.<br />
— (1981): Tradition and Modernitiy Revisited. In Hollis/Lukes 1982.<br />
Hume, D.: 1740. Ein Traktat über die menschliche Natur. Zweites Buch. Hamburg<br />
(Felix Meiner) 1973.<br />
Ingold, T. / Riches, D. / Woodburn, J. [Eds.] (1988): Hunters and Gatherers.<br />
Vol.1: History, Evolution and social change. Vol.2: Property, power and ideology.<br />
Oxford / New York (Berg).<br />
Ingold, T. (1986): The appropiation of nature: essays on human ecology and social<br />
relations. Manchester (Manchester University Press).<br />
— (1988): Notes on the foraging mode of production. In Ingold/-<br />
Riches/Woodburn 1988, Vol.1.<br />
Jacob, F. (1970): The Logic of Life. A History of Heredity. Harmondsworth (Penguin)<br />
1989.<br />
— (1982): The Possible and the Actual. Harmondsworth (Penguin) 1989.<br />
— (1987): Die innere Statue. Zürich (Amann) 1988.<br />
Jakobson, R. (1972): Die Linguistik und ihr Verhältnis zu anderen Wissenschaften.<br />
In ders.: Aufsätze zur Linguistik und Poetik. Frankfurt/Main, Berlin, Wien (Ullstein)<br />
1979..<br />
Jarvie, Ian C. und Agassi, Joseph (1967): Das Problem der Rationalität von Magie.<br />
In Kippenberg/Luchesi 1978.<br />
Kämpf, H. (1995): Tauschbeziehungen. Zur anthropologischen Fundierung des<br />
Symbolbegriffs. München (Fink).<br />
Kippenberg, H. G. und Luchesi, B. [Hg.] (1978): Magie. Die sozialwissenschaftliche<br />
Kontroverse über das Verstehen fremden Denkens. Frankfurt/Main (Suhrkamp).<br />
König. R. (1961): Einleitung zu Durkheims "Regeln der soziologischen Methode. In<br />
Durkheim 1901.<br />
Kohl, K.-H. (1979): Abwehr und Verlangen. Der Eurozentrismus in der Ethnologie.<br />
In Berliner Hefte 12, September 1979. Berlin (Verlag Kantstraße).<br />
— (1993): Ethnologie. Die Wissenschaft vom kulturell Fremden. München (Beck).<br />
— (2003): Die Macht der Dinge. Geschichte und Theorie sakraler Objekte. München<br />
(Beck).<br />
Kolenda, P. M. (1963): Toward a Model of the Hindu Jaimani System. In Dalton<br />
1967.<br />
Kopytoff, I.: The cultural biography of things. Commodiziation in progress. In Appadurai<br />
1986a.<br />
Krämer, H. L. (1999): Die Durkheimianer Marcel Mauss und Maurice Halbwachs.<br />
In Kaesler, D. [Hg.]: Klassiker der <strong>Soziologie</strong>, Band 1. München (Beck).<br />
Kramer, F. und Sigrist, C. [Hg.] (1978): Gesellschaften ohne Staat. Gleichheit und<br />
Gegenseitigkeit. Frankfurt/Main (Syndikat).<br />
Langer, S. K. (1942): Philosophie auf neuem Wege. Das Symbol im Denken, im Ritus<br />
und in der Kunst. Frankfurt/Main (Fischer) 1984.<br />
Leach, E. (1983): The kula: an alternative view. In Leach & Leach 1983.<br />
Leach, E.R. & Leach, J.W. [Eds.] (1983): The Kula. New perspectives on Massim
262 Literatur<br />
exchange. Cambridge (Cambridge University Press).<br />
Leclerc, G. (1972): Anthropologie und Kolonialismus. München (Hanser) 1973.<br />
Lee, R. (1969): The !Kung San. Men, women and work in a foraging society. Cambridge<br />
(Cambridge University Press).<br />
— (1988): Reflections on primitive communism. In Ingold/Riches/Woodburn<br />
1988, Vol.1.<br />
Lee, R. B. / DeVore, I. [Eds.] (1968): Man the Hunter. New York (Aldine).<br />
Lévi-Strauss, C. (1945a): Die Strukturanalyse in der Sprachwissenschaft und in der<br />
Anthropologie. In ders. 1958a.<br />
— (1945b): French Sociology. In Gurvitch, G. und Moore, W.E. [Hg.]: Twentieth<br />
Century Sociology. New York 1945.<br />
— (1949a): Der Zauberer und seine Magie. In ders. 1958a.<br />
— (1949b): Die Wirksamkeit der Symbole. In ders. 1958a.<br />
— (1950): Einleitung in das Werk von Marcel Mauss. In Mauss 1950.<br />
— (1951): Sprache und Gesellschaft. In ders. 1958a.<br />
— (1952): Der Strukturbegriff in der Ethnologie. In ders. 1958a.<br />
— (1955): Traurige Tropen. Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1982.<br />
— (1958a): Strukturale Anthropologie I. Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1967.<br />
— (1958b): Die Geschichte von Asdiwal. In ders. 1973.<br />
— (1961): Die kulturellen Diskontinuitäten und die ökonomische und soziale Entwicklung.<br />
In ders. 1973.<br />
— (1960): Das Feld der Anthropologie. In ders. 1973.<br />
— (1962a): Das Ende des Totemismus. Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1973.<br />
— (1962b): Das wilde Denken. Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1973.<br />
— (1965): The Concept of Primitiveness. In Lee/DeVore 1968.<br />
— (1967 2 ): Die Elementaren Strukturen der Verwandtschaft. Frankfurt/ Main<br />
(Suhrkamp) 1981.<br />
— (1973): Strukturale Anthropologie II. Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1975.<br />
— (1976): Die Lehren der Linguistik. In ders. 1983b.<br />
— (1983a): Die Familie. In ders. 1983b.<br />
— (1983b): Der Blick aus der Ferne. München (Wilhelm Fink) 1985.<br />
— (1985): Die eifersüchtige Töpferin. Nördlingen (Greno) 1987.<br />
— (1988): Das Nahe und das Ferne. Eine Autobiographie in Gesprächen mit D.<br />
Eribon. Frankfurt/Main (Fischer) 1996.<br />
— (1991): Die Luchsgeschichte. München/Wien (Hanser) 1993.<br />
Lindig, W. / Münzel, M. (1976): Die Indianer. Kulturen und Geschichte. 2 Bde.<br />
München (dtv) 1985.<br />
Linkenbach, A. (1986): Opake Gestalten. Jürgen Habermas und die Rationalität<br />
fremder Lebensformen. München (Fink).<br />
Lukes, S.: (1973a): Zur gesellschaftlichen Determiniertheit von Wahrheit. In Kippenberg/Luchesi<br />
1978.<br />
— (1973b): Émile Durkheim. His Life and Work: a Historical and Critical Study.<br />
Harmondsworth 1975.<br />
Malinowski, B. (1922): Argonauten des westlichen Pazifik. Frankfurt/Main (Syndikat)<br />
1979.<br />
— (1925): Magie, Wissenschaft und Religion. In : Magie, Wissenschaft und Religion.<br />
Und andere Schriften. Frankfurt/Main (Fischer) 1973.<br />
— (1926): Gegenseitigkeit und Recht (Auszüge aus "Crime and Custom in Savage
Literatur 263<br />
Society"). In Kramer/Sigrist 1978.<br />
— (1935): Korallengärten und ihre Magie. Frankfurt/Main (Syndikat) 1981.<br />
— (1939): Die Funktionaltheorie. In ders.: Eine wissenschaftliche Theorie der Kultur<br />
und andere Aufsätze. Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1985.<br />
Marshall, L. (1961): Sharing, taking and giving: relief of social tension among !Kung<br />
Bushmen. In Africa, 31.<br />
Marx, K. (1890 4 ): Das Kapital, Bd.I. [MEW 23]. Berlin (Dietz) 1962.<br />
Mauss, M. (1925): Die Gabe. Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften.<br />
Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1984.<br />
— (1950): <strong>Soziologie</strong> und Anthropologie I. München/Wien (Hanser) 1974.<br />
Mauss, M. und Hubert, H. (1902/03): Entwurf einer allgemeinen Theorie der Magie.<br />
In Mauss 1950.<br />
McLynn, F. (1992): Hearts of Darkness. The European Exploration of Africa. London<br />
(Pimlico) 1993.<br />
Mead, M. (1937a): The Arapesh of New Guinea. In dies. [Ed.]: Cooperation and<br />
competition among primitve peoples. Gloucester, Mass. (Peter Smith) 1976.<br />
— (1937b): The Manus of the Admiralty Islands. (Ebenfalls in Cooperation and<br />
competition among primitve peoples.)<br />
Meillassoux, C. (1975): »Die wilden Früchte der Frau«. Frankfurt/Main (Suhrkamp)<br />
1984.<br />
Mintz, S. W. (1985): Die süsse Macht. Frankfurt/Main, New York (Campus) 1987.<br />
Molleson, T. (1994) Die beredten Skelette von Tell Abu Hureya. In Spektrum der<br />
Wissenschaft 10/1994.<br />
Monk, Ray (1990): Wittgenstein. Das Handwerk des Genies. Stuttgart (Klett-Cotta)<br />
1992.<br />
Morgan, Lewis H. (1877): Die Urgesellschaft. Stuttgart (Dietz) 1908.<br />
Müller, H.-P. und Schmid, M. (1987): Arbeitsteilung, Solidarität und Moral. Eine<br />
werkgeschichtliche und systematische Einführung in die "Arbeitsteilung" von<br />
Émile Durkheim. In Durkheim 1902.<br />
Müller, R. W. (1977): Geld und Geist. Frankfurt/Main (Campus).<br />
Murra, J. V. (1980): The Economic Organization of the Inca State. Research in Economic<br />
Anthropology Supplement. Greenwich, Connecticut (Jai Press).<br />
Myers, F. (1988): Burning the truck and holding the country: property, time, and<br />
the negotiation identity among Pintupi Aborigines. In Ingold/Riches/Woodburn<br />
1988, Vol.2.<br />
Nolte, H.-H. (2002): Die Debatte um das Weltsystem. Diskussionspapier, Historisches<br />
Seminar der Universität Hannover (http://www.vgws.org/weltsystemkonzept.html).<br />
O'Hear, A. (1999): After Progress. London (Bloomsbury).<br />
Oliver, D. (1955): A Solomon Island Society. Cambridge, Mass. (Havard Univ.<br />
Press).<br />
Oppitz, M. (1975): Notwendige Beziehungen. Abriß der strukturalen Anthropologie.<br />
Frankfurt/Main (Suhrkamp).<br />
Otto, W. F. (1963): Einleitung zu Herodot, Historien.<br />
Parsons, T. (1937): The Structure of Social Action. New York (Mc Graw-Hill).<br />
Paul, A. T. (1997): Gabe — Ware — Geschenk. Marginalien zur <strong>Soziologie</strong> des<br />
Schenkens. In Soziologische Revue, Jahrgang 20 (Heft 4/1997).<br />
Pirenne, H. (1933): Sozial– und Wirtschaftsgeschichte Europas im Mittelalter. Mün-
264 Literatur<br />
chen (A. Francke) 1982.<br />
Polanyi, K. (1944): The Great Transformation. Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1978.<br />
— (1947): Unser obsoletes marktwirtschaftliches Denken. In ders. 1979.<br />
— (1957a): Aristoteles entdeckt die Volkswirtschaft: In ders. 1979.<br />
— (1957b): The Economy as <strong>Institut</strong>ed Process. In Polanyi/Arensberg/Pearson<br />
1957.<br />
— (1979): Ökonomie und Gesellschaft. Frankfurt/Main (Suhrkamp).<br />
Polanyi/Arensberg/Pearson [Eds.] (1957). Trade and Market in the Early Empires.<br />
Glencoe,Ill. (The Free Press).<br />
Pomeranz, K. (2000) The Great Divergence. China, Europe, and the Making of the<br />
Modern World Economy. Princeton (Princeton University Press).<br />
Ricœur, P. (1977): Ideologie und Ideologiekritik. In: Waldenfels, B. [Hg.]: Phänomenologie<br />
und Marxismus I. Konzepte und Methoden. Frankfurt/Main (Suhrkamp).<br />
Rost, F. (1994): Theorien des Schenkens. Zur kultur– und humanwissenschaftlichen<br />
Bearbeitung eines anthropologischen Phänomens. Essen (Die Blaue Eule).<br />
Sahlins, M. (1963): Poor Man, Rich Man, Big Man, Chief: Political Types in Melanesia<br />
and Polynesia. In Comparative Studies in Society and History 5/1963.<br />
— (1972): Stone-Age Economics. Hawthorne, N.Y. (Aldine de Gruyter).<br />
— (1976): Kultur und praktische Vernunft. Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1981.<br />
— (1985): Inseln der Geschichte. Hamburg (Junius) 1992.<br />
— (1996): The Sadness of Sweetness. The Native Anthropology of Western Cosmology.<br />
Sidney W. Mintz Lecture for 1994. In Current Anthropology Vol. 17,<br />
Number 3, June 1996.<br />
Saussure, F. de (1915): Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft. Berlin (de<br />
Gruyter) 1967.<br />
Schama, S. (1995): Der Traum von der Wildnis. Natur als Imagination. München<br />
(Hanser) 1996.<br />
Schapera, I. (1928): Economic Changes in South African Native Life. In Dalton<br />
1967.<br />
Schmied, G. (1996): Schenken. Über eine Form sozialen Handelns. Opladen (Leske<br />
und Budrich).<br />
Schofer, B. (1999): Das Relativismusproblem in der neueren Wissenssoziologie.<br />
Wissenschaftsphilosophische Ausgangspunkte und wissenssoziologische Lösungsansätze.<br />
Berlin (Duncker & Humblot).<br />
— (2000): "Für einen moderaten Relativismus in der Wissenschaftssoziologie. Zur<br />
Debatte um die philosophischen Voraussetzungen und Konsequenzen der neueren<br />
Wissenschaftssoziologie." In: Kölner Zeitschrift <strong>für</strong> <strong>Soziologie</strong> und Sozialpsychologie.<br />
Vol. 52: 696-719.<br />
Skirbekk, G. und Gilje, N. (1987): Geschichte der Philosophie. Eine Einführung in<br />
die europäische Philosophiegeschichte. Frankfurt/ Main (Suhrkamp) 1993.<br />
Smith, A. (1776): Der Wohlstand der Nationen. Eine Untersuchung seiner Natur<br />
und seiner Ursachen. München (C. H. Beck) 1974.<br />
Snell, B. (1946): Die Entdeckung des Geistes. Studien zur Entstehung des europäischen<br />
Denkens bei den Griechen. Hamburg (Claazen & Goverts).<br />
<strong>Söder</strong>-<strong>Mahlmann</strong>, J. (1992 2 ): Computerfaszination und Gesellschaftsentwicklung.<br />
Eine sozialpsychologische Studie. Hannover (Internationalismus Verlag).<br />
— (1999): Andere Völker, andere Sitten. Tausch im interkulturellen Vergleich. In
Literatur 265<br />
Finkeldey 1999.<br />
Spufford, P. (2002): Handel, Macht und Reichtum. Kaufleute im Mittelalter. Darmstadt<br />
(Wiss. Buchgesellschaft) 2004.<br />
Stanley, H. M. (1899): Through the Dark Continent. Volume One. Mineola, N.Y.<br />
(Dover) 1988.<br />
Starobinski, J. (1994): Gute Gaben, schlimme Gaben. Die Ambivalenz sozialer Gesten.<br />
Frankfurt/Main (Fischer) 1994.<br />
Stender, Wolfram (1995): Kritik und Vernunft. Phil. Dissertation, Universität Hannover<br />
(unter gleichem Titel leicht gekürzt 1996 im Verlag zu Klampen, Lüneburg<br />
erschienen).<br />
Strathern, A. (1971): The Rope of Moka. Big-Men and Ceremonial Exchange in<br />
Mount Hagen, New-Guinea. Cambridge (Cambridge Univ. Press).<br />
Streck, B. [Hg.] (1987): Wörterbuch der Ethnologie. Köln (dumont).<br />
Tambiah, S. J. (1970): Form und Bedeutung magischer Akte. Ein Standpunkt. In<br />
Kippenberg/Luchesi (1978)<br />
Terray, E. (1969): Zur politischen Ökonomie der "primitiven" Gesellschaften.<br />
Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1974.<br />
Thukydides: Geschichte des Peloponnesischen Krieges. Zürich 1960.<br />
Thurnwald, R. (1919): Politische Gebilde bei Naturvölkern. Ein systematischer Versuch<br />
über die Anfänge des Staates. In ders. 1957.<br />
— (1936): Gegenseitigkeit im Aufbau und Funktionieren der Gesellungen und deren<br />
<strong>Institut</strong>ionen. In ders. 1957.<br />
— (1957): Grundfragen menschlicher Gesellung. Ausgewählte Schriften. Berlin<br />
(Duncker & Humblot).<br />
Tönnies, F. (1889): Gemeinschaft und Gesellschaft. Darmstadt (Wiss. Buchgesellschaft)<br />
1991.<br />
Veblen, T. (1899): Theorie der feinen Leute. Eine ökonomische Untersuchung der<br />
<strong>Institut</strong>ionen. Frankfurt/Main (Fischer) 1986.<br />
Wallerstein, I. (1974): Das moderne Weltsystem. Die Anfänge kapitalistischer<br />
Landwirtschaft und die europäische Weltökonomie im 16. Jahrhundert. Frankfurt/Main<br />
(Syndikat) 1986.<br />
Weber, M. (1922): Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß einer verstehenden <strong>Soziologie</strong>.<br />
Tübingen (Mohr und Siebeck) 1976.<br />
Webster, R. (1995): Why Freud was wrong. Sin, Science and Psychoanalysis. London<br />
(Fontana) 1996.<br />
Weiner, A.B. (1976): Women of Value, Men of Renown. New Perspectives in Trobriand<br />
Exchange. Austin & London (University of Texas Press).<br />
— (1988): The Trobrianders of Papua New Guinea. New York, N.Y. (Holt, Rinehart<br />
and Winston).<br />
— (1992): Inalienable Possessions. The Paradox of Keeping-While-Giving. Berkeley<br />
/ Los Angeles / Oxford (University of California Press).<br />
Wilson, B. [Ed.] (1970): Rationality. Oxford (Basil Blackwell).<br />
Winch, P. (1958): Die Idee der Sozialwissenschaft und ihr Verhältnis zur Philosophie.<br />
Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1974.<br />
— (1964): Was heißt "eine primitive Gesellschaft verstehen"?. In Kippenberg/Luchesi<br />
1978.<br />
Woodburn, J. (1982): Egalitarian Societies. In Man, 17: 431-451.